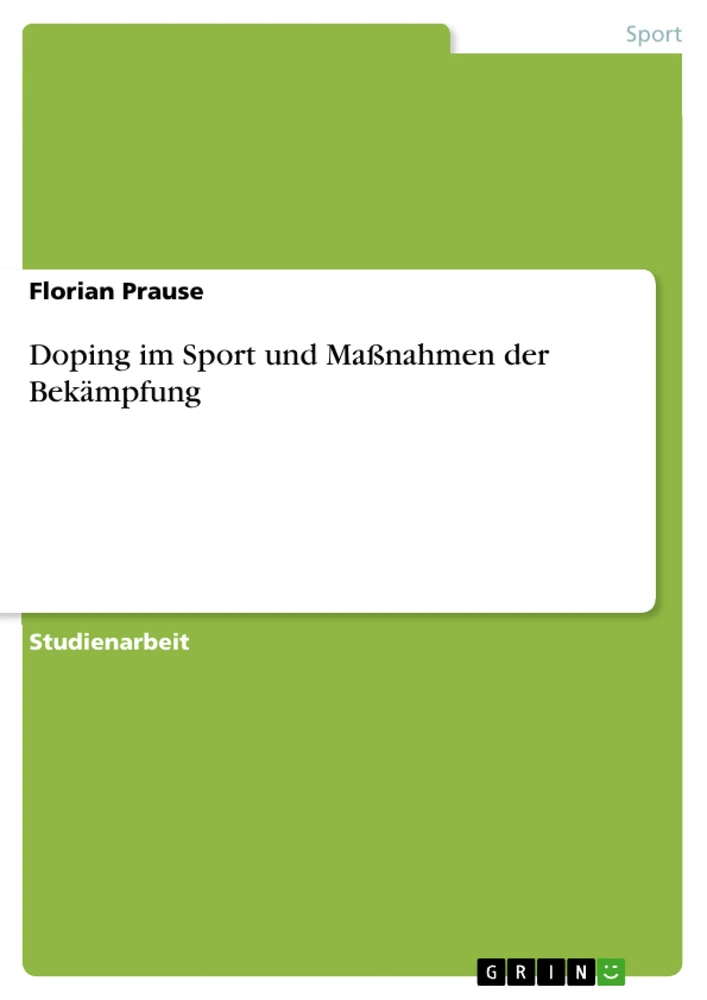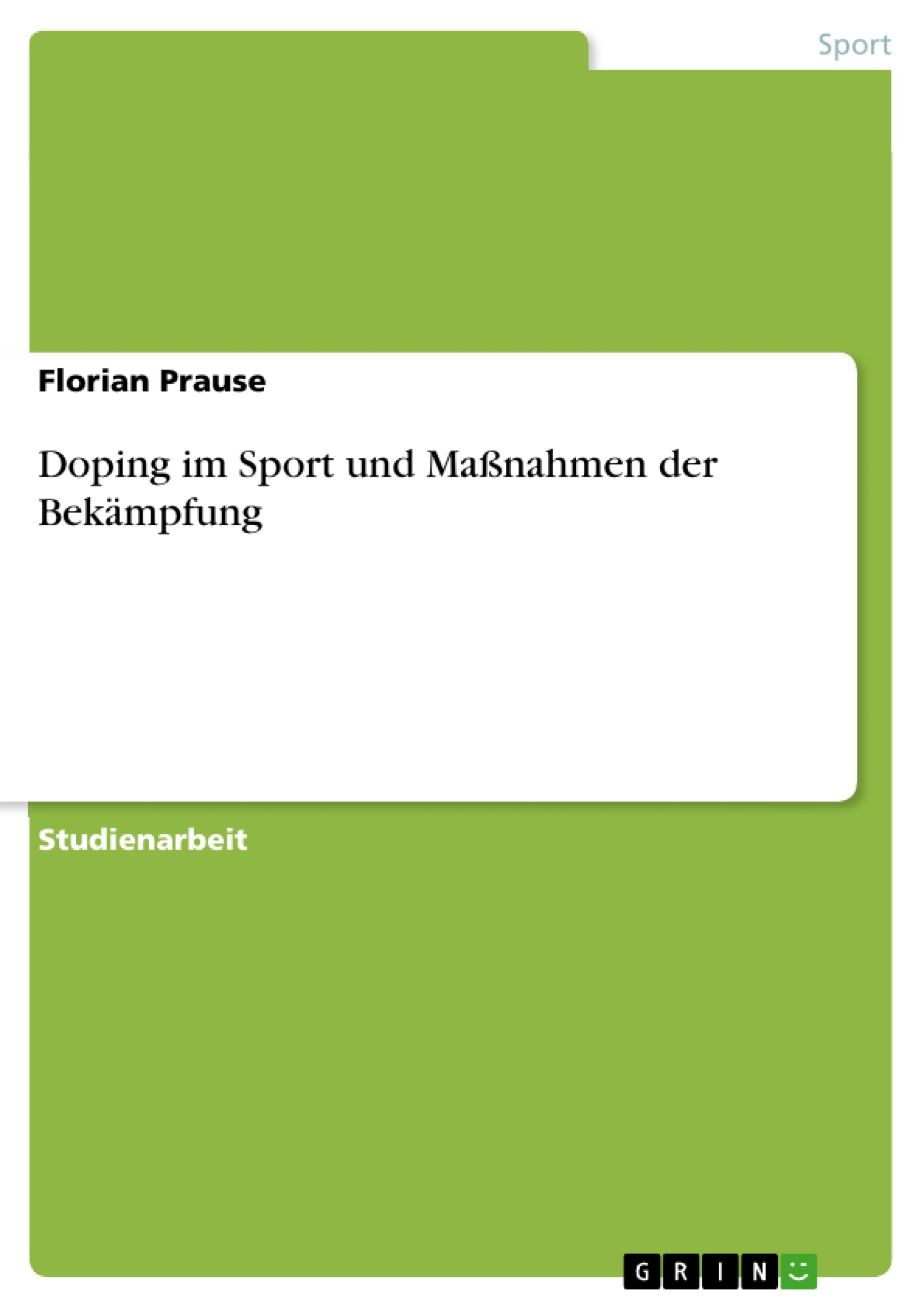In der heutigen Gesellschaft, vor allem im Hochleistungssport, zählt hauptsächlich nur noch die Leistung jedes Einzelnen. Man wird an dem gemessen, was man erreicht beziehungsweise nicht erreicht hat und steht demzufolge unter einer besonderen Art des Leistungsdrucks. Es geht insbesondere darum, alle anderen Mitstreiter aus seiner Branche hinter sich zu lassen und als alleiniger Gewinner oder als Bester seines Faches zu glänzen. Alles andere als der Erste oder der Sieger zählt hierbei nicht mehr. Der Zweitbeste wird nicht als derjenige angesehen, der fast genauso gut war wie der Erste, sondern er wird als der erste Verlierer betrachtet oder gar mit Häme oder Spott belohnt.
Ein sehr gut zu veranschaulichendes Beispiel ist der Leistungssport. Hinter jedem Sportler oder jeder Mannschaft stehen ein Trainerteam, ein Verein, ein Verband und vor allem die Sponsoren. Und all diese Personen oder Instanzen haben eine besondere Erwartung, die sie an den Sportler oder die Mannschaft stellen. Sie wollen die investierten Mittel bestmöglich umgesetzt sehen. Das Trainerteam und der Verein investieren viel Zeit und Anstrengung in den Sportler und verzichten zu großen Teilen auf ihr Privat- und Familienleben. Zudem steht auch noch der organisatorische Aufwand drum herum, den es zu bewältigen gibt. Der Verband und insbesondere die Sponsoren investieren finanzielle Mittel in die Sportler, um sie zu fördern und um sie weiter nach oben zu bringen. Zudem investieren die Sponsoren auch ihren Namen in die Sportler, da sie diesen meist durch Trikot- oder Bandenwerbung unterstützen. Und bestmöglich umgesetzt sind diese Investitionen nur durch Siege der Sportler. Kein Sponsor oder Verband sieht seinen Sportler oder seine Mannschaft gerne auf dem zweiten Platz. Dies könnte gleichzeitig damit assoziiert werden, dass das Produkt oder die Dienstleistung des Sponsors nur das oder die Zweitbeste ist. So besteht dann das Problem, dass sich Sponsoren anderen und erfolgreicheren Sportlern zuwenden, bei denen sie sich besser repräsentiert sehen. In manchen Sportarten ist es auch üblich, dass sich Trainer andere Athleten suchen, mit denen sie sich mehr Erfolg versprechen. Denn auch sie sind erfolgsorientiert und haben einen Ruf zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Fragestellung
- Zielsetzung
- Theoretische Analysen
- Der Versuch einer Dopingdefinition
- Die Dopingliste - verbotene Substanzen und Methoden
- Beschreibung verbotener Substanzen
- Beschreibung verbotener Methoden
- Die Dopingbekämpfung
- Die Dopingkontrollen
- Weitere Möglichkeiten der Dopingbekämpfung
- Die Dopingfreigabe
- Zusammenfassung
- Beantwortung der Fragestellung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die verschiedenen Arten und Weisen aufzuzeigen, wie sich Sportler einen unerlaubten Leistungsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschaffen. Dabei soll näher auf den Begriff „Doping“ selbst eingegangen werden, um das angewandte abweichende Verhalten der Sportler thematisch korrekt einzordnen zu können und definitorische Unklarheiten zu vermeiden. Die Arbeit wird auch im Detail klären, was genau zum abweichenden Verhalten gezählt wird und auf welcher Grundlage dieses Anwendung findet. In Bezug auf dieses Verhaltensmuster sollen dann Wege und Strategien vorgestellt werden, die das Dopingproblem eindämmen und im besten Fall lösen können. Dazu soll sowohl ein bekanntes Kontrollsystem vorgestellt als auch weitere Möglichkeiten aufgezeigt werden, die sich bei der Dopingbekämpfung als nützlich erweisen können.
- Definition und Einordnung des Begriffs „Doping“
- Analyse der Ursachen und Motive für Doping im Sport
- Beschreibung der verschiedenen Dopingmethoden und -substanzen
- Vorstellung des bestehenden Kontrollsystems und weiterer Möglichkeiten der Dopingbekämpfung
- Bewertung der ethischen und gesellschaftlichen Implikationen von Doping
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt beleuchtet die Problematik des Dopings im Kontext des modernen Leistungssports. Er zeigt auf, wie der Leistungsdruck und die Erfolgsorientierung im Sport dazu führen können, dass Sportler zu unerlaubten Mitteln greifen, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.
Im zweiten Kapitel wird die Fragestellung der Arbeit präzisiert: „Auf welche Weise dopen sich Sportler und welche Maßnahmen zur Bekämpfung gibt es?“. Diese Fragestellung soll den Rahmen für die weitere Analyse des Dopingphänomens setzen.
Der dritte Abschnitt erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Es geht darum, die verschiedenen Arten und Weisen des Dopings aufzuzeigen, die Ursachen und Motive zu analysieren und Strategien zur Dopingbekämpfung zu präsentieren.
Das vierte Kapitel befasst sich mit theoretischen Analysen zum Thema Doping. Es enthält eine Definition des Begriffs, eine Übersicht über verbotene Substanzen und Methoden sowie eine Darstellung der Dopingbekämpfung.
Schlüsselwörter
Doping, Leistungssport, Erfolgsdruck, verbotene Substanzen, verbotene Methoden, Dopingbekämpfung, Kontrollsystem, ethische Aspekte, gesellschaftliche Implikationen, Fair Play.
Häufig gestellte Fragen
Warum greifen Sportler zu Dopingmitteln?
Hauptursachen sind der enorme Leistungsdruck, die Erfolgsorientierung der Gesellschaft sowie die Erwartungshaltungen von Sponsoren, Verbänden und Trainern.
Wie wird "Doping" in der Arbeit definiert?
Die Arbeit versucht eine Definition, die Doping als abweichendes Verhalten zur Erlangung unerlaubter Leistungsvorteile im Wettbewerb einordnet.
Welche Arten von Doping werden unterschieden?
Es wird zwischen verbotenen Substanzen (z. B. Anabolika) und verbotenen Methoden (z. B. Blutdoping) unterschieden, wie sie auf der offiziellen Dopingliste stehen.
Welche Maßnahmen gibt es zur Dopingbekämpfung?
Neben dem klassischen Kontrollsystem werden weitere Strategien zur Eindämmung des Problems sowie die kontrovers diskutierte Dopingfreigabe thematisiert.
Welche Rolle spielen Sponsoren beim Dopingproblem?
Sponsoren investieren finanzielle Mittel und ihren Namen. Da sie nur mit Siegern assoziiert werden wollen, erhöht dies den Druck auf Athleten, um jeden Preis zu gewinnen.
Was sind die ethischen Folgen von Doping?
Doping untergräbt das Prinzip des Fair Play und schadet der Integrität des Sports sowie der Gesundheit der Athleten.
- Arbeit zitieren
- Florian Prause (Autor:in), 2010, Doping im Sport und Maßnahmen der Bekämpfung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170821