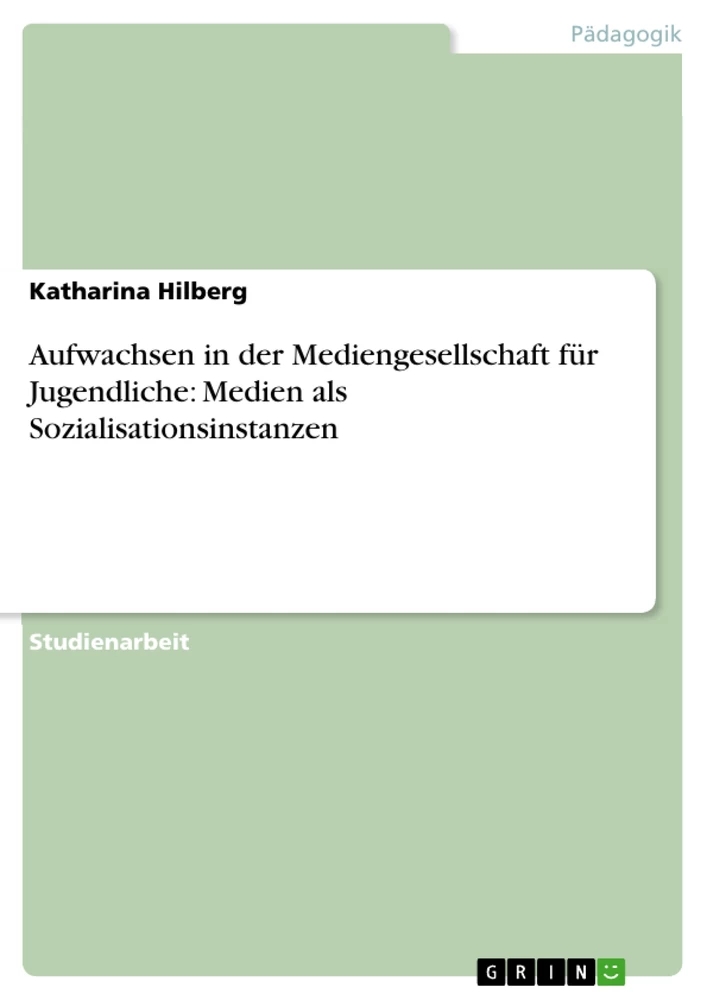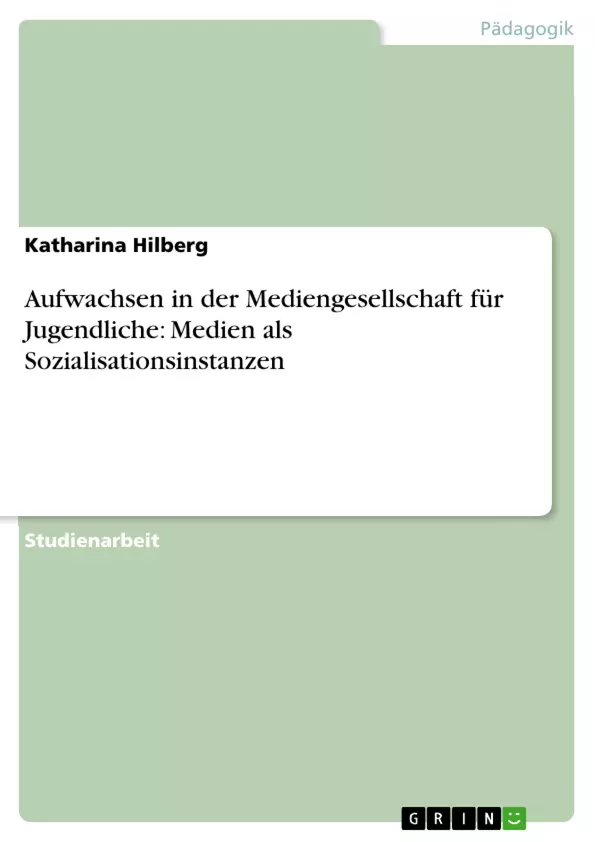Die neuen Medien haben sich nicht nur die letzten Jahrzehnte enorm ausgedehnt, sondern sind inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jugendliche wachsen in der heutigen Zeit in einer medienprägten Umwelt auf, mit der sie sich auseinandersetzen und die komplexen Anforderungen bewältigen müssen. Daher kann man nicht nur von einer Wissens- und Mediengesellschaft, sondern auch von einer Medien-Jugend sprechen. Die meisten Jugendlichen besitzen heute zahlreiche und vielfältige Medien, „mit denen sie flexibel, virtuos und souverän umzugehen verstehen“ und die selbstverständlich zu ihrem Lebensalltag gehören. Dabei nutzen sie die Medien zu Freizeit- und Bildungszwecken. Nicht nur dadurch, dass die Medien allgegenwärtig sind, sondern auch durch die stetige Weiterent¬wicklung der Kommunikations¬- und Informationstechnologien, kommt den Medien in unserem Alltag eine wachsende Bedeutung zu. Folglich haben sie einen gravierenden Einfluss auf unsere Meinungen, Verhaltensweisen und unseren Alltag, gerade von Kindern und Jugendlichen. Es steht fest, dass Jugendliche nicht nur sehr neugierig, sondern auch sehr experimentierfreudig sind und daher schon früh Erfahrungen mit Medien sammeln. Medien wie das Internet üben eine große Faszination auf Jugendliche aus. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Jugendliche Zugang zu einem Computer mit Inter-netanschluss zu haben. Je einfacher ein Computer mit Inter¬net für Jugendliche zugänglich ist, desto eher gewöhnen sie sich die daran, dass die Inhalte jederzeit verfügbar sind. Hierzu zäh-len auch Inhalte, die nicht für ihr Alter geeignet sind. In der Medienforschung wird das The-ma Mediensozialisation kritisch diskutiert, gerade inwie¬weit Medieninhalte die Betrachter (ihre Verhaltensweisen und ihr Denken) beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition
- Medien
- Sozialisation
- Jugendphase
- Mediensozialisation in der Jugendphase
- Bedeutung der Medien in der Jugendphase am Beispiel der JIM-Studie 2010
- Das Internet
- Funktion und Wirkung von Medien: Gefahren und Chancen
- Medienerziehung und Medienkompetenz
- Medienkunde
- Mediennutzung
- Mediengestaltung
- Medienkritik
- Jugendmedienschutz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema „Aufwachsen in der Mediengesellschaft für Jugendliche: Medien als Sozialisationsinstanzen“. Sie untersucht die Bedeutung von Medien, insbesondere des Internets, im Sozialisationsprozess von Jugendlichen und analysiert, inwieweit Medien die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen.
- Begriffsdefinition von „Medien“, „Sozialisation“ und „Jugendphase“
- Mediensozialisation in der Jugendphase, insbesondere die Rolle des Internets
- Bedeutung von Medienkompetenz und Medienerziehung in der heutigen Mediengesellschaft
- Funktion und Wirkung von Medien: Chancen und Gefahren
- Rolle und Aufgabe des Jugendmedienschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Mediensozialisation in der heutigen Zeit. Sie stellt die Forschungsfrage und die Gliederung der Hausarbeit dar.
- Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Medien“, „Sozialisation“ und „Jugendphase“. Es wird die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Hausarbeit erläutert.
- Mediensozialisation in der Jugendphase: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Medien im Sozialisationsprozess von Jugendlichen. Es wird die Bedeutung der Medien in der Jugendphase anhand der JIM-Studie 2010 veranschaulicht und die Funktionsweise des Internets im Kontext der Mediensozialisation erläutert.
- Medienerziehung und Medienkompetenz: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Medienerziehung und Medienkompetenz in der heutigen Gesellschaft für Jugendliche hervorgehoben. Es werden die Begriffe Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und Medienkritik definiert.
- Jugendmedienschutz: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Jugendmedienschutz auseinander. Es behandelt das Jugendschutzgesetz, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und relevante Organisationen.
Schlüsselwörter
Mediensozialisation, Jugendphase, Internet, Medienkompetenz, Medienerziehung, Jugendmedienschutz, JIM-Studie, Sozialisationsinstanzen, Informationsgesellschaft, Persönlichkeitsentwicklung, digitale Medien, Kommunikationstechnologien, gesellschaftliche Werte, Verhaltensweisen, Meinungsbildung, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Mediensozialisation?
Mediensozialisation beschreibt den Prozess, in dem Medien als Instanzen die Entwicklung der Persönlichkeit, Meinungsbildung und Verhaltensweisen von Individuen beeinflussen.
Welche Rolle spielt das Internet für Jugendliche laut JIM-Studie?
Das Internet ist ein zentraler Bestandteil des Alltags, der sowohl für Freizeitzwecke als auch zur Bildung genutzt wird, aber auch Gefahren wie ungeeignete Inhalte birgt.
Was sind die vier Säulen der Medienkompetenz?
Dazu gehören Medienkunde (Wissen über Systeme), Mediennutzung (Anwendung), Mediengestaltung (kreative Produktion) und Medienkritik (analytische Bewertung).
Wie schützt der Jugendmedienschutz Kinder und Jugendliche?
Durch Gesetze wie das Jugendschutzgesetz und den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag werden Altersgrenzen festgelegt und der Zugang zu entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten reguliert.
Welche Gefahren gehen von einer ständigen Medienverfügbarkeit aus?
Kritisch diskutiert werden die Beeinflussung des Denkens, die Konfrontation mit Gewalt oder Pornografie sowie potenzielle Auswirkungen auf die soziale Interaktion.
- Quote paper
- Katharina Hilberg (Author), 2011, Aufwachsen in der Mediengesellschaft für Jugendliche: Medien als Sozialisationsinstanzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170894