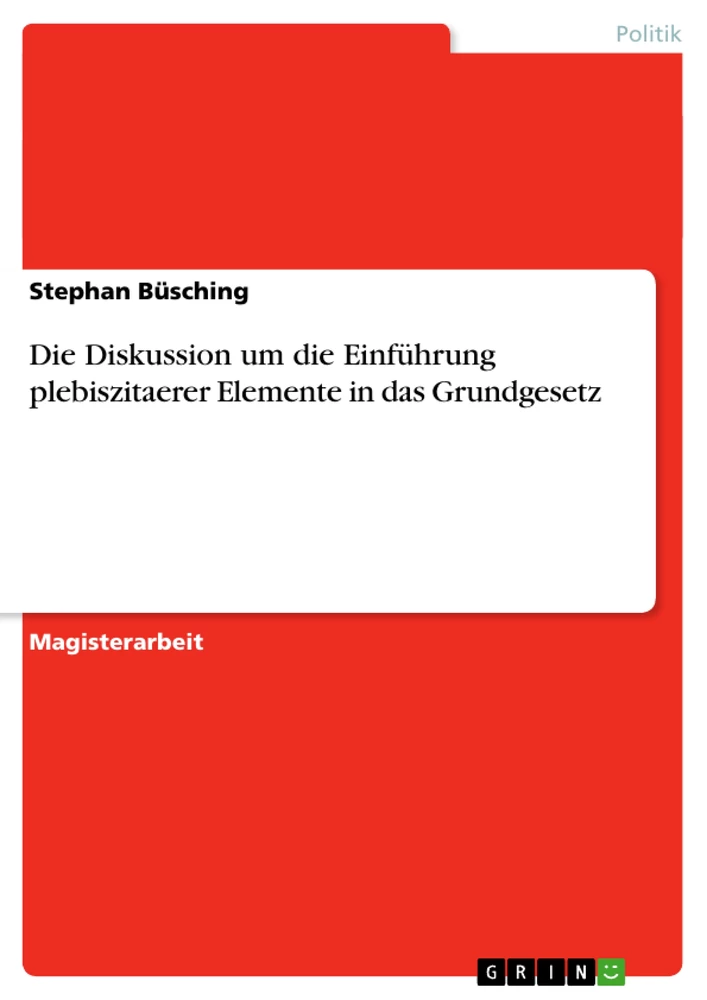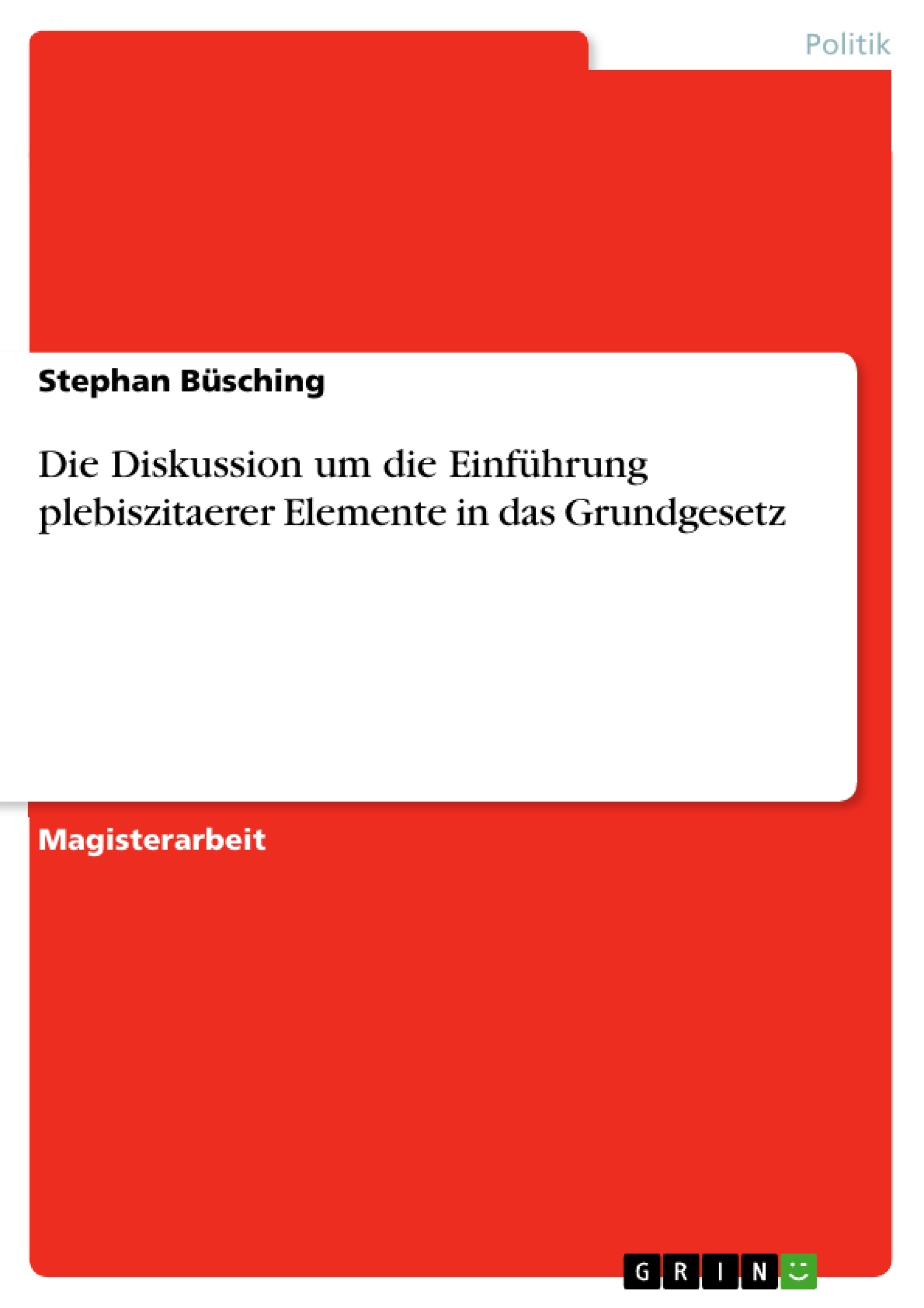Warum sind in der deutschen Verfassung so gut wie keine direktdemokratischen Institutionen verankert? Mit welchen Argumenten traten Gegner und Befürworter direktdemokratischer Verfahren auf und wurde intern anders argumentiert als öffentlich? Mit diesen Fragen befasst sich diese Arbeit. Im letzten Teil der Arbei wird in einer ausgewogenen diskursiven Weise versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, welchen Beitrag direktdemokratische Verahren zur Lösung der aktuellen Probleme unserer Parteiendemokratie bieten können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Aktualität des Themas
- 1.2. Der Blick nach außen
- 1.3. Aufbau der Untersuchung
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1. Plebiszit
- 2.2. Volksinitiative
- 2.3. Volksbegehren
- 2.4. Volksentscheid und Referendum
- 2.5. Recall
- 2.6. Volksbefragung
- 3. Der Neuaufbau der Demokratie im Westen
- 3.1. Entwürfe einer gesamtdeutschen Verfassung
- 3.1.1. Die politischen Parteien
- 3.1.1.1. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der SPD
- 3.1.1.2. Plebiszitäre Elemente im verfassungspolitischen Konzept der CDU/CSU
- 3.1.2. Die Verfassungsdiskussion im Büro für Friedensfragen
- 3.1.3. Die Verfassungsdiskussion im Zonenbeirat
- 3.2. Das "Volksbegehren für die Einheit Deutschlands"
- 3.3. Die Wirkung der SED-Politik im Westen
- 3.3.1. Positionsänderungen bei der CDU/CSU
- 3.3.2. Positionsänderungen bei der SPD
- 3.3.3. DPD und LDP (Liberale)
- 3.3.4. Die Deutsche Partei
- 3.3.5. Die Ministerpräsidenten und das Gründungsplebiszit
- 3.4. Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee
- 3.4.1. Gründungsplebiszit
- 3.4.2. Referendum
- 3.4.3. Volksgesetzgebung
- 3.4.4. Direktwahl des Staatsoberhauptes
- 3.5. Die Diskussionen im Parlamentarischen Rat
- 3.5.1. Gründungsplebiszit
- 3.5.2. Referendum
- 3.5.3. Volksgesetzgebung
- 3.5.4 Territorialplebiszite
- 3.6. Die Ratifizierung des Grundgesetzes durch die Landtage
- 3.7. Ergebnisse
- 4. Reformansätze für eine plebiszitäre Öffnung des Grundgesetzes bis zur Wiedervereinigung
- 4.1. Die fünfziger Jahre - Stillstand
- 4.2. Die sechziger Jahre Bewegung
- 4.3. 1971 - Enquete-Kommission Verfassungsreform
- 4.3.1. Stärkung der politischen Mitwirkungsrechte der Bürger
- 4.3.1.1. Direktwahl des Bundespräsidenten
- 4.3.2. Das politische Ergebnis der Kommission
- 4.3.2. Exkurs: Weimarer Erfahrungen
- 4.4. Die achtziger Jahre
- 5. Die Verfassungsdiskussion im Zuge der Wiedervereinigung
- 5.1. Zwei Wege zur deutschen Einheit
- 5.2. Der Einigungsvertrag
- 5.3. Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder
- 5.4. Kommission Verfassungsreform
- 5.5. Die Gemeinsame Verfassungskommission
- 5.5.1. Gremienstruktur der GVK
- 5.5.2. Themenkatalog der Gemeinsamen Verfassungskommission
- 5.5.3. Entscheidungsprozess der Gemeinsamen Verfassungskommission
- 5.5.3.1. Position der SPD
- 5.5.3.2. Positionen der CDU/CSU
- 5.5.3.3. Bündnis 90/Die Grünen
- 5.5.3.4. FDP und PDS/LL
- 5.5.4. Die 6. Sitzung der GVK
- 5.5.5. Die Sachverständigenanhörung
- 5.5.5.1. Die Fragerunde
- 5.5.6. Die 17. Sitzung der GVK
- 5.5.7. Bewertung der Diskussion
- 6. Versuch einer Systematisierung und Analyse der Debatte
- 6.1. Kritik an der bisherigen Debatte
- 6.1.1. Exkurs: Die Kompatibilität direktdemokratischer Institution zum politischen System der Bundesrepublik
- 6.1.1.1. Idealtypische Bestandteile politischer Systeme
- 6.1.1.2. Beschreibung des politischen Systems der Bundesrepublik
- 6.1.1.3. Verträglichkeit bestimmter plebiszitärer Elemente mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland
- 7. Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik
- 7.1. Trend zur Parteienoligarchie
- 7.2. Bevormundung des Bürgers
- 7.3. Gemeinwohlorientierung
- 7.3.1. Egoismen statt Gemeininteresse?
- 7.3.2. Berufspolitiker
- 7.3.3. Partikularinteressen
- 7.3.4. Selbstblockade des Systems
- 8. Mehr direkte Demokratie - ein Weg aus der Krise?
- 9. Exkurs: Umfragen - ein plebiszitäres Element?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geringe Verankerung plebiszitärer Elemente im deutschen Grundgesetz und argumentiert für deren stärkere Einbindung. Sie analysiert die historischen und politischen Gründe für die derzeitige Situation und beleuchtet Reformansätze.
- Historische Entwicklung der Diskussion um plebiszitäre Elemente im Grundgesetz
- Analyse der verschiedenen Formen der direkten Demokratie
- Bewertung der Kompatibilität direktdemokratischer Instrumente mit dem politischen System Deutschlands
- Auswirkungen der Einführung plebiszitärer Elemente auf Staat und Gesellschaft
- Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Aktualität des Themas der direkten Demokratie in Deutschland heraus, beleuchtet die Unterschiede im internationalen Vergleich und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung der Diskussion um plebiszitäre Elemente im Grundgesetz, besonders im Kontext der Nachkriegszeit und der Wiedervereinigung. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz der Thematik angesichts der geringen Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen und der Frage nach einer stärkeren direkten Demokratie. 2. Begriffsdefinition: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der direkten Demokratie wie Plebiszit, Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbefragung. Es thematisiert die unterschiedliche Verwendung dieser Begriffe in verschiedenen Sprachen und wissenschaftlichen Kontexten und legt damit die Grundlage für eine präzise und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Thematik. 3. Der Neuaufbau der Demokratie im Westen: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg und die damit verbundene Diskussion um plebiszitäre Elemente. Es untersucht die Positionen der verschiedenen politischen Parteien, die Rolle der Alliierten und die Debatten im Parlamentarischen Rat. Der Schwerpunkt liegt auf den historischen und politischen Gründen für die geringe Berücksichtigung direktdemokratischer Elemente im Grundgesetz. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze und die Kompromisse, die letztendlich zur Verabschiedung des Grundgesetzes führten. 4. Reformansätze für eine plebiszitäre Öffnung des Grundgesetzes bis zur Wiedervereinigung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen der Debatte um eine Reform des Grundgesetzes in Richtung mehr direkte Demokratie von den 1950er Jahren bis zur Wiedervereinigung. Es beschreibt den Stillstand der 1950er, die Bewegung der 1960er, und die Arbeit der Enquete-Kommission Verfassungsreform von 1971. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ansätzen und Argumenten, die sowohl für als auch gegen eine stärkere direkte Demokratie vorgebracht wurden. Der Abschnitt umreißt die politische Landschaft und die Herausforderungen bei der Durchsetzung von Reformen. 5. Die Verfassungsdiskussion im Zuge der Wiedervereinigung: Dieses Kapitel befasst sich mit der intensivierten Diskussion um plebiszitäre Elemente im Kontext der deutschen Wiedervereinigung. Es analysiert die Rolle der Gemeinsamen Verfassungskommission (GVK), die unterschiedlichen Positionen der Parteien und die Schwierigkeiten bei der Einigung auf konkrete Reformvorschläge. Es zeigt die komplexen politischen Verhandlungsprozesse auf und die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteure auf die Frage nach einer Stärkung der direkten Demokratie. 6. Versuch einer Systematisierung und Analyse der Debatte: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Debatte um plebiszitäre Elemente im Grundgesetz. Es analysiert die Vor- und Nachteile verschiedener direktdemokratischer Instrumente und deren Kompatibilität mit dem politischen System Deutschlands. Die Analyse legt den Fokus auf die Stärken und Schwächen der bisherigen Argumente und stellt den Zusammenhang zwischen direkter Demokratie und dem politischen System der Bundesrepublik in den Mittelpunkt. 7. Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik: Dieses Kapitel argumentiert für eine Reform des politischen Systems Deutschlands. Es thematisiert die Entwicklung einer Parteienoligarchie, die Bevormundung der Bürger durch politische Eliten und den Mangel an Gemeinwohlorientierung. Die Kapitel legt dar, dass direkte Demokratie ein Weg sein könnte, diesen Mängeln entgegenzuwirken, und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. 8. Mehr direkte Demokratie - ein Weg aus der Krise? Dieses Kapitel stellt die Frage, ob mehr direkte Demokratie ein Lösungsansatz für die im vorherigen Kapitel beschriebenen Probleme des politischen Systems Deutschlands darstellt. Es wägt die Vor- und Nachteile ab und diskutiert die möglichen Folgen einer stärkeren Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen.
Schlüsselwörter
Grundgesetz, Plebiszit, Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid, Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Verfassungsreform, Wiedervereinigung, Parteienoligarchie, Gemeinwohl, Bürgerbeteiligung, Politisches System, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Plebiszitäre Elemente im deutschen Grundgesetz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die geringe Verankerung plebiszitärer Elemente im deutschen Grundgesetz und argumentiert für deren stärkere Einbindung. Sie analysiert die historischen und politischen Gründe für die derzeitige Situation und beleuchtet Reformansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Diskussion um plebiszitäre Elemente im Grundgesetz, insbesondere im Kontext der Nachkriegszeit und der Wiedervereinigung. Sie analysiert verschiedene Formen der direkten Demokratie (Plebiszit, Referendum, Volksinitiative etc.), bewertet deren Kompatibilität mit dem deutschen politischen System und untersucht die Auswirkungen einer stärkeren direkten Demokratie auf Staat und Gesellschaft. Die Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland wird ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition, Der Neuaufbau der Demokratie im Westen, Reformansätze für eine plebiszitäre Öffnung des Grundgesetzes bis zur Wiedervereinigung, Die Verfassungsdiskussion im Zuge der Wiedervereinigung, Versuch einer Systematisierung und Analyse der Debatte, Reformbedürftigkeit des politischen Systems der Bundesrepublik, Mehr direkte Demokratie - ein Weg aus der Krise?, und ein Exkurs zu Umfragen als plebiszitärer Element.
Wie werden die verschiedenen Formen der direkten Demokratie definiert?
Kapitel 2 widmet sich der präzisen Definition zentraler Begriffe wie Plebiszit, Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbefragung, wobei die unterschiedliche Verwendung in verschiedenen Kontexten berücksichtigt wird.
Welche Rolle spielte die Nachkriegszeit und die Wiedervereinigung in der Diskussion um plebiszitäre Elemente?
Die Kapitel 3 und 5 untersuchen die Entstehung des Grundgesetzes und die damit verbundenen Debatten um plebiszitäre Elemente. Sie analysieren die Positionen verschiedener Parteien, die Rolle der Alliierten und die Diskussionen im Parlamentarischen Rat und in der Gemeinsamen Verfassungskommission im Kontext der Wiedervereinigung.
Welche Reformansätze werden diskutiert?
Kapitel 4 und 7 beleuchten Reformansätze für eine stärkere Einbindung plebiszitärer Elemente im Grundgesetz, von den 1950er Jahren bis zur Wiedervereinigung und darüber hinaus. Sie analysieren die verschiedenen Ansätze, Argumente und Herausforderungen bei der Durchsetzung von Reformen.
Wie wird die Kompatibilität direktdemokratischer Instrumente mit dem politischen System Deutschlands bewertet?
Kapitel 6 analysiert die Kompatibilität direktdemokratischer Instrumente mit dem politischen System Deutschlands kritisch. Es untersucht die Vor- und Nachteile verschiedener Instrumente und deren Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft.
Welche Kritikpunkte am politischen System werden genannt?
Kapitel 7 kritisiert die Entwicklung einer Parteienoligarchie, die Bevormundung der Bürger und den Mangel an Gemeinwohlorientierung im politischen System Deutschlands.
Wird die Frage nach einem Lösungsansatz durch mehr direkte Demokratie beantwortet?
Kapitel 8 diskutiert, ob mehr direkte Demokratie ein Lösungsansatz für die im vorherigen Kapitel beschriebenen Probleme des politischen Systems sein kann, und wägt die Vor- und Nachteile ab.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundgesetz, Plebiszit, Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid, Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Verfassungsreform, Wiedervereinigung, Parteienoligarchie, Gemeinwohl, Bürgerbeteiligung, Politisches System, Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Stephan Büsching (Autor:in), 2003, Die Diskussion um die Einführung plebiszitaerer Elemente in das Grundgesetz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17091