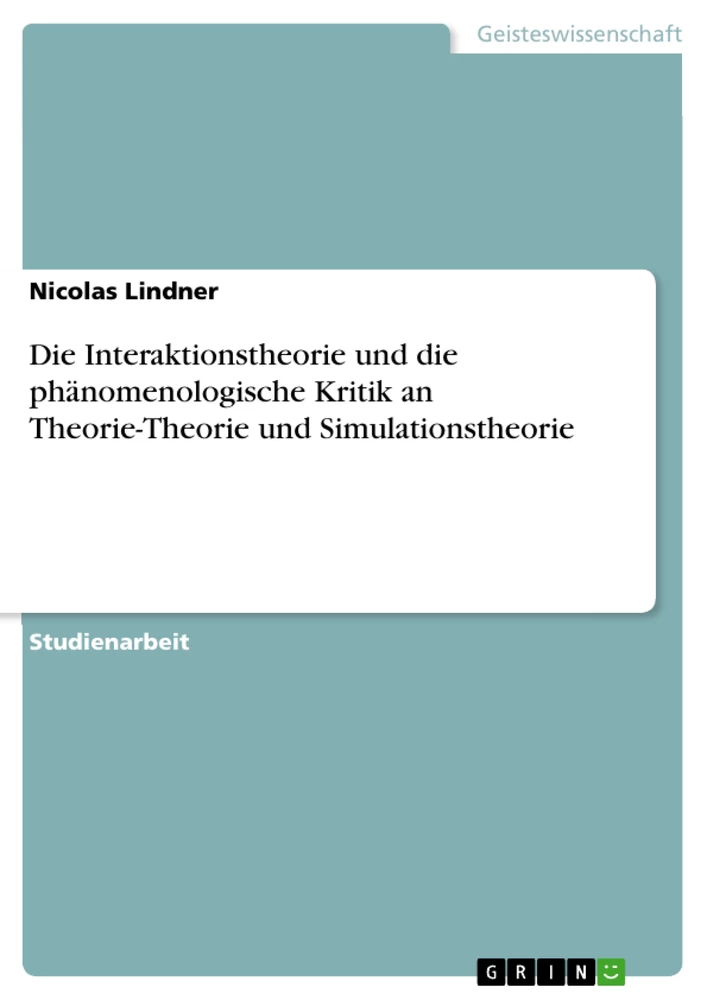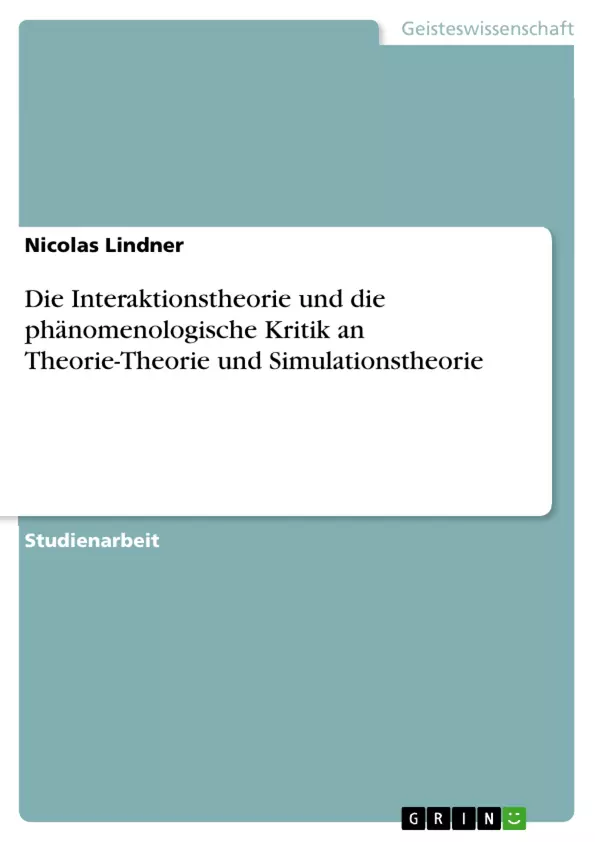Wie verstehen wir andere? Auf welchem Wege erlangen wir Kenntnis von deren Gefühlen, Wünschen und Absichten? Um dies zu erklären, wird in der philosophischen Diskussion häufig auf den Begriff der theory of mind zurückgegriffen. Dieser Begriff wird verwandt, um auf unsere Fähigkeit zu verweisen, anderen mentale Zustände zuzuschreiben und diese zu verstehen. In der zeitgenössischen Debatte herrschen zwei Ansätze vor, welche diese Fähigkeit auf unterschiedliche Arten erklären: die Theorie-Theorie (TT) sowie die Simulationstheorie (ST).
Beide Ansätze werden aus Sicht der Phänomenologie jedoch scharf kritisiert. Aus phänomenologischer Perspektive sind bereits die grundlegenden Annahmen dieser beiden Ansätze abzulehnen. Als Alternative zu TT und ST stellt GALLAGHER daher einen eigenen Vorschlag zur Diskussion: die Interaktionstheorie (IT).
Zunächst werde ich im Folgenden die Ansätze von TT und ST kurz vorstellen. Anschließend daran werde ich erläutern, an welchen Punkten diese Theorien aus phänomenologischer Perspektive zu kritisieren sind. Im darauf folgenden Teil der Arbeit werde ich die IT von Gallagher ausführlich darstellen. Anhand der wesentlichen Elemente dieses Ansatzes werde ich den Erklärungsgehalt und die Schlüssigkeit der IT kritisch hinterfragen. Als Resultat dieser Untersuchung möchte ich feststellen, ob die IT eine ernstzunehmende, umfassende Alternative zu TT und ST bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie-Theorie, Simulationstheorie und deren Kritik aus phänomenologischer Perspektive
- 2.1. Theorie-Theorie und Simulationstheorie
- 2.2. Phänomenologische Kritik an TT und ST
- 3. Interaktionstheorie
- 3.1. Direkte Wahrnehmung
- 3.2. Primäre und sekundäre Intersubjektivität
- 3.3. Die Narrative Practice Hypothesis (NPH)
- 4. Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht verschiedene Theorien des mentalen Verstehens – die Theorie-Theorie (TT) und die Simulationstheorie (ST) – und ihre Kritik aus phänomenologischer Perspektive. Ziel ist es, die Interaktionstheorie (IT) als Alternative zu bewerten und deren Erklärungsgehalt zu prüfen. Die Arbeit fragt nach der Schlüssigkeit der IT als umfassende Alternative zu TT und ST.
- Theorie-Theorie und Simulationstheorie des mentalen Verstehens
- Phänomenologische Kritik an der Theorie-Theorie und Simulationstheorie
- Darstellung und kritische Auseinandersetzung mit der Interaktionstheorie
- Bewertung des Erklärungsgehalts der Interaktionstheorie
- Analyse der Schlüssigkeit der Interaktionstheorie als Alternative
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des mentalen Verstehens ein und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Sie skizziert die beiden dominierenden Ansätze – Theorie-Theorie (TT) und Simulationstheorie (ST) – und kündigt die phänomenologische Kritik sowie die alternative Interaktionstheorie (IT) an. Der Fokus liegt auf der Klärung der Forschungsfrage, ob die IT eine ernstzunehmende Alternative zu TT und ST darstellt. Die Einleitung strukturiert die Argumentation der gesamten Arbeit und hebt die methodische Vorgehensweise hervor.
2. Theorie-Theorie, Simulationstheorie und deren Kritik aus phänomenologischer Perspektive: Dieses Kapitel präsentiert zunächst die Theorie-Theorie und die Simulationstheorie. Es erläutert die Kernannahmen beider Ansätze, wie das Verständnis anderer durch den Rückgriff auf eine implizite Theorie (TT) oder durch die Simulation mentaler Zustände (ST) erklärt wird. Im Anschluss wird die umfassende phänomenologische Kritik an beiden Theorien detailliert dargestellt. Die Kritik konzentriert sich auf die Frage der Bewusstheit der zugrundeliegenden Prozesse und die Unvereinbarkeit mit alltäglichen Erfahrungen des mentalen Verstehens. Es werden die Argumente der Phänomenologie gegen die impliziten Prozesse der TT und ST diskutiert, unter Einbezug von Forschungsergebnissen aus der Entwicklungspsychologie und der Neurowissenschaften (Spiegelneuronen).
Schlüsselwörter
Theorie-Theorie, Simulationstheorie, Interaktionstheorie, Phänomenologie, Mentales Verstehen, Intersubjektivität, Direkte Wahrnehmung, Narrative Practice Hypothesis, Kognitionswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Theorie-Theorie, Simulationstheorie und Interaktionstheorie des mentalen Verstehens
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Theorien des mentalen Verstehens, insbesondere die Theorie-Theorie (TT) und die Simulationstheorie (ST), und deren Kritik aus phänomenologischer Perspektive. Im Mittelpunkt steht die Bewertung der Interaktionstheorie (IT) als mögliche Alternative zu TT und ST.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorie-Theorie (TT), die Simulationstheorie (ST) und die Interaktionstheorie (IT). Es werden die Kernannahmen jeder Theorie erläutert und kritisch hinterfragt.
Welche Kritik wird an der Theorie-Theorie und Simulationstheorie geübt?
Die Hausarbeit präsentiert eine phänomenologische Kritik an der TT und ST. Diese Kritik konzentriert sich auf die Frage der Bewusstheit der zugrundeliegenden Prozesse und die Unvereinbarkeit mit alltäglichen Erfahrungen des mentalen Verstehens. Forschungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie und den Neurowissenschaften (Spiegelneuronen) werden miteinbezogen.
Was ist die Interaktionstheorie und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Interaktionstheorie (IT) wird als Alternative zu TT und ST vorgestellt und auf ihren Erklärungsgehalt hin geprüft. Die Arbeit analysiert die Schlüssigkeit der IT als umfassende Alternative zu den beiden anderen Theorien.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Theorie-Theorie, Simulationstheorie und deren phänomenologischer Kritik (inkl. Unterkapiteln zu den Theorien selbst und der Kritik), einem Kapitel zur Interaktionstheorie (mit Unterkapiteln zu direkter Wahrnehmung, primärer und sekundärer Intersubjektivität sowie der Narrative Practice Hypothesis) und einem Fazit/Ausblick.
Welche zentralen Fragen werden in der Hausarbeit untersucht?
Die zentrale Frage lautet, ob die Interaktionstheorie eine ernstzunehmende Alternative zur Theorie-Theorie und Simulationstheorie darstellt. Weiterhin wird untersucht, wie plausibel die Erklärungskraft der Interaktionstheorie ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Theorie-Theorie, Simulationstheorie, Interaktionstheorie, Phänomenologie, Mentales Verstehen, Intersubjektivität, Direkte Wahrnehmung, Narrative Practice Hypothesis, Kognitionswissenschaft.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien des mentalen Verstehens, unter Einbezug phänomenologischer Argumente und relevanter Forschungsergebnisse aus verwandten Disziplinen.
- Quote paper
- B.A. Nicolas Lindner (Author), 2011, Die Interaktionstheorie und die phänomenologische Kritik an Theorie-Theorie und Simulationstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170944