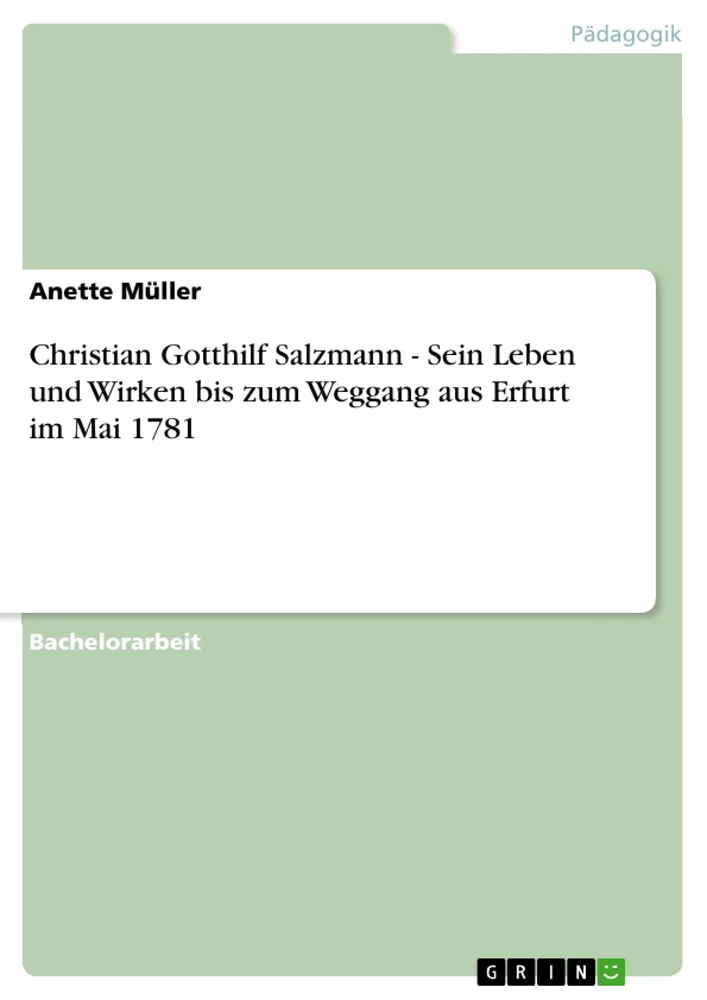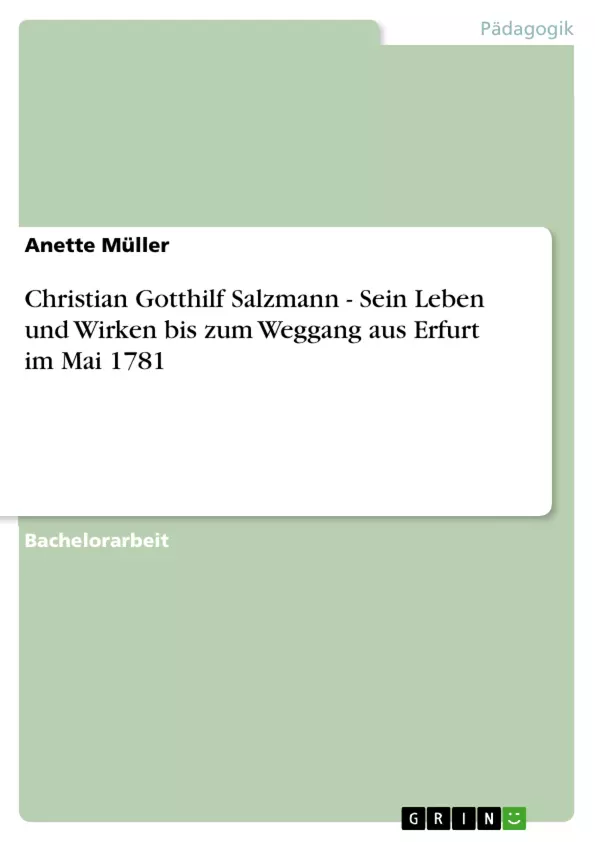Diese Arbeit befasst sich mit der Person Christian Gotthilf Salzmann. Insbesondere soll dabei die Zeit vor 1781 betrachtet werden, in der Salzmann vorwiegend in Erfurt tätig war. Nach seiner Kindheit in Sömmerda, kam die Familie Salzmann 1759 nach Erfurt. Ihr Sohn Christian Gotthilf verließ Erfurt, um in Jena Theologie zu studieren und noch einmal für vier Jahre, in denen er eine Anstellung in Rohrborn, einem kleinen Dorf bei Erfurt hatte. Danach lebte und wirkte er neun Jahre in Erfurt. Einige Biographen sparen diese Zeit in Salzmanns Leben bewusst aus, in Ermangelung an Quellen. Somit gibt es auch keine komplette Biographie Salzmanns. Ich werde versuchen, ein möglichst vollständiges Bild von Salzmann darzustellen, indem ich die Fragmente unterschiedlicher Autoren nutze. Die Ausarbeitungen von Richard Bosse sind dabei am Umfangreichsten. Er war Ende des 19. Jahrhunderts Schulleiter in Schnepfenthal.
Ein gesondertes Kapitel wird dem Philanthropismus gewidmet werden. Diese Strömung der Aufklärung begünstigte und unterstützte Salzmann in seinen Überlegungen zur Erziehung und ließ ihn zu dem großen Erzieher werden, als den man ihn heute bezeichnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Christian Gotthilf Salzmann - Sein Leben und Wirken bis zum 1. Mai 1781
- Die Kinderstube
- Die Schulzeit
- Das Theologiestudium
- Die Rückkehr nach Erfurt
- Salzmann wieder in Erfurt
- Die Situation Erfurts 1772
- Salzmann der Prediger, Theologe und Seelsorger der Andreasgemeinde
- Salzmann der Pädagoge
- Salzmann der Vater
- Salzmann der Wissenschaftler
- Salzmann und die Kritiker
- Salzmann - Abschied von Erfurt
- Salzmann und der Philanthropismus
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit widmet sich der Person Christian Gotthilf Salzmanns, insbesondere seiner Zeit in Erfurt bis 1781. Die Arbeit untersucht Salzmanns Leben und Wirken, wobei die Fragmente verschiedener Autoren genutzt werden, um ein möglichst vollständiges Bild zu zeichnen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zeit vor 1781, in der Salzmann in Erfurt als Prediger, Theologe, Seelsorger, Pädagoge, Vater und Wissenschaftler tätig war.
- Salzmanns Kindheit und Jugend in Sömmerda und Erfurt
- Salzmanns theologisches Studium in Jena und seine Zeit als Pfarrer in Rohrborn
- Salzmanns Wirken als Prediger und Theologe in der Andreasgemeinde Erfurt
- Salzmanns pädagogische Arbeit und seine Rolle als Vater
- Der Einfluss des Philanthropismus auf Salzmanns Denken und Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert den Fokus auf Salzmanns Leben und Wirken bis 1781. Die Arbeit beleuchtet seine Zeit in Erfurt und die Herausforderung, ein umfassendes Bild von Salzmann zu erstellen, da einige Biographen diese Phase aufgrund von Quellenmangel aussparen.
Christian Gotthilf Salzmann – Sein Leben und Wirken bis zum 1. Mai 1781
Die Kinderstube
Dieses Kapitel beschreibt Salzmanns frühe Jahre in Sömmerda. Es erzählt von seiner Geburt, seiner Familie, seinen Eltern und seinen Großeltern. Es werden Einflüsse auf seine Kindheit und seine frühe Bildung beleuchtet, insbesondere die Rolle seiner Mutter bei der Vermittlung von Lesen und der Einfluss seiner Großmutter durch Märchen und Geschichten.
Die Schulzeit
Dieses Kapitel beleuchtet Salzmanns Schulzeit in Sömmerda und seinen Wechsel nach Erfurt. Es beschreibt die Bildungseinrichtungen, die er besuchte, und die Lehrer, die ihn prägten. Es werden auch seine ersten Berührungspunkte mit der lateinischen Sprache und die Bedeutung seiner Mutter für sein Lernverhalten geschildert.
Das Theologiestudium
Dieses Kapitel beschreibt Salzmanns Entscheidung, Theologie zu studieren, und die Herausforderungen, die damit verbunden waren. Es erzählt von seinem Weg nach Jena, dem Studienort seiner Wahl, und seinen frühen Erfahrungen im akademischen Umfeld.
Die Rückkehr nach Erfurt
Dieses Kapitel beschreibt Salzmanns Zeit in Rohrborn und seine Rückkehr nach Erfurt. Es beleuchtet die Gründe für seine Rückkehr und die Herausforderungen, die er in Erfurt bewältigen musste.
Salzmann und der Philanthropismus
Dieses Kapitel befasst sich mit der philosophischen Strömung des Philanthropismus und ihrem Einfluss auf Salzmanns Denken und Handeln. Es beleuchtet die Kernaussagen des Philanthropismus und zeigt, wie diese Strömung Salzmanns pädagogische Ansätze beeinflusst hat.
Schlüsselwörter
Christian Gotthilf Salzmann, Philanthropismus, Pädagogik, Theologie, Erfurt, Sömmerda, Jena, Rohrborn, Andreasgemeinde, Kindheit, Bildung, Familie, Lebensgeschichte, Prediger, Seelsorger, Wissenschaftler.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Christian Gotthilf Salzmann?
Er war ein bedeutender deutscher Pädagoge und evangelischer Pfarrer der Aufklärungszeit, bekannt als Mitbegründer des Philanthropismus.
Welche Rolle spielte Erfurt in Salzmanns Leben?
Salzmann wirkte dort neun Jahre lang als Prediger und Seelsorger der Andreasgemeinde, bevor er 1781 nach Schnepfenthal ging.
Was ist Philanthropismus?
Eine pädagogische Strömung der Aufklärung, die auf "Menschenfreundlichkeit" basiert und die Erziehung zu Vernunft und praktischer Lebensführung betont.
Wie verlief Salzmanns Ausbildung?
Er besuchte Schulen in Sömmerda und Erfurt und studierte anschließend Theologie in Jena.
Wer beeinflusste Salzmanns frühe Bildung?
Besonders seine Mutter, die ihm das Lesen beibrachte, und seine Großmutter durch ihre Erzählungen prägten seine Kindheit.
- Citar trabajo
- Anette Müller (Autor), 2010, Christian Gotthilf Salzmann - Sein Leben und Wirken bis zum Weggang aus Erfurt im Mai 1781, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170947