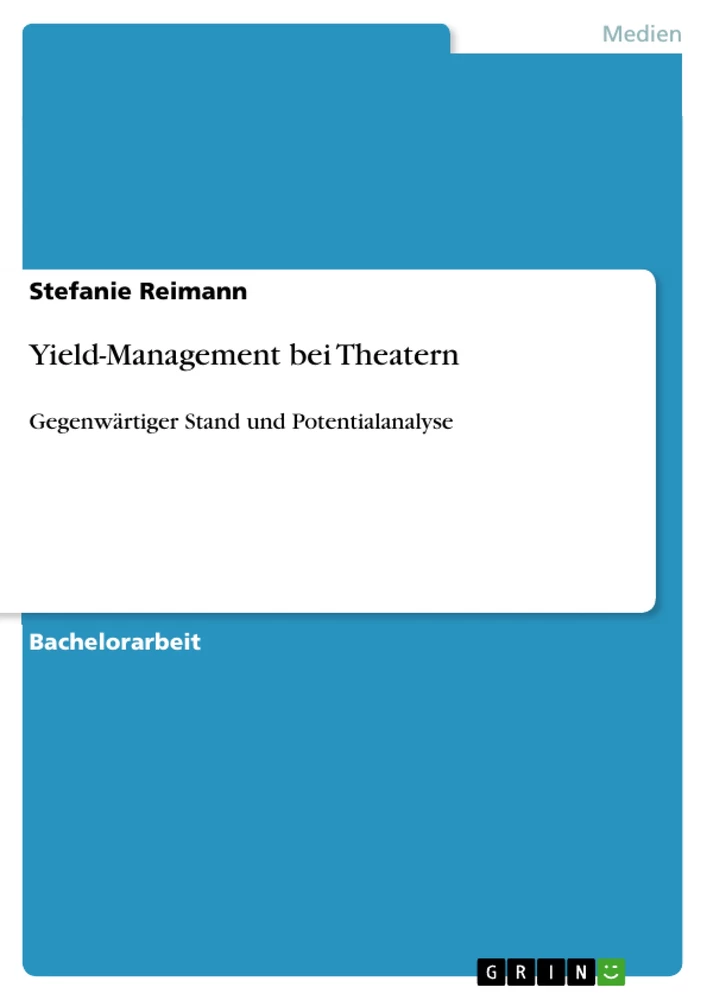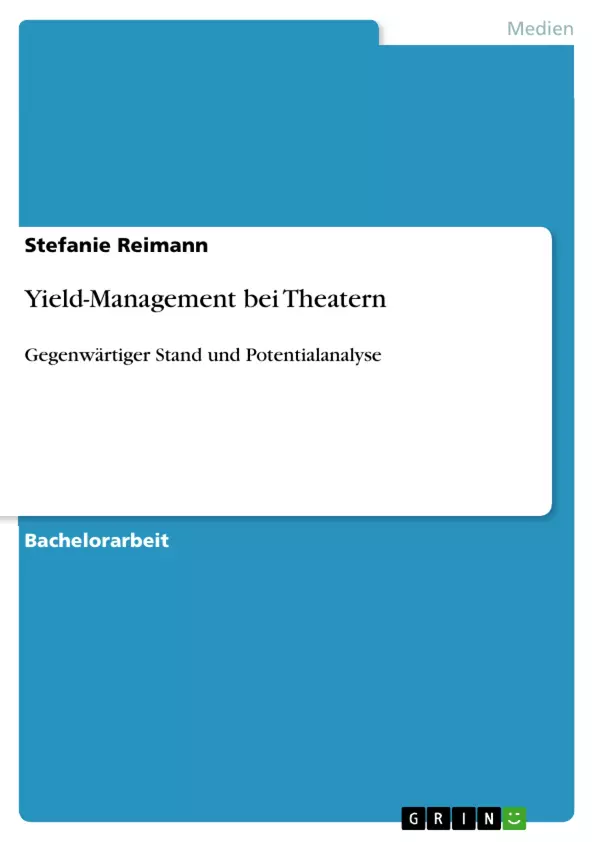Wenn von der deutschen Theaterlandschaft die Rede ist, werden häufig Attribute wie „einzigartig“ und „vielfältig“ verwendet1. Das liegt auf der einen Seite daran, dass es „nur im deutschsprachigen Raum … dieses in der Welt einmalige flächendeckende System Öffentlicher Theater [gibt]“2, andererseits gelten auch die zahlreichen in ihrer Form sehr unterschiedlichen nicht öffentlichen Theater als wichtiger Bestandteil dieser Theaterlandschaft3.
Doch die seit Jahren sinkenden öffentlichen Zuschüsse bei gleichzeitig steigenden Kosten stellen für viele Theater eine existentielle Bedrohung dar, die schon die Streichung von Stellen, Sparten und sogar die Schließung ganzer Theater nach sich zog4. Angesichts des erheblichen Anstiegs der Staatsverschuldung aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise prognostizieren neue Studien gar ein regelrechtes Theatersterben in den nächsten zehn Jahren. Hinzu kommt der Trend rückläufiger Besucherzahlen - ein Problem, das u.a. aufgrund des demografischen Wandels immer drängender wird und welches den finanziellen Engpass der Theater durch sinkende Einnahmen aus dem Kartenverkauf noch weiter erhöhen wird.
Die Verfasser der Studien und Autoren von Fachliteratur zum Thema Kulturfinanzierung empfehlen als Lösung der Finanzierungsprobleme neben einer verstärkten Nutzung alternativer Finanzierungsformen wie Sponsoring und Fundraising auch die Steigerung der Eigeneinnahmen. Umso verwunderlicher ist es, dass ein betriebswirtschaftliches Konzept, das schon einigen anderen Dienstleistungsbranchen Erlössteigerungen in Höhe von 2-5% eingebracht hat, noch kaum Beachtung in der Literatur und Praxis gefunden hat: Yield-Management.
[...]
1 u.a. Vgl. Hausmann, 2005, S. S. 1; Vgl. Deutscher Bundestag, 2007, S. 106
2 Lange, 2006, S. 55
3 Vgl. Bolwin, 2010, www.nmz.de
4 Die in diesem und dem folgenden Absatz getroffenen Aussagen, werden in der vorliegenden Arbeit an anderer Stelle noch genauer erläutert und dort auch belegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund und Problemstellung
- 1.2 Aufbau und methodisches Vorgehen
- 2. Theater in Deutschland
- 2.1 Theaterformen
- 2.1.1 Öffentliche Theater
- 2.1.2 Nicht-öffentliche Theater
- 2.1.3 Spielbetrieb
- 2.2 Finanzielle Situation
- 2.2.1 Finanzierung
- a) Öffentliche Zuwendungen
- b) Private Förderung
- c) Eigeneinnahmen
- 2.2.2 Problemfelder
- a) Rückgang der öffentlichen Zuschüsse
- b) Steigende Kosten
- c) Besucherrückgang
- 2.2.3 Bisherige Lösungsansätze
- 3. Yield Management
- 3.1 Begriffsfassung und Einordnung
- 3.2 Ursprung und Entwicklung
- 3.3 Anwendungsvoraussetzungen
- 3.4 Bestandteile des YM-Systems
- 3.5 Ausprägung des Yield-Managements
- 4. Yield-Management bei Theatern
- 4.1 Bisherige Auseinandersetzung in der Literatur
- 4.2 Prüfung der Eignung
- 4.2.1 Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen
- 4.2.2 Andere Einflussfaktoren
- a) Preiselastizität
- b) Auswirkungen von Preisaktionen
- c) Preisfairness
- d) Konsumentenverhalten
- e) Möglichkeit der Datenauswertung und Prognose an Theatern
- 4.3 Chancen und Risiken gegenwärtiger Anwendungsmethoden
- 4.3.1 Last-Minute-Rabatt
- a) An der Abendkasse
- b) Last-Minute-Ticketkasse
- 4.3.2 Frühbucherrabatt
- 4.3.3 Dynamic Pricing
- 4.4 Ergebnis
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Anwendbarkeit von Yield-Management-Methoden im deutschen Theaterbetrieb. Ziel ist es, den gegenwärtigen Stand der Diskussion zu beleuchten und das Potential dieser Methoden zur Verbesserung der finanziellen Situation von Theatern zu analysieren.
- Finanzielle Herausforderungen deutscher Theater
- Konzept und Methoden des Yield Managements
- Anwendbarkeit von Yield-Management im Theaterkontext
- Analyse spezifischer Preisstrategien (Last-Minute, Frühbucherrabatte, Dynamic Pricing)
- Chancen und Risiken der Implementierung von Yield-Management-Systemen in Theatern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, beschreibt den Hintergrund und die Problemstellung der Arbeit, nämlich die finanziellen Schwierigkeiten vieler deutscher Theater, und skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung. Es wird die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage präzisiert.
2. Theater in Deutschland: Der zweite Teil liefert einen umfassenden Überblick über die Struktur des deutschen Theaterbetriebs. Er differenziert zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Theatern, beschreibt deren Spielbetrieb und analysiert die finanzielle Situation, einschließlich der unterschiedlichen Finanzierungsquellen (öffentliche Zuwendungen, private Förderung, Eigeneinnahmen). Schließlich werden bestehende Problemfelder wie rückläufige öffentliche Zuschüsse, steigende Kosten und Besucherrückgänge beleuchtet, sowie bereits umgesetzte Lösungsansätze vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Darstellung der prekären finanziellen Lage als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Anwendbarkeit von Yield-Management-Methoden.
3. Yield Management: Dieses Kapitel definiert Yield Management und ordnet es in den betriebswirtschaftlichen Kontext ein. Es beleuchtet die Ursprünge und Entwicklung dieses strategischen Instrumentes zur Optimierung der Auslastung und Ertragsmaximierung und erläutert die notwendigen Anwendungsvoraussetzungen. Die Bestandteile eines YM-Systems werden detailliert dargestellt, sowie verschiedene Ausprägungen des Yield Managements beschrieben. Die Kapitel erläutern die Grundprinzipien und Mechanismen, die im weiteren Verlauf auf den Theaterkontext angewendet werden.
4. Yield-Management bei Theatern: Der Kern der Arbeit liegt in diesem Kapitel. Es beginnt mit einer Literaturrecherche zum Thema Yield Management im Theaterbereich. Anschließend wird die Eignung von Yield-Management für Theater anhand allgemeiner Anwendungsvoraussetzungen und weiterer Einflussfaktoren wie Preiselastizität, Auswirkungen von Preisaktionen, Preisfairness, Konsumentenverhalten und Möglichkeiten der Datenanalyse geprüft. Schließlich werden Chancen und Risiken der Anwendung von Last-Minute-Rabatten, Frühbucherrabatten und Dynamic Pricing an Theatern bewertet, und die Ergebnisse der Analyse werden zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Yield Management, Theater, Deutschland, Finanzwirtschaft, Preisstrategie, Last-Minute, Frühbucherrabatt, Dynamic Pricing, Besucherzahlen, Öffentliche Förderung, Kostenmanagement, Ertragsoptimierung, Preisdifferenzierung, Marketing.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Anwendbarkeit von Yield-Management-Methoden im deutschen Theaterbetrieb
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Anwendbarkeit von Yield-Management-Methoden zur Verbesserung der finanziellen Situation deutscher Theater. Sie analysiert das Potential dieser Methoden und beleuchtet den aktuellen Diskussionsstand.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die finanziellen Herausforderungen deutscher Theater, das Konzept und die Methoden des Yield Managements, dessen Anwendbarkeit im Theaterkontext, spezifische Preisstrategien (Last-Minute, Frühbucherrabatte, Dynamic Pricing), sowie die Chancen und Risiken der Implementierung von Yield-Management-Systemen in Theatern.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung mit Hintergrund, Problemstellung und Methodik; ein Kapitel über den deutschen Theaterbetrieb mit Fokus auf die finanzielle Situation; ein Kapitel zur Definition und Erläuterung von Yield Management; ein Kernkapitel zur Anwendbarkeit von Yield Management im Theaterkontext mit Analyse spezifischer Preisstrategien; und abschließend ein Fazit.
Welche Aspekte des deutschen Theaterbetriebs werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die verschiedenen Theaterformen (öffentliche und nicht-öffentliche Theater), den Spielbetrieb, die Finanzierungsquellen (öffentliche Zuwendungen, private Förderung, Eigeneinnahmen), Problemfelder wie rückläufige Zuschüsse, steigende Kosten und Besucherrückgänge, sowie bereits umgesetzte Lösungsansätze.
Was wird unter Yield Management verstanden und wie wird es in der Arbeit definiert?
Yield Management wird als strategisches Instrument zur Optimierung der Auslastung und Ertragsmaximierung definiert. Die Arbeit erläutert seine Ursprünge, Entwicklung, Anwendungsvoraussetzungen, Bestandteile und verschiedene Ausprägungen.
Welche Preisstrategien werden im Kontext von Theatern analysiert?
Die Arbeit analysiert die Chancen und Risiken von Last-Minute-Rabatten, Frühbucherrabatten und Dynamic Pricing im Theaterkontext, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Preiselastizität, Konsumentenverhalten und Datenanalyse.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zur Anwendbarkeit von Yield-Management-Methoden in deutschen Theatern zusammen und bewertet deren Potential zur Verbesserung der finanziellen Situation. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im bereitgestellten Auszug nicht detailliert aufgeführt.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Yield Management, Theater, Deutschland, Finanzwirtschaft, Preisstrategie, Last-Minute, Frühbucherrabatt, Dynamic Pricing, Besucherzahlen, Öffentliche Förderung, Kostenmanagement, Ertragsoptimierung, Preisdifferenzierung, Marketing.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Reimann (Autor:in), 2010, Yield-Management bei Theatern , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170977