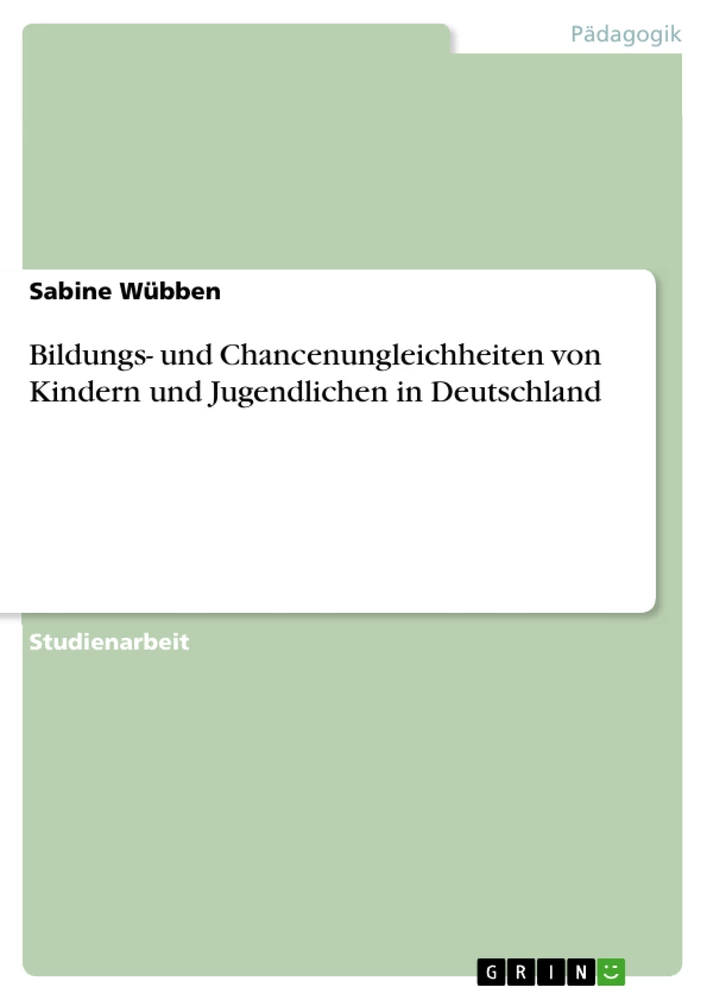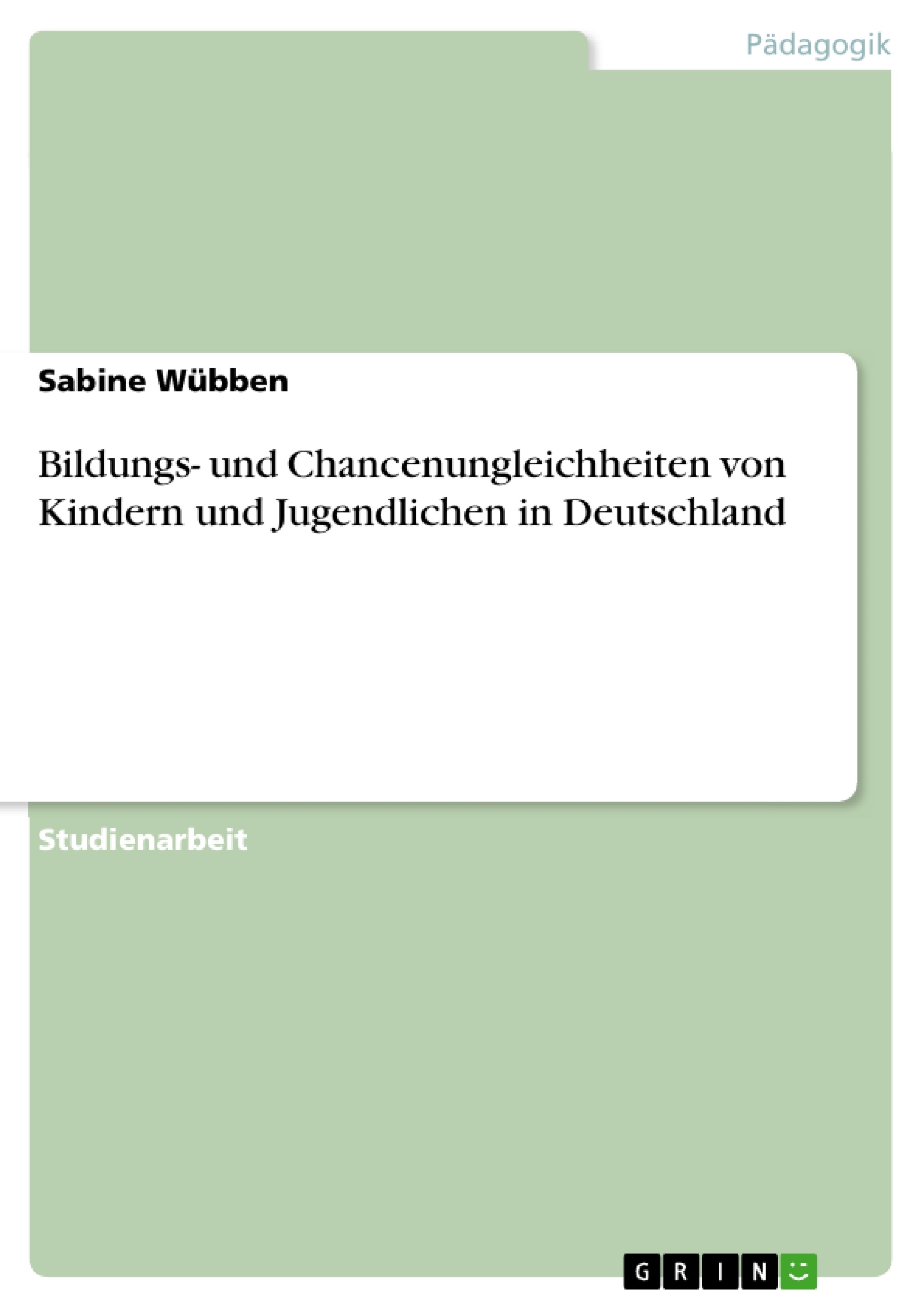Diese Hausarbeit wird sich mit den Bildungs- und Chancengleichheiten bzw. –Ungleichheiten Kinder und Jugendlicher in Deutschland befassen, welches seit Jahrzehnten ein Thema hitziger Diskussionen ist. Das deutsche Bildungssystem, welches ein entscheidender Faktor sozialer Ungleichheiten und Selektion darstellt, beginnt bereits mit dem Kindergarten, da auch dieser einen Bildungsauftrag hat und schon die ersten Lebensjahre des Kindes nicht ausschlaggebend, aber nachhaltig beeinflussend auf die Zukunft wirken können, welches ich in meiner Hausarbeit darstellen möchte. Desweiteren wird auf die deutsche Grundschule sowie Sekundarstufe intensiver eingegangen, da von hier aus bzw. nach dieser bereits die Weichen für das spätere Leben und den damit verbundenen Lebenschancen gestellt werden.
Meine Hausarbeit wird sich daher zunächst einmal mit den beiden Begriffen – Bildungs- und Chancenungleichheit – beschäftigen und diese im Zusammenhang mit dem deutschen Bildungssystems definieren, um einen Einstieg ins Thema zu bieten.
Im Hauptteil wird die Entwicklung der Bildungs- und Chancenungleichheiten in Deutschland dargelegt, indem die Veränderungen, die das deutsche Schulwesen, sowohl in Hinsicht auf eine gewandelte Bedeutung der Schulen der Sekundarstufe sowie der politischen Bemühungen, Bildung allen Schichten im gleichen Maße zugänglich zu machen, welche die Bundesrepublik von den Anfängen bis heute durchlaufen hat, analysiert werden. Danach werde ich auf die aktuelle Problematik des dreigliedrigen Schulsystems und der in Deutschland herrschenden, zum Teil extrem stark wirkenden Schichtunterschiede, die ebenfalls ihren Beitrag zu den Bildungs- und Chancenungleichheiten leisten, eingehen, um die Frage zu klären, wie sich diese Ungleichheiten heutzutage äußern und ob bzw. wie diese vom deutschen bzw. dreigliedrigen Schulsystem systematisch produziert werden.
Diese aus dem Hauptteil gewonnenen Erkenntnisse werden im letzten Teil dieser Hausarbeit nochmals zusammenfassend dargestellt werden, um diese zu einem Abschluss zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung: Bildungs- und Chancenungleichheiten
- Geschichte des Bildungssystems in Deutschland
- Bildung in Deutschland im 21. Jahrhundert
- Vorschulische Erziehung und Bildung im Kindergarten
- Bildungsentscheidung - Von der Grundschule zur Sekundarstufe: Förderung oder Selektion?
- Zusammenfassende Bewertung des deutschen Schulsystem mit Blick auf die Bildungs- und Chancenungleichheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bildungs- und Chancenungleichheiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und untersucht, wie diese durch das deutsche Bildungssystem beeinflusst werden. Dabei werden die Entwicklung des Bildungssystems, die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf die Lebenschancen der Jugendlichen beleuchtet.
- Definition und Einordnung der Begriffe Bildungs- und Chancenungleichheit
- Analyse des Einflusses des deutschen Bildungssystems auf die Bildungs- und Chancenungleichheiten
- Untersuchung der Rolle sozialer Faktoren und der Entwicklung des deutschen Schulsystems
- Bewertung der Auswirkungen der Bildungs- und Chancenungleichheiten auf die Lebenschancen der Jugendlichen
- Reflexion der politischen Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungs- und Chancenungleichheiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein und stellt die Relevanz des Themas sowie die Ziele der Hausarbeit dar.
- Begriffsklärung: Bildungs- und Chancenungleichheiten: In diesem Kapitel werden die Begriffe Bildungs- und Chancenungleichheit im Kontext des deutschen Bildungssystems definiert. Es wird erläutert, wie sich diese Ungleichheiten in der Gesellschaft auswirken und welche Faktoren dazu beitragen.
- Geschichte des Bildungssystems in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des deutschen Bildungssystems im Laufe der Zeit und analysiert die Auswirkungen auf die Bildungs- und Chancenungleichheiten. Es werden verschiedene Reformen und politische Maßnahmen betrachtet, die das Bildungssystem beeinflusst haben.
- Bildung in Deutschland im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die aktuelle Situation des deutschen Bildungssystems. Es werden die verschiedenen Bildungsstufen, die Bildungslandschaft im Kindergarten und die Übergangsprozesse zwischen den Bildungsstufen untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind Bildungs- und Chancenungleichheiten, sozialer Ungleichheit, deutsches Bildungssystem, Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe, Bildungsentscheidung, Lebenschancen, Förderung, Selektion.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht Bildungsungleichheit in Deutschland?
Bildungsungleichheit wird oft durch das dreigliedrige Schulsystem und schichtspezifische Unterschiede verstärkt, wobei die soziale Herkunft maßgeblich den Bildungsweg beeinflusst.
Welche Rolle spielt der Kindergarten bei der Chancengleichheit?
Bereits im Kindergarten werden die ersten Weichen gestellt, da vorschulische Erziehung einen Bildungsauftrag hat, der die späteren Lebenschancen nachhaltig beeinflussen kann.
Was ist das Problem beim Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe?
An diesem Punkt findet oft eine Selektion statt, die eher auf der sozialen Schicht als auf der reinen Begabung basiert, was die Aufstiegschancen einschränkt.
Wie wirken sich Schichtunterschiede auf den Schulerfolg aus?
Kinder aus höheren sozialen Schichten erhalten oft mehr Unterstützung und bessere Startbedingungen, während Kinder aus bildungsfernen Schichten systematisch benachteiligt werden.
Was sind die politischen Ziele zur Förderung der Chancengleichheit?
Die Politik versucht durch Reformen, Bildung allen Schichten gleichermaßen zugänglich zu machen, wobei die Wirksamkeit dieser Maßnahmen in der Arbeit kritisch reflektiert wird.
- Arbeit zitieren
- Sabine Wübben (Autor:in), 2009, Bildungs- und Chancenungleichheiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171014