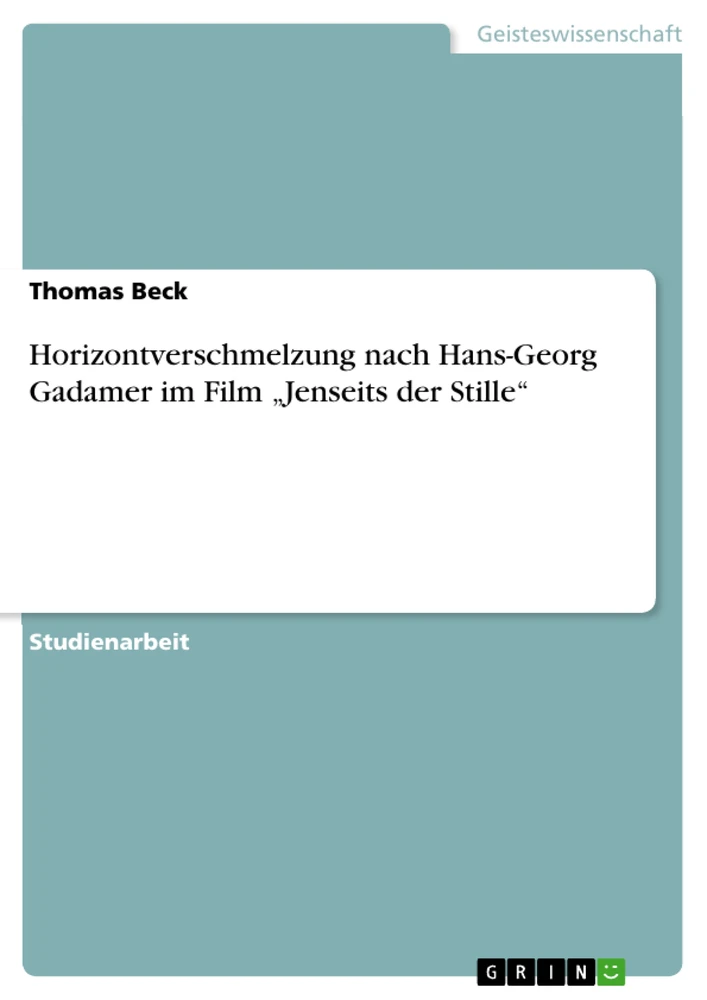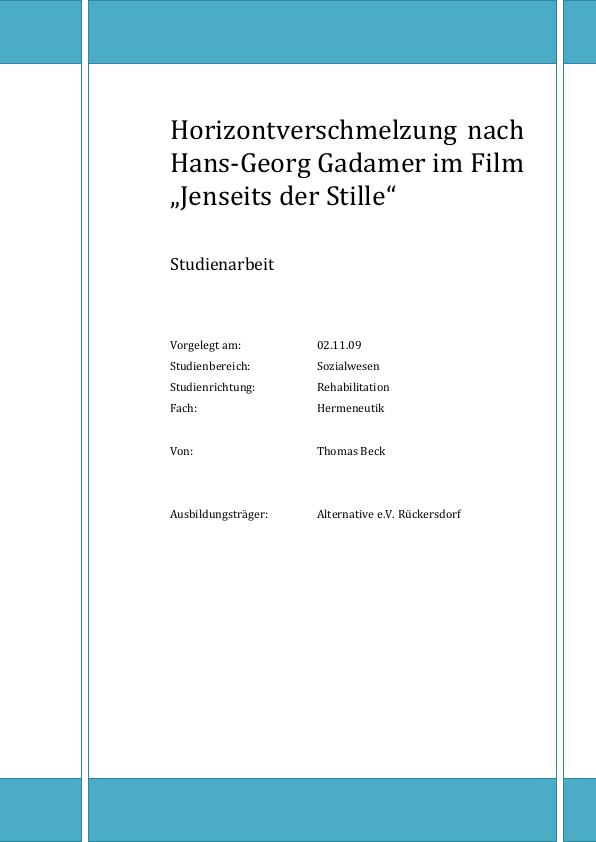„Du verstehst mich einfach nicht.“ Jeder kennt diesen Satz, jeder hat ihn schon mal gehört und höchstwahrscheinlich schon mal gesagt, oder zumindest gedacht. Wirklich verstehen ist nicht immer einfach, es ist eine „Kunst“. Hans-Georg Gadamer beschäftigt sich in seinem Werk „Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik“ mit dieser Kunst und versucht eine umfassende Theorie der Verstehens auszuarbeiten.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit dieser Theorie auseinandersetzen. Gadamer geht es in diesem Buch vorrangig um das verstehen von Texten, ich werde versuchen nachzuweisen, dass sich seine Theorien durchaus auch auf zwischenmenschliche Beziehungen anwenden lassen, dass, was Gadamer unter Horizontverschmelzung versteht, auch zwischen Menschen stattfindet.
In ersten Teil werde ich kurz die wesentlichen Begriffe, wie Vorurteil, Zirkel des Verstehens, Horizont, Horizonterweiterung und Horizontverschmelzung erklären, um dann im zweiten Teil zu betrachten, wie Horizontverschmelzung zwischen zwei Menschen, ich nutze dafür den Film „Jenseits der Stille“, stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Vorurteil
- Der Zirkel des Verstehens
- Horizont und Horizonterweiterung
- Horizontverschmelzung
- Praktischer Teil
- Jenseits der Stille - Inhaltsangabe
- Gegenstand der Betrachtung ……..\n
- Die Horizonte von Lara und ihrem Vater
- Lara ......
- Laras Vater..
- Die Schlussszene - Horizontverschmelzung im Film .....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Theorie der Horizontverschmelzung nach Hans-Georg Gadamer und untersucht deren Anwendung im Film „Jenseits der Stille“. Ziel ist es, zu zeigen, dass Gadamers Theorien zur Textinterpretation auch auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen werden können.
- Das Konzept des Vorurteils als Grundlage für Verstehen
- Der „Zirkel des Verstehens“ und die Rolle von Vorurteilen
- Horizont und Horizonterweiterung als Prozesse des Verstehens
- Horizontverschmelzung als Ergebnis der Erweiterung und Integration von Horizonten
- Anwendung der Horizontverschmelzungstheorie auf die Beziehung zwischen Lara und ihrem Vater im Film „Jenseits der Stille“
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz von Gadamers Theorie für das Verständnis von zwischenmenschlichen Beziehungen dar.
- Der theoretische Teil erläutert die wesentlichen Begriffe der Gadamerschen Hermeneutik, insbesondere Vorurteil, Zirkel des Verstehens, Horizont, Horizonterweiterung und Horizontverschmelzung.
- Der praktische Teil analysiert die Beziehung zwischen Lara und ihrem Vater im Film „Jenseits der Stille“ im Kontext der Horizontverschmelzungstheorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Schlüsselbegriffe der Gadamerschen Hermeneutik, insbesondere Vorurteil, Zirkel des Verstehens, Horizont, Horizonterweiterung und Horizontverschmelzung. Diese Konzepte werden im Kontext des Films „Jenseits der Stille“ analysiert, um die Anwendung der Theorie auf zwischenmenschliche Beziehungen zu verdeutlichen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hans-Georg Gadamer unter "Horizontverschmelzung"?
Horizontverschmelzung beschreibt den Prozess des Verstehens, bei dem der eigene Horizont (Vorwissen/Vorurteile) und der Horizont des Gegenübers (oder eines Textes) zu einer neuen, erweiterten Sichtweise verschmelzen.
Wie wird Gadamers Theorie im Film „Jenseits der Stille“ angewendet?
Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen der hörenden Lara und ihrem gehörlosen Vater, um zu zeigen, wie zwischenmenschliches Verstehen als Verschmelzung unterschiedlicher Lebenswelten funktioniert.
Welche Rolle spielen Vorurteile im "Zirkel des Verstehens"?
Nach Gadamer sind Vorurteile keine Hindernisse, sondern notwendige Bedingungen für das Verstehen, da sie den Ausgangspunkt bilden, von dem aus wir uns Neuem nähern.
Was ist ein "Horizont" in der philosophischen Hermeneutik?
Der Horizont umfasst alles, was von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen und verstanden werden kann, einschließlich aller Überlieferungen und persönlichen Erfahrungen.
Kann Gadamers Texttheorie auf Menschen übertragen werden?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass die Prinzipien der Hermeneutik auch für die Analyse und Verbesserung zwischenmenschlicher Kommunikation und Beziehungen gültig sind.
- Quote paper
- Thomas Beck (Author), 2009, Horizontverschmelzung nach Hans-Georg Gadamer im Film „Jenseits der Stille“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171037