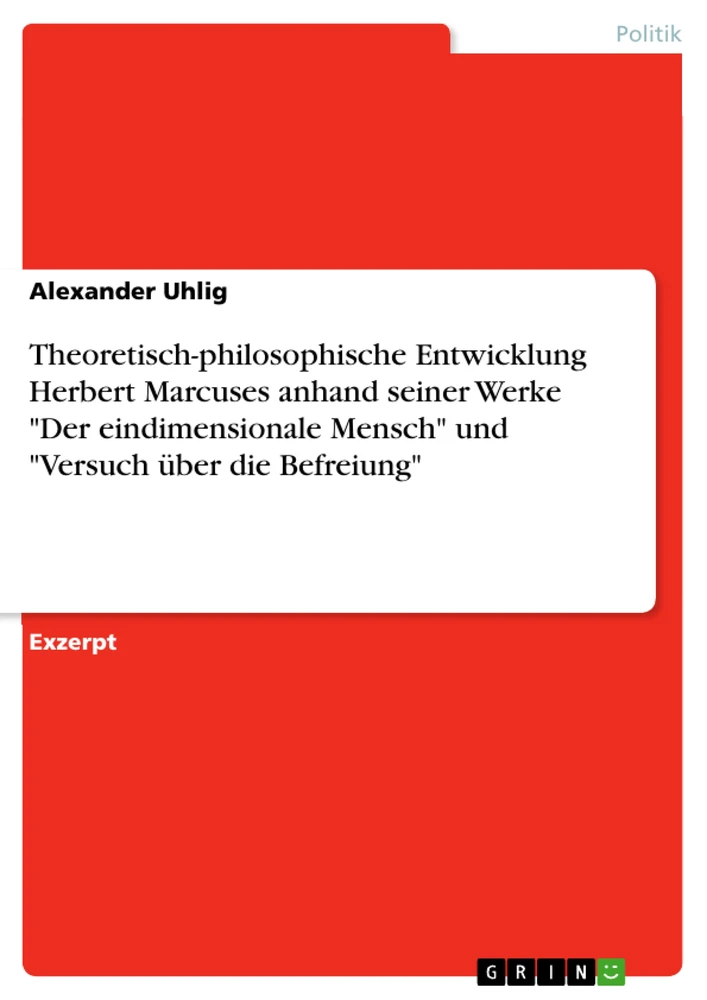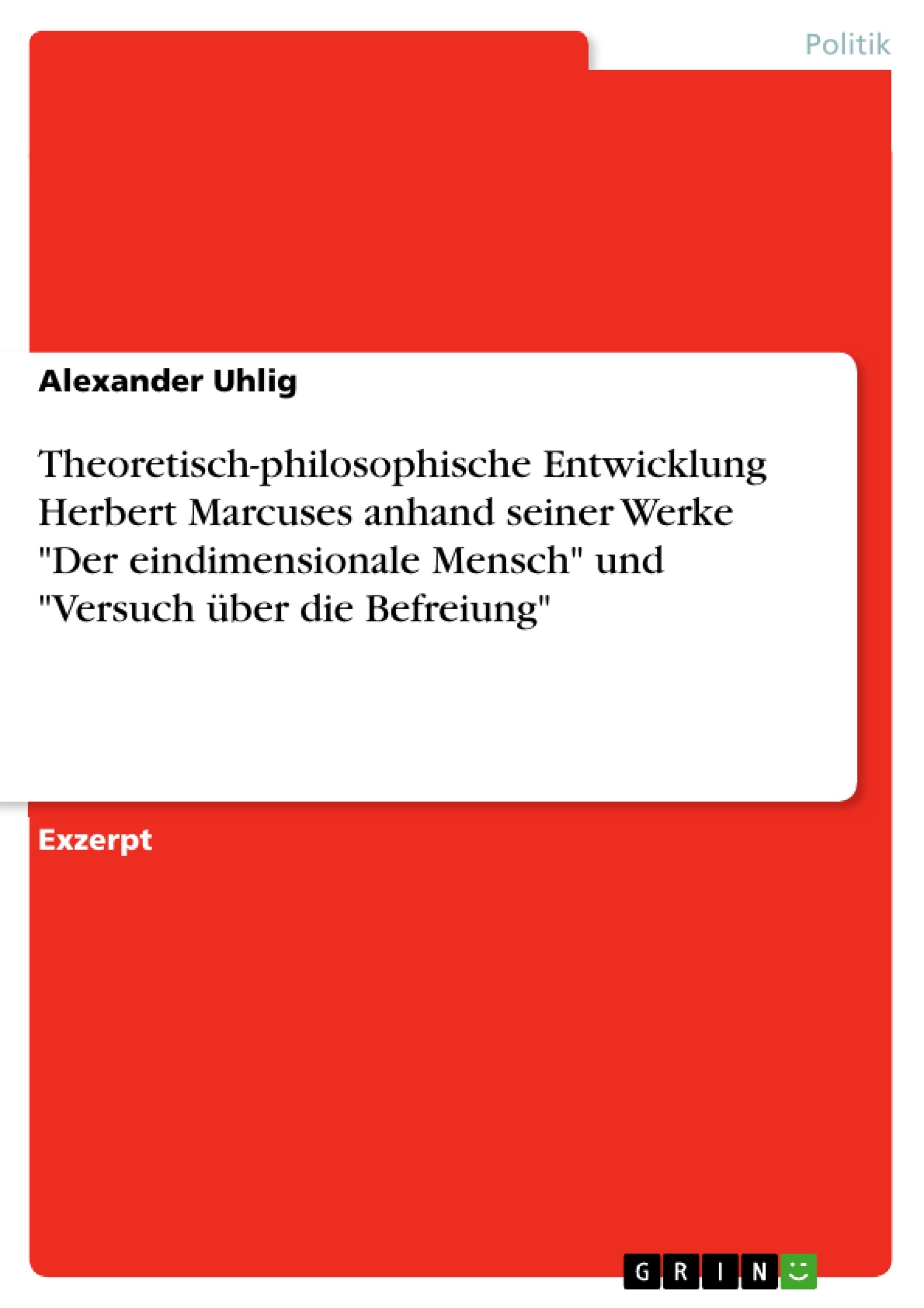Zum theoretischen Stichwortgeber der neuen antiautoritären Linken avancierte der im kalifornischen Exil lebende Herbert Marcuse. Marcuse floh 1933 aus Berlin über Genf und Paris nach New York, wo er 1934 am Institut für Sozialforschung angestellt wurde. In den folgenden Jahren arbeitete er für die amerikanische Regierung und lehrte an verschiedenen Universitäten, bis er 1954 eine Professur für Philosophie an der Brandeis University erhielt. Zwischen 1967 und 1969 befand er sich auf Vortragsreise durch Europa, wo er Zeuge der Studentenbewegungen in Paris und Berlin wurde. Zur „weltberühmten intellektuellen Symbolfigur der Studentenrevolte“ wurde Herbert Marcuse keineswegs über Nacht. Es bedurfte eines langen, an der gesellschaftlichen Wirklichkeit orientierten Erkenntnisprozesses. Marcuse selbst bezeichnete seine Arbeiten als „Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft“ – so der Untertitel des „eindimensionalen Menschen“. Und um die Fehlentwicklungen in den modernen Industriegesellschaften ging es ihm. Marcuse untersuchte die Gründe, die den Menschen auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung zu seinen grausamsten Dynamiken bewegt, womit er auf Kriege, totalitäre Regime und Massenmord abzielte. Er fragte nach den Mechanismen in Technik, Wirtschaft und Politik, welche die Vernunft des Menschen pervertieren, ihn geistig verarmen lassen und die jeden kritischen Gedanken so wirkungsvoll im Keim ersticken.
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die theoretisch-philosophische Entwicklung Herbert Marcuses anhand seiner Werke zu untersuchen und zu beschreiben. Schwerpunkt stellt jene Entwicklung dar, die Marcuse vom „Eindimensionalen Menschen“ (1964) zum „Versuch über die Befreiung“ (1969) nimmt. Zunächst zeichnet er noch ein tief-pessimistisches Bild der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, die eine Gesellschaft ohne Opposition sei, der status quo wäre im Innern des Menschen fixiert. Welche gesellschaftliche Entwicklung bewegt ihn also dazu, von seiner Position abzuweichen und dem Menschen eine positivere Zukunft zuzugestehen? Auf welchen Annahmen baut Marcuse mögliche Alternativen einer befreiten Gesellschaft auf?
Für die vorliegende Arbeit von entscheidender Bedeutung sind die Theorien Karl Marx´, wie er sie mit der Kritik der politischen Ökonomie in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ darlegt. Des Weiteren werden die „Psychoanalyse“ Siegmund Freuds und die darin entwickelte Trieblehre...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Marcuses Ringen um das Reich der Freiheit
- Zum Begriff des eindimensionalen Menschen
- Der eindimensionale Mensch in der spätkapitalistischen Gesellschaft
- Versuch über die Befreiung des eindimensionalen Menschen
- Revolution als Mittel zum Zweck
- Die neue Sensibilität
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der theoretisch-philosophischen Entwicklung Herbert Marcuses anhand seiner Werke, insbesondere die Entwicklung vom „Eindimensionalen Menschen“ (1964) zum „Versuch über die Befreiung“ (1969). Die Arbeit untersucht die Gründe für Marcuses Wandel von einem pessimistischen Bild der fortgeschrittenen Industriegesellschaft hin zu einer positiveren Zukunftsvision. Dabei werden die Annahmen, auf denen Marcuse mögliche Alternativen einer befreiten Gesellschaft aufbaut, analysiert.
- Die Entwicklung des eindimensionalen Menschen in der spätkapitalistischen Gesellschaft
- Der Einfluss von Marx, Freud und der Kritik der politischen Ökonomie
- Die Rolle der Technologie und der Manipulation von Bedürfnissen
- Das Konzept des Reichs der Notwendigkeit und des Reichs der Freiheit
- Die Möglichkeit einer revolutionären Veränderung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Herbert Marcuse als Theoretiker der neuen antiautoritären Linken vor und zeichnet seinen Lebensweg sowie seine philosophischen Einflüsse nach. Sie führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Wie kommt Marcuse zu der Hoffnung auf eine Befreiung des Menschen, nachdem er zuvor ein pessimistisches Bild der fortgeschrittenen Industriegesellschaft gezeichnet hat?
- Marcuses Ringen um das Reich der Freiheit: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Marx' Konzept der Klassengesellschaft und der entfremdeten Arbeit im Kapitalismus. Es stellt die Frage, wie die Freiheit des Menschen innerhalb des „Reiches der Notwendigkeit" und des „Reiches der Freiheit" möglich sein kann.
- Zum Begriff des eindimensionalen Menschen: Das Kapitel behandelt Marcuses Kritik an der Überflussgesellschaft und deren Einfluss auf die Bedürfnisse und die Widerstandsfähigkeit des Menschen. Es untersucht, wie die vermeintliche Rationalität der Gesellschaft zu einer Ideologie wird, die Kritik und Wandel behindert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Kritik der spätkapitalistischen Gesellschaft, die Entfremdung des Menschen, die Manipulation von Bedürfnissen, das Reich der Notwendigkeit und das Reich der Freiheit, sowie die Möglichkeiten der Befreiung und Revolution. Wichtige Denker, die in der Arbeit behandelt werden, sind Herbert Marcuse, Karl Marx, Sigmund Freud und die Vertreter der Frankfurter Schule.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Eindimensionalität" bei Herbert Marcuse?
Es beschreibt einen Zustand in der Industriegesellschaft, in dem kritisches Denken und Opposition durch die Manipulation von Bedürfnissen und Konsum unterdrückt werden.
Wie entwickelte sich Marcuses Denken zwischen 1964 und 1969?
Er wandelte sich von einem tiefen Pessimismus im "Eindimensionalen Menschen" hin zu einer vorsichtigen Hoffnung auf Befreiung, inspiriert durch die Studentenbewegungen.
Welchen Einfluss hatte Sigmund Freud auf Marcuse?
Marcuse nutzte Freuds Trieblehre, um zu erklären, wie die Gesellschaft den status quo im Inneren des Menschen fixiert und wie eine libidinöse Befreiung aussehen könnte.
Was ist die "neue Sensibilität"?
Ein Konzept aus dem "Versuch über die Befreiung", das eine neue Art des Wahrnehmens und Fühlens beschreibt, die die Grundlage für eine gewaltfreie, ästhetische Gesellschaft bildet.
Wie steht Marcuse zur Technologie?
Er kritisiert, dass Technik in der bestehenden Gesellschaft als Instrument der Herrschaft dient, sieht aber auch das Potenzial, mühsame Arbeit zu eliminieren und Freiheit zu ermöglichen.
- Quote paper
- Alexander Uhlig (Author), 2008, Theoretisch-philosophische Entwicklung Herbert Marcuses anhand seiner Werke "Der eindimensionale Mensch" und "Versuch über die Befreiung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171041