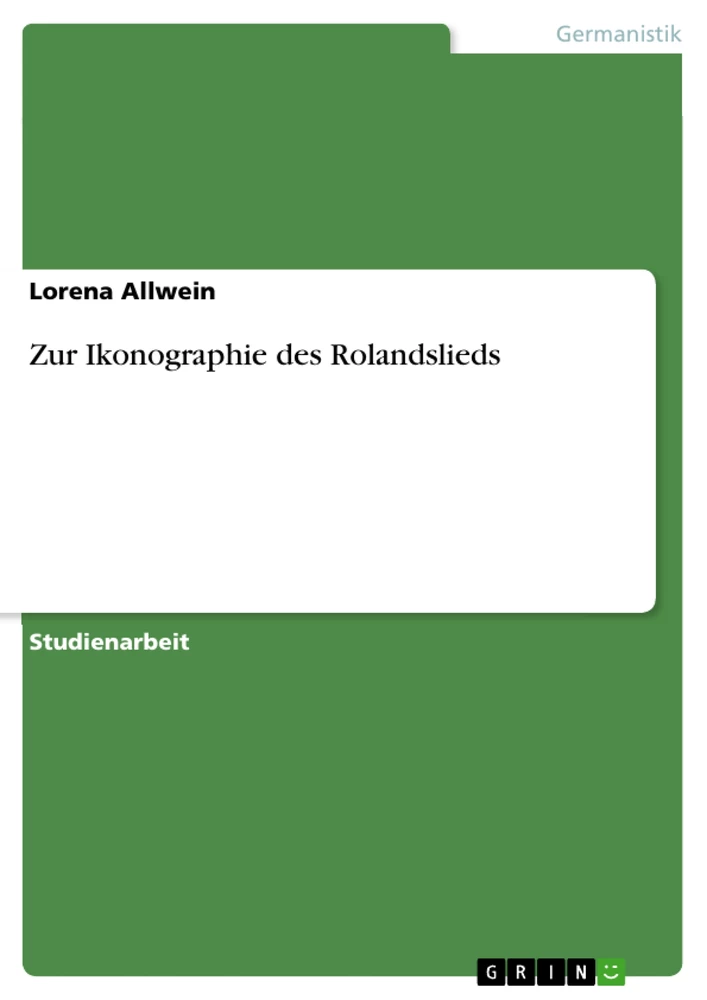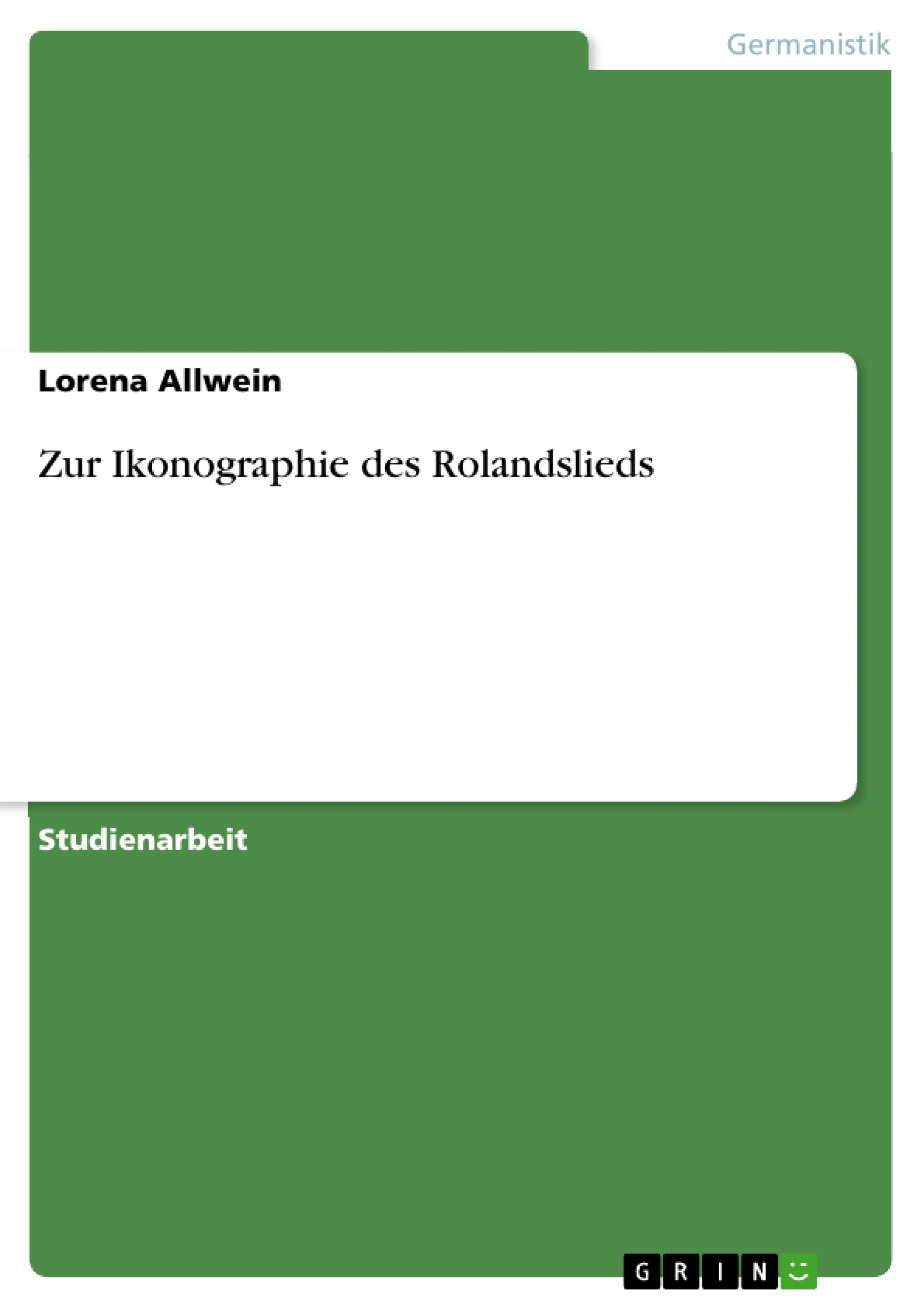Das Rolandslied gilt als das älteste, französische Heldenepos und wurde um ca. 1100 von einem anonymen Autor verfasst. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts (die Datierung ist stark umstritten ) wurde das Rolandslied durch den Pfaffen Konrad aus dem Französischen ins Lateinische und anschließend ins Deutsche übersetzt.
Dieser nennt sich selbst im Epilog „ich haize der phaffe Chunrat“(V. 9079) und man geht davon aus, dass es sich hierbei um einen Kleriker handelt. Genaueres ist uns zum Leben des Pfaffen Konrad nicht bekannt.
In der Heidelberger Handschrift (P) ist das Rolandslied weitgehend vollständig auf 123 Pergamentblättern erhalten (nur ein Doppelblatt, auf dem sich ca. 150 Verse befunden haben fehlt).
39 Federzeichnungen, welche in den Text integriert sind, verschönern die Handschrift.
In der Forschungsliteratur gibt es vergleichsweise nur wenige Un-tersuchungen, die sich mit dem Verhältnis von Text und Bild im Rolandslied beschäftigen. Jedoch gerade die außerordentlich gut erhaltene Heidelberger Handschrift bietet Wissenschaftlern und Forschern vielseitige Möglichkeiten, darzulegen, wie der Illustrator und der Dichter auf unterschiedliche Weise das Rolandsthema wiedergeben. Ein wichtiger, interessanter Aspekt hierbei ist die Aussage der Zeichnungen in direktem Bezug zum dichterischen Text. Ziel dieser Seminararbeit ist es, auf ausgewählte Zeichnungen näher einzugehen und diese auf den Kontext des Rolandsliedes zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ikonografie
- Mittelalterliche Federzeichnungen
- Aufbau und Komposition der Handschrift
- Bildanalyse
- Abbildung Nr. 5
- Dargestellter Inhalt
- Einordnung in den Kontext
- Abbildung Nr. 12
- Dargestellter Inhalt
- Einordnung in den Kontext
- Abbildung Nr. 19
- Dargestellter Inhalt
- Einordnung in den Kontext
- Abbildung Nr. 30
- Dargestellter Inhalt
- Einordnung in den Kontext
- Abbildung Nr. 31
- Dargestellter Inhalt
- Einordnung in den Kontext
- Die Art und Weise der Darstellung
- Darstellung der Charaktere
- Darstellung des Raumes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert ausgewählte Federzeichnungen der Heidelberger Handschrift des Rolandslieds und setzt diese in Beziehung zum Text des Pfaffen Konrad. Die Arbeit untersucht, wie der Illustrator das Rolandsthema in den Bildern wiedergibt und welche Aussagen die Zeichnungen im direkten Bezug zum dichterischen Text machen.
- Das Verhältnis von Text und Bild im Rolandslied
- Die Bedeutung der Federzeichnungen für die Interpretation des Rolandsliedes
- Die Stilistik der Federzeichnungen
- Die Rolle des Illustrators bei der Gestaltung des Rolandsliedes
- Die Interpretation der Federzeichnungen im Kontext des Rolandsliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Rolandslied als ältestes französisches Heldenepos und die Übersetzung durch den Pfaffen Konrad ein. Sie stellt die Heidelberger Handschrift als wichtige Quelle für die Erforschung des Werkes vor und hebt die Bedeutung der darin enthaltenen Federzeichnungen hervor.
Der Abschnitt zur Ikonografie befasst sich mit den mittelalterlichen Federzeichnungen als Illustra�tionsform für Handschriften. Der Aufbau und die Komposition der Heidelberger Handschrift werden im Hinblick auf die Federzeichnungen analysiert, um Hinweise auf die Entstehung und die Produktionsbedingungen der Handschrift zu erhalten. Die detaillierte Analyse einzelner Bilder (Abbildungen 5, 12, 19, 30, 31) stellt die Beziehung zwischen Bild und Text dar und untersucht, wie der Illustrator das Geschehen des Rolandsliedes verbildlicht.
Der Abschnitt über die Art und Weise der Darstellung fokussiert auf die stilistischen Besonderheiten des Illustrators und seine Art, Figuren und Räume darzustellen.
Schlüsselwörter
Rolandslied, Pfaffen Konrad, Heidelberger Handschrift, Federzeichnungen, Text-Bild-Beziehung, Ikonografie, Mittelalterliche Handschriften, Bildanalyse, Charakterdarstellung, Raumdarstellung, Illustrationsstil, Interpretationsansätze, Heldenepos.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Rolandslied?
Das Rolandslied ist das älteste französische Heldenepos. Es wurde um 1100 verfasst und Ende des 12. Jahrhunderts vom Pfaffen Konrad ins Deutsche übertragen.
Was ist das Besondere an der Heidelberger Handschrift (P)?
Sie ist fast vollständig erhalten und enthält 39 kunstvolle Federzeichnungen, die den Text illustrieren und wertvolle Einblicke in die mittelalterliche Ikonografie bieten.
Wer war der Pfaffe Konrad?
Konrad war ein Kleriker, der das Werk aus dem Französischen über das Lateinische ins Deutsche übersetzte. Über sein Leben ist ansonsten wenig bekannt.
Wie stehen Text und Bild in der Handschrift zueinander?
Die Federzeichnungen sind direkt in den Text integriert. Sie interpretieren das Geschehen visuell und ergänzen die dichterische Aussage des Textes.
Was wird in den Zeichnungen primär dargestellt?
Die Zeichnungen zeigen wichtige Charaktere, Kampfszenen und räumliche Situationen des Epos, wobei der Illustrator eigene Akzente bei der Figurendarstellung setzt.
Warum ist die Ikonografie des Rolandslieds für Forscher interessant?
Sie ermöglicht es zu untersuchen, wie mittelalterliche Künstler literarische Stoffe in Bilder übersetzten und welche gesellschaftlichen oder religiösen Werte dabei betont wurden.
- Quote paper
- Lorena Allwein (Author), 2008, Zur Ikonographie des Rolandslieds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171072