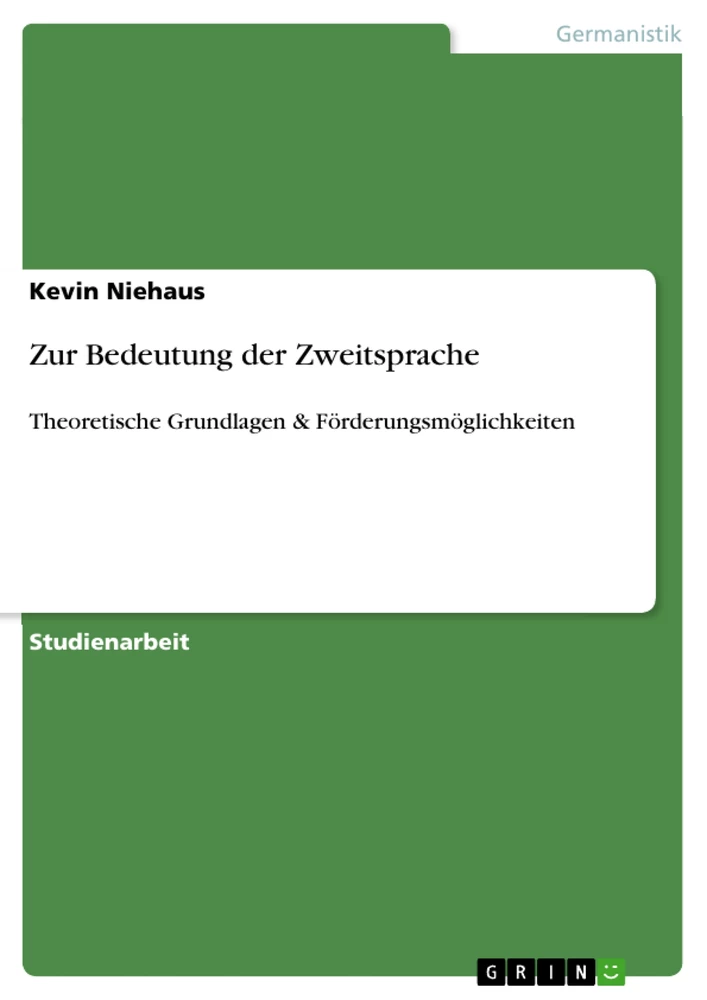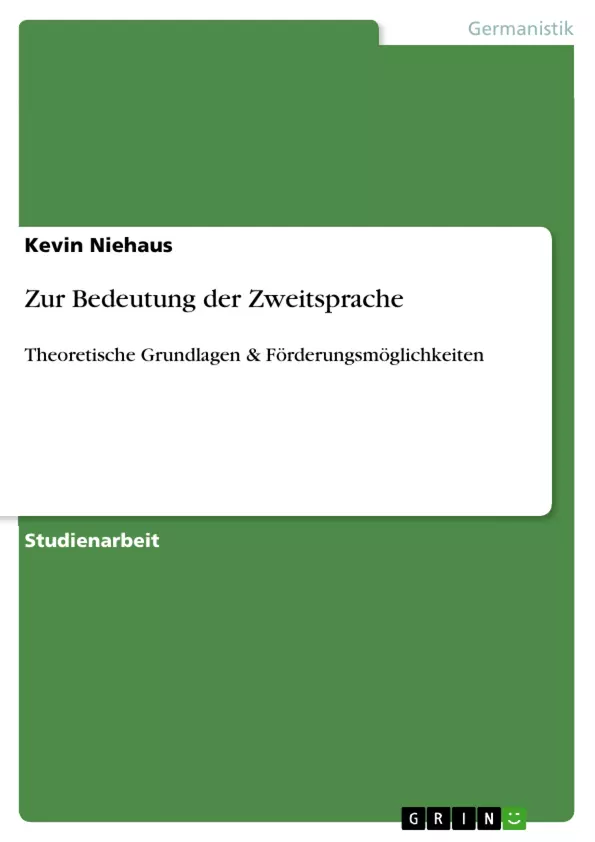1. Einleitung
In Anbetracht der Diskussion um die frühkindliche Sprachförderung, die
einerseits durch den PISA-Schock und zum Anderen im Zusammenhang mit
der vor allem in den letzten Jahren fortgeschrittenen Forschung sowie den
zahlreich daraus resultierenden Förderprogrammen wieder aufgeflammt ist,
scheint vor allem die Bedeutung der Zweitsprache bei Kindern mit
Migrationshintergrund ein hochaktuelles Thema zu sein.
Besonders da wir in einer Welt leben, die von einer Sprachenvielfalt geprägt ist.
Dazu tragen sowohl die Globalisierung, neue technologische Entwicklungen,
die Erweiterung der EU sowie die Migration und Mobilität bei. Infolge dieses
ständigen Wandels entstehen zunehmend Begegnungen mit Menschen anderer
Sprache. Trotz der hohen Zuwanderungen existieren, zu Beginn der
Zuwanderung sowie heute, einige Probleme, die zum Teil barriereartige Züge
für viele Migranten einnehmen. Die unterschiedliche Sprache, Herkunft und
Weltanschauung lösen Verunsicherung aus, weil viele Bereiche der
Gesellschaft auf den großen Zuzug von Menschen nicht vorbereitet waren und
sind.
Gerade bei Migrantenkindern der dritten und vierten Generation wurde die
Bedeutung sprachlicher Defizite nicht rechtzeitig erkannt. Da
Sprachangemessenheit heutzutage jedoch eng an die gesellschaftliche
Stellung geknüpft sowie Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches,
selbstbestimmtes Leben in unserer Leistungsgesellschaft ist, muss aufgrund
der zunehmenden Bedeutung der Zweisprachigkeit vor allem die Zweitsprache
Deutsch bei Kindern mit Migrationshintergrund Förderung erfahren, um eine
kulturell unabhängige Gleichstellung zu muttersprachlichen Kindern zu
ermöglichen.
Mit der Hausarbeit soll versucht werden, einen Einstieg und Überblick in die
weitreichende Thematik der frühen Mehrsprachigkeit, mit besonderem Blick auf
die Zweitsprache, zu ermöglichen. Im Folgenden werden zuerst theoretische
Grundlagen des Erst- und Zweitspracherwerbs genauer dargestellt, die die
Verständnisgrundlage für die im Anschluss vorgestellten Besonderheiten und
frühsprachlichen Förderungsmöglichkeiten im Elementarbereich bilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erstsprache
- Definition Erstsprache
- Theoretische Erklärungsversuche - Spracherwerbstheorien
- Bedingungen des Erstspracherwerbs
- Zweitsprache
- Was bedeutet Zweisprachigkeit?
- Gleichzeitiger Erwerb zweier Sprachen
- Nachzeitiger Erwerb zweier Sprachen
- Definition Zweitspracherwerb
- Unterschied gesteuerter & ungesteuerter Zweitspracherwerb
- Definition Zweitsprache
- Bedingungen des Zweitspracherwerbs
- Theorien des Zweitspracherwerbs
- Mehrsprachigkeit im Elementarbereich
- Grundprinzipien der zweisprachigen Erziehung im institutionellen Rahmen
- Vor- und Nachteile der mehrsprachigen Erziehung
- Förderungsmöglichkeiten der Zweitsprache
- Förderungskonzepte
- Förderungsschwerpunkte
- Fördermaterial
- Sprachförderung am Beispiel der städtischen Tageseinrichtung für Kinder Laarmannshof in Gelsenkirchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung der Zweitsprache, insbesondere im Hinblick auf Kinder mit Migrationshintergrund, im Kontext der frühkindlichen Sprachförderung. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen des Erst- und Zweitspracherwerbs, sowie die Herausforderungen und Chancen der mehrsprachigen Erziehung im Elementarbereich.
- Theoretische Grundlagen des Erst- und Zweitspracherwerbs
- Herausforderungen und Chancen der mehrsprachigen Erziehung im Elementarbereich
- Bedeutung der Zweitsprache für Kinder mit Migrationshintergrund
- Förderungsmöglichkeiten der Zweitsprache
- Praxisbeispiel der Sprachförderung in einer städtischen Tageseinrichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der frühkindlichen Sprachförderung, insbesondere im Kontext der Zweitsprache bei Kindern mit Migrationshintergrund, dar. Sie beleuchtet die aktuelle Situation in einer globalisierten Welt, die von Sprachenvielfalt geprägt ist, sowie die Herausforderungen, die mit Zuwanderung und der unterschiedlichen Sprachkompetenz von Migrantenkindern verbunden sind.
Erstsprache
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Erstsprache und stellt die wichtigsten Theorien des Spracherwerbs, wie den Behaviourismus, Nativismus und Kognitivismus, vor. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Spracherwerb und untersucht den Einfluss der Umgebung und der genetischen Faktoren auf die Sprachentwicklung.
Zweitsprache
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Zweisprachigkeit und unterscheidet zwischen gleichzeitigem und nachzeitigem Erwerb zweier Sprachen. Es erklärt die verschiedenen Formen des Zweitspracherwerbs und untersucht die Bedingungen, die den Zweitspracherwerb beeinflussen.
Mehrsprachigkeit im Elementarbereich
Dieses Kapitel beleuchtet die Prinzipien der zweisprachigen Erziehung im institutionellen Rahmen und diskutiert die Vor- und Nachteile der mehrsprachigen Erziehung. Es verdeutlicht die Bedeutung der frühkindlichen Sprachförderung und untersucht die spezifischen Bedürfnisse von mehrsprachigen Kindern im Elementarbereich.
Förderungsmöglichkeiten der Zweitsprache
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Förderungskonzepte, -schwerpunkte und -materialien, die zur Förderung der Zweitsprache eingesetzt werden können. Es gibt praktische Beispiele und Empfehlungen für die Umsetzung der Sprachförderung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Sprachförderung, Zweitsprache, Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund, Spracherwerbstheorien, Elementarbereich, Förderungskonzepte, Förderungsschwerpunkte, Fördermaterial.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Förderung der Zweitsprache Deutsch so wichtig?
Sprachkompetenz ist eng an die gesellschaftliche Stellung geknüpft und Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und schulischen Erfolg.
Was ist der Unterschied zwischen gesteuertem und ungesteuertem Zweitspracherwerb?
Ungesteuerter Erwerb geschieht natürlich im Alltag, während gesteuerter Erwerb durch gezielten Unterricht oder Förderprogramme erfolgt.
Welche Spracherwerbstheorien werden in der Arbeit behandelt?
Behandelt werden unter anderem der Behaviourismus, Nativismus und Kognitivismus.
Was sind die Vorteile mehrsprachiger Erziehung im Kindergarten?
Sie fördert die kulturelle Offenheit und nutzt das hohe Lernpotential im frühen Alter, um eine Gleichstellung zu muttersprachlichen Kindern zu ermöglichen.
Welches Praxisbeispiel für Sprachförderung wird genannt?
Die Arbeit bezieht sich auf die städtische Tageseinrichtung für Kinder Laarmannshof in Gelsenkirchen.
- Arbeit zitieren
- Kevin Niehaus (Autor:in), 2009, Zur Bedeutung der Zweitsprache , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171076