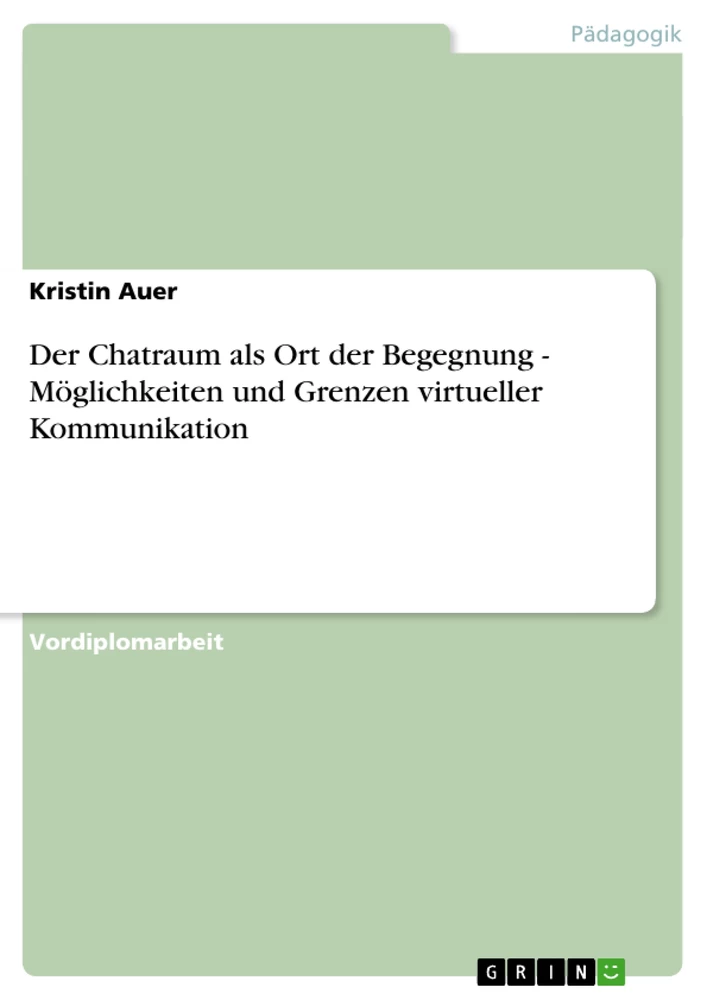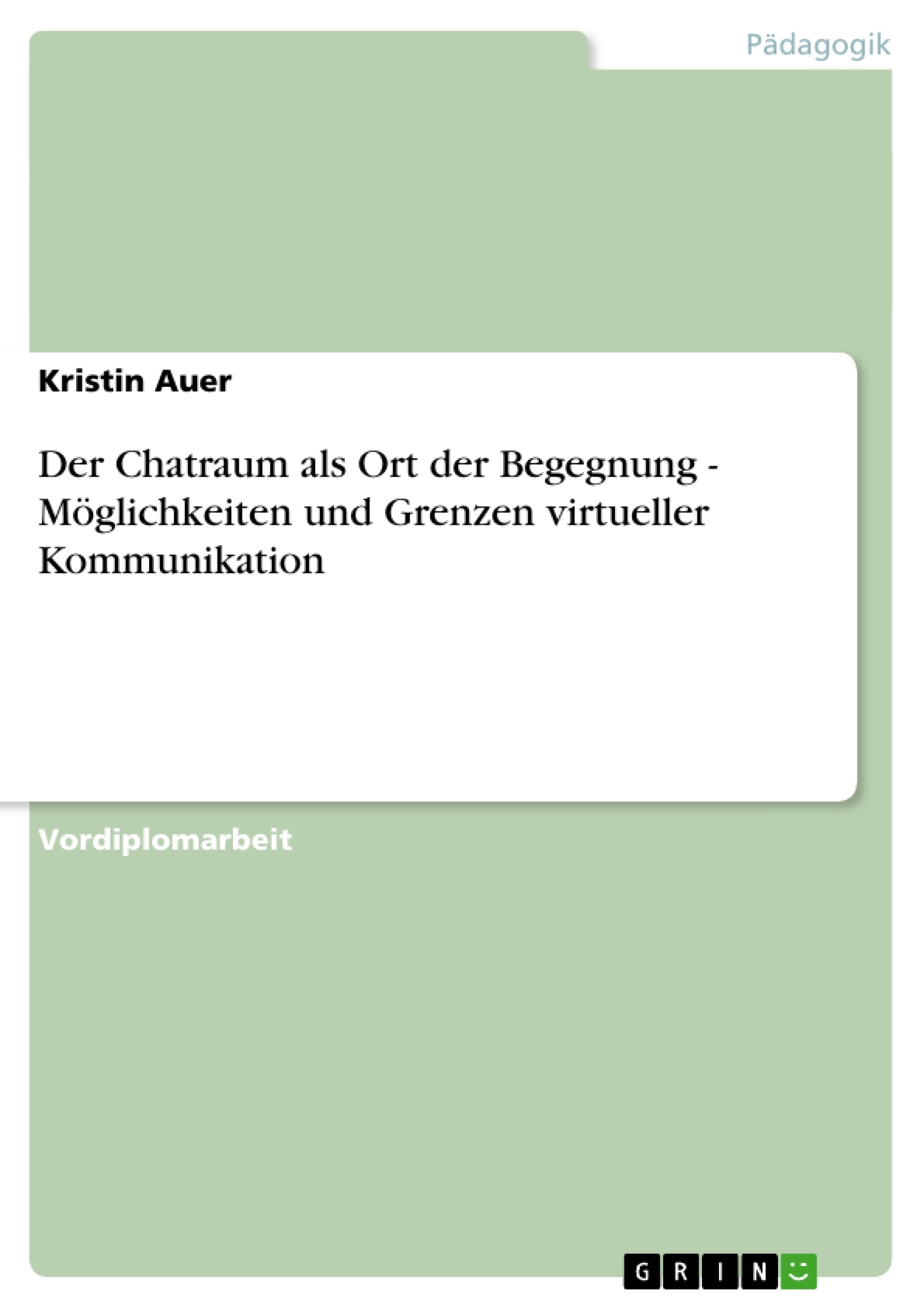Was macht menschliche Kommunikation aus?
Worin liegt der Unterschied zwischen einer Kommunikation, die in einer face-to-face-
Interaktion stattfindet (beispielsweise zwischen zwei Freunden, die an einem Tisch sitzen und
sich unterhalten) und der Kommunikation im Internet-Chat1? Was sind die Gemeinsamkeiten?
Und warum greifen immer mehr junge Menschen auf die letztgenannte Kommunikationsform
zurück?
Liegt in der zunehmenden Nutzung von Computern als Medium sozialer Interaktion eine
Gefahr oder ist es im Gegenteil eine Bereicherung für das zwischenmenschliche
Zusammenleben?
Mit möglichen Antworten auf diese Fragen wird sich diese Arbeit beschäftigen.
Um einen sinnvollen Vergleich beider Kommunikationsformen, face-to-face-Kommunikation
versus Chatten, herauszuarbeiten, ist es zunächst notwendig, grundlegende Definitionen
festzuhalten und die zentrale Bedeutung des Begriffes „Kommunikation“ zu klären.
Natürlich ist dies in einer umfassenden und allen Theorien gerechtwerdenden Art im Rahmen
dieser Arbeit nicht möglich, gleichwohl werde ich im ersten Teil der Arbeit auf grundlegende
Theorien von Kommunikation eingehen (Kapitel 1 und 2), um dann am Ende in einem
Vergleich von face-to-face-Interaktion und computervermittelter Kommunikation (cvK) zu
Aussagen und Konsequenzen bezüglich meiner Ausgangsfragen zu kommen.
Bei dem kommunikationstheoretischen Teil im Kapitel 2 berufe ich mich im wesentlichen auf
die Arbeit von Watzlawick/ Beavin und Jackson: Menschliche Kommunikation2.
Die ihr zugrundeliegende Systemtheorie, nach der Kommunikation nicht als Einzelmerkmal
erklärt und behandelt werden kann, bildet den Ausgangspunkt für die von Watzlawick
aufgestellten Axiomen, auf die ich näher eingehen werde.
Zusätzlich stelle ich das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun dar, der
auf Paul Watzlawicks Theorien aufbauend sein Konzept der vier Seiten einer Nachricht
begründet (siehe Schulz von Thun, 2001, S. 13 -14).
[...]
1 engl.: „to chat“- plaudern
2 Im Original unter dem Titel: “Pragmatics of Human Communiacation. A Study of Interactional Patterns, Pathologies
and Paradoxes“ 1967 erschienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kommunikation in Real Life
- 2.1. Allgemeine Erläuterungen
- 2.2. Das Kommunikationsmodell nach Watzlawick (5 Axiome)
- 3. Kommunikation in Virtual Life
- 3.1. Das Internet
- 3.2. Computervermittelte Kommunikation
- 4. Das CaféKomm (Münster) als Beispiel eines deutschsprachigen Internet Relay Chats
- 4.1. Zur Entwicklung des Münster-Chats
- 4.2. Besonderheiten des CaféKomm
- 5. Der Internet Relay Chat als Ort der Kommunikation im Vergleich zur face-to-face-Kommunikation
- 5.1. Darstellung einer Chat-Sequenz
- 5.2. Theorien zur computervermittelten Kommunikation
- 5.3. Interpretation zweier Gesprächssequenzen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen face-to-face-Kommunikation und Kommunikation im Internet-Chat. Sie beleuchtet die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation und analysiert, inwieweit computervermittelte Kommunikation das soziale Gefüge beeinflusst. Die Arbeit basiert auf bestehenden Kommunikationstheorien und verwendet den Münster-Chat "CaféKomm" als Fallbeispiel.
- Vergleich von face-to-face- und Chat-Kommunikation
- Bedeutung nonverbaler Kommunikation
- Analyse computervermittelter Kommunikation (cvK)
- Einfluss von cvK auf das soziale Gefüge
- Das CaféKomm als Beispiel für einen deutschsprachigen Chatraum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Was unterscheidet face-to-face-Kommunikation von Chat-Kommunikation? Welche Gemeinsamkeiten bestehen? Warum nutzen junge Menschen verstärkt Chat-Kommunikation? Die Autorin skizziert ihren Forschungsansatz, der auf grundlegenden Kommunikationstheorien aufbaut und einen Vergleich beider Kommunikationsformen anstrebt. Sie kündigt die Verwendung des Kommunikationsmodells nach Watzlawick und Schulz von Thun an und definiert die Begriffe „Kommunikation in Real Life (RL)“ und „Kommunikation in Virtual Life (VL)“, wobei sie betont, dass auch computervermittelte Kommunikation reale Kommunikation ist.
2. Kommunikation in Real Life: Dieses Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich, indem es allgemeine Aspekte der face-to-face-Kommunikation beleuchtet. Es thematisiert die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kommunikation“ und differenziert zwischen Kommunikation im weiteren und engeren Sinne. Die Autorin konzentriert sich auf die Humankommunikation und hebt die Bedeutung der menschlichen Sprache hervor. Der Bezug auf die Arbeiten von Merten, Maletzke und Weber unterstreicht den soziologischen Kontext der Betrachtung. Das Kapitel betont den Aspekt der Interaktion und legt eine Basis für die spätere Gegenüberstellung mit der computervermittelten Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kommunikation im Internet-Chat vs. Face-to-Face-Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen face-to-face-Kommunikation und Kommunikation im Internet-Chat. Sie analysiert die Bedeutung nonverbaler Kommunikation und den Einfluss computervermittelter Kommunikation auf das soziale Gefüge. Das "CaféKomm" in Münster dient als Fallbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich von face-to-face- und Chat-Kommunikation, Bedeutung nonverbaler Kommunikation, Analyse computervermittelter Kommunikation (cvK), Einfluss von cvK auf das soziale Gefüge und das CaféKomm als Beispiel für einen deutschsprachigen Chatraum. Es werden Kommunikationstheorien, insbesondere das Modell von Watzlawick, herangezogen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf einem Vergleich zwischen face-to-face-Kommunikation und Chat-Kommunikation. Sie verwendet das Kommunikationsmodell nach Watzlawick und analysiert Chat-Sequenzen aus dem CaféKomm, um die Theorien zu illustrieren. Die Autorin definiert „Kommunikation in Real Life (RL)“ und „Kommunikation in Virtual Life (VL)" und betont den realen Charakter der computervermittelten Kommunikation.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kommunikation in Real Life (mit Unterkapiteln zu allgemeinen Erläuterungen und dem Kommunikationsmodell nach Watzlawick), Kommunikation in Virtual Life (mit Unterkapiteln zum Internet und computervermittelter Kommunikation), Das CaféKomm (Münster) als Beispiel (mit Unterkapiteln zur Entwicklung und Besonderheiten), Der Internet Relay Chat im Vergleich zur face-to-face-Kommunikation (mit Unterkapiteln zu einer Chat-Sequenz, Theorien zur computervermittelten Kommunikation und Interpretation von Gesprächssequenzen) und Fazit.
Was ist das CaféKomm und warum wird es untersucht?
Das CaféKomm ist ein deutschsprachiger Internet Relay Chat in Münster. Er dient als Fallbeispiel, um die computervermittelte Kommunikation im Kontext der Arbeit zu veranschaulichen und zu analysieren. Die Untersuchung des CaféKomm ermöglicht einen konkreten Vergleich mit der face-to-face-Kommunikation.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Zentrale Forschungsfragen sind: Was unterscheidet face-to-face-Kommunikation von Chat-Kommunikation? Welche Gemeinsamkeiten bestehen? Warum nutzen junge Menschen verstärkt Chat-Kommunikation?
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Kommunikationstheorien, insbesondere das Kommunikationsmodell nach Watzlawick und weitere Ansätze von Merten, Maletzke und Weber. Diese Theorien werden zur Analyse der face-to-face- und computervermittelten Kommunikation herangezogen.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert, von der Einleitung, die die Forschungsfragen und den Ansatz beschreibt, bis hin zum Kapitel über die computervermittelte Kommunikation im Vergleich zur Face-to-Face Kommunikation, und schliesslich zum Fazit.
- Quote paper
- Kristin Auer (Author), 2002, Der Chatraum als Ort der Begegnung - Möglichkeiten und Grenzen virtueller Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17118