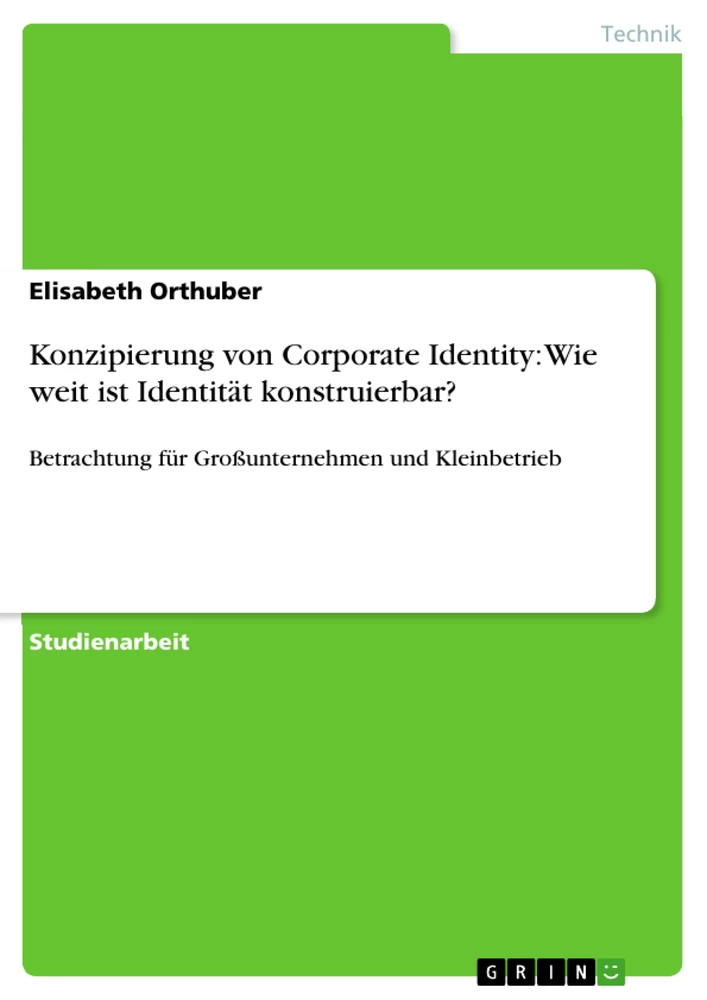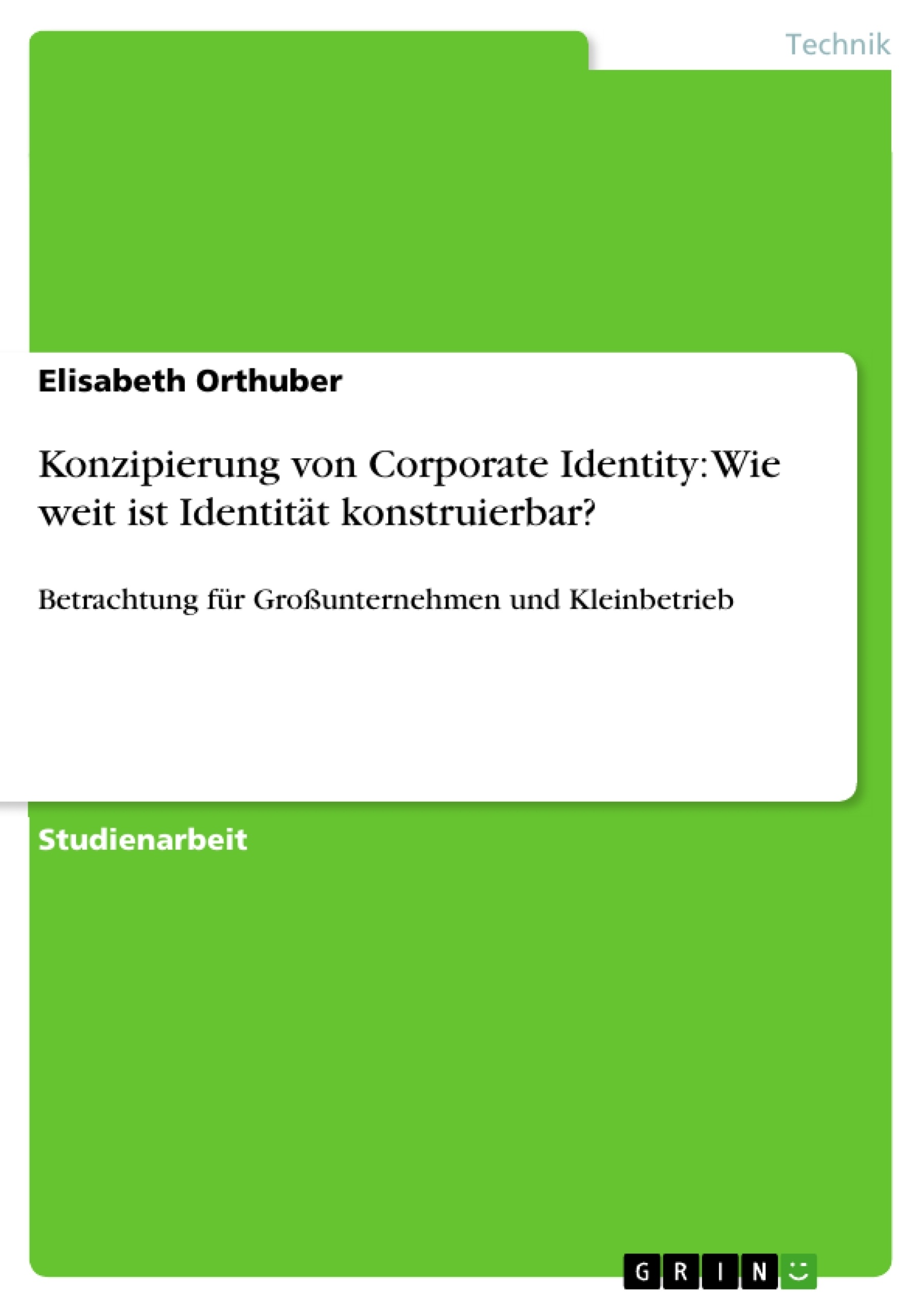Die Studienarbeit stellt das Thema Corporate Identity in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise dar, welche entgegen der Auffassung der breiten Masse nicht primär aus dem visuellen Erscheinungsbild entsteht, sondern eine aus komplexen unternehmensinternen Strukturen geschaffene und wenig greifbare individuelle Eigenschaft eines Unternehmens darstellt. Die Herausforderung bei CI-Konzeption ist, die aktuelle interne Situation richtig erfassen, wozu es notwendig ist, ihre Entstehung aufgrund der internen Faktoren zu verstehen. In dieser Arbeit wird insbesondere darauf eingegangen, inwiefern die zur CI-Entstehung beitragenden Unternehmensfaktoren von der Unternehmensgrösse beeinflusst sind. Enstsprechend ergibt sich für die spezifischen Unternehmen bei der Konzeption der Identität ein individueller Fokus auf die CI-Erfassung, -Modifikation oder -Kommunikation. Diese Arbeit unterstützt den Leser, den jeweilig notwendigen Schwerpunkt herauszufinden und zu begreifen, sowie den individuellen Fokus in der Anwendung zu erleichtern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Identitätssuche auf kollektiver Ebene
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. VERSTÄNDNIS VON CORPORATE IDENTITY
- 2.1. Corporate Identity - Greifbarmachen eines ungreifbaren Begriffs
- 2.1.1. Persönlichkeit, Identität & Selbstverständnis - oder das im „CI“
- 2.1.2. Wahrnehmung von Corporate Identity
- 2.1.2.1. Kommunikation als Basis aller Wahrnehmung
- 2.1.2.2. Corporate Identity im Laufe der Zeit – historische Entwicklung:
- 2.1.2.3. Selbstzweck von Cl als menschliches Identitätsbedürfnis einer Gruppe…
- 2.2. Die Bedeutung von Corporate Identity für ein Unternehmen
- 2.2.1. Interner Motivationsfaktor
- 2.2.2. Externe Rolle als Informationsfilter in der Gesellschaft
- 2.2.2.1. Image-Kreation
- 2.2.2.2. Schaffen von Vertrauen und Identifikation
- 2.3. Die Elemente von Cl
- 2.3.1. Corporate Communications
- 2.3.2. Corporate Behaviour
- 2.3.3. Corporate Design
- 3. ENTSTEHUNG VON CORPORATE IDENTITY
- 3.1. Voraussetzungen zur Profilierung von CI
- 3.1.1. Kollektive Identität durch Normatives Management
- 3.1.1.1. Ausgeprägte Unternehmenskultur
- 3.1.1.2. Formulierte und verankerte Vision
- 3.1.1.3. Mission
- 3.1.1.4. Leitbild
- 3.1.2. Intensive Kommunikation intern wie extern
- 3.1.3. Widerspruchsfreiheit: Harmonie der drei CI-Elemente
- 3.1.3.1. Branche, Produkte & Kundengruppen - Identifikation der Abnehmer
- 3.1.3.2. Organisationsstruktur
- 3.1.4. CI-Profilierung nach Unternehmensgröße
- 3.1.5.1. Identifikation der Einflussfaktoren
- 3.1.5.2. Ausprägung der Identitätsfaktoren je nach Unternehmensgröße
- 3.1.5.3. Unschärferelation von Deutlichkeit und Verankerung von Cl
- 3.2. Konzipierung von Corporate Identity
- 3.2.1. Steuerbare und beeinflussbare Identitätsfaktoren
- 3.2.2. Cl-Kampagnen, Projekte und Corporate Identity Management
- 3.2.3. Ein „How-To-Schema“ für Cl-Konzipierung
- 3.2.3.1. Die Basis schaffen
- 3.2.3.2. Analyse: Die aktuelle Unternehmenspersönlichkeit
- 3.2.3.3. Planung: Zielsetzung und CI Konzipierung
- 3.2.3.4. Umsetzung: Implementierung eines CI Konzepts
- 3.2.3.5. Kontrolle: Erfolgsbeurteilung
- 3.2.4. Fazit: Kritische Erfolgsfaktoren zur Cl-Konzipierung
- Wesen und Bedeutung von Corporate Identity
- Voraussetzungen zur Profilierung von Corporate Identity
- Konzipierung und Steuerung von Corporate Identity
- Einflussfaktoren der Unternehmensgröße auf Corporate Identity
- Umsetzbarkeit von Corporate Identity-Konzepten in unterschiedlichen Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studienarbeit befasst sich mit dem komplexen Thema Corporate Identity und untersucht dessen Bedeutung für Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung und Steuerung der Unternehmensidentität. Sie hinterfragt die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Profilierung von Corporate Identity und analysiert, inwieweit sie im Kontext unterschiedlicher Unternehmensgrößen konstruiert werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet zunächst das Verständnis von Corporate Identity, wobei die verschiedenen Interpretationen und historischen Entwicklungen des Begriffs beleuchtet werden. Sie betont die Wichtigkeit von Corporate Identity für die interne Motivation und die externe Wahrnehmung eines Unternehmens und analysiert die verschiedenen Elemente, die dazu beitragen. Im nächsten Abschnitt wird die Entstehung von Corporate Identity beleuchtet. Dabei werden die entscheidenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Profilierung erörtert, wie z.B. die Ausprägung der Unternehmenskultur, die Kommunikation intern und extern, die Widerspruchsfreiheit der CI-Elemente und der Einfluss der Branche, Produkte und Kundengruppen. Darüber hinaus wird die Frage der CI-Profilierung nach Unternehmensgröße untersucht, wobei die individuellen Ausprägungen und Herausforderungen in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Corporate Identity, Unternehmensidentität, Identitätskonstruktion, Profilierung, Unternehmensgröße, CI-Konzeption, CI-Management, Kommunikationsstrategie, Image-Kreation, Unternehmensvision, Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Corporate Identity (CI) laut dieser Arbeit?
Corporate Identity wird hier nicht primär als visuelles Design verstanden, sondern als eine aus komplexen internen Strukturen geschaffene, individuelle und wenig greifbare Eigenschaft eines Unternehmens.
Welche Rolle spielt die Unternehmensgröße bei der CI-Konzeption?
Die Arbeit untersucht, wie Unternehmensfaktoren von der Größe beeinflusst werden und wie sich daraus individuelle Schwerpunkte für die Erfassung, Modifikation oder Kommunikation der Identität ergeben.
Aus welchen Hauptelementen setzt sich CI zusammen?
Die drei klassischen Säulen der Corporate Identity sind laut Inhaltsverzeichnis Corporate Communications, Corporate Behaviour und Corporate Design.
Welche internen Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche CI-Profilierung nötig?
Wichtige Voraussetzungen sind ein normatives Management (Vision, Mission, Leitbild), eine ausgeprägte Unternehmenskultur sowie eine widerspruchsfreie Harmonie der CI-Elemente.
Wie sieht ein typisches Schema für die CI-Konzipierung aus?
Der Prozess folgt einem „How-To-Schema“ bestehend aus Basis schaffen, Analyse der Ist-Situation, Planung (Zielsetzung), Umsetzung (Implementierung) und abschließender Kontrolle.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Orthuber (Autor:in), 2011, Konzipierung von Corporate Identity: Wie weit ist Identität konstruierbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171226