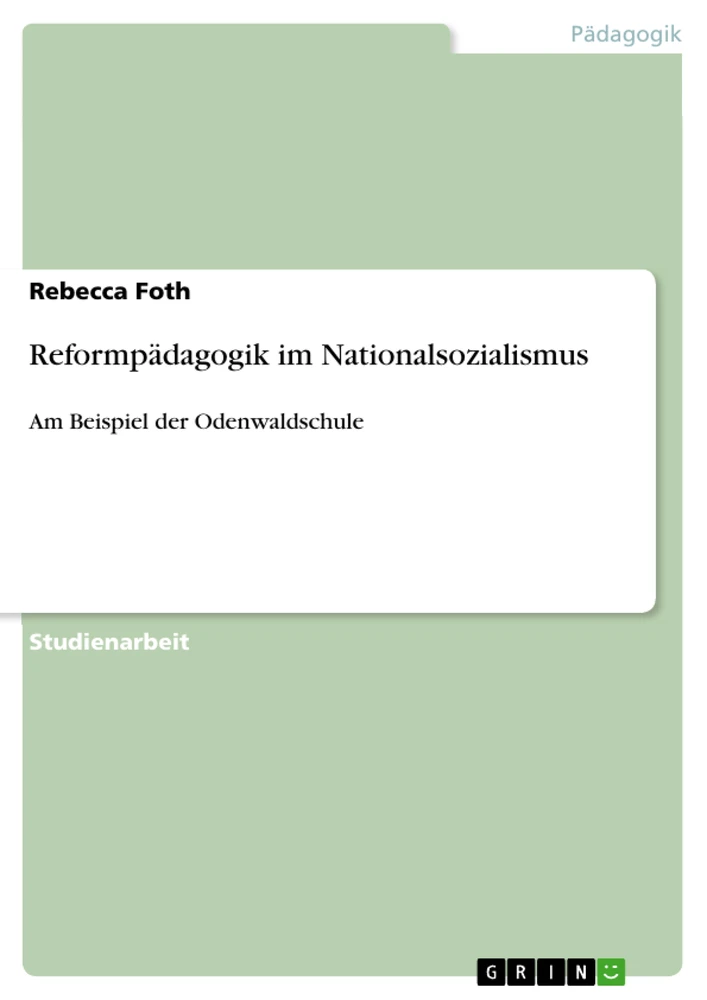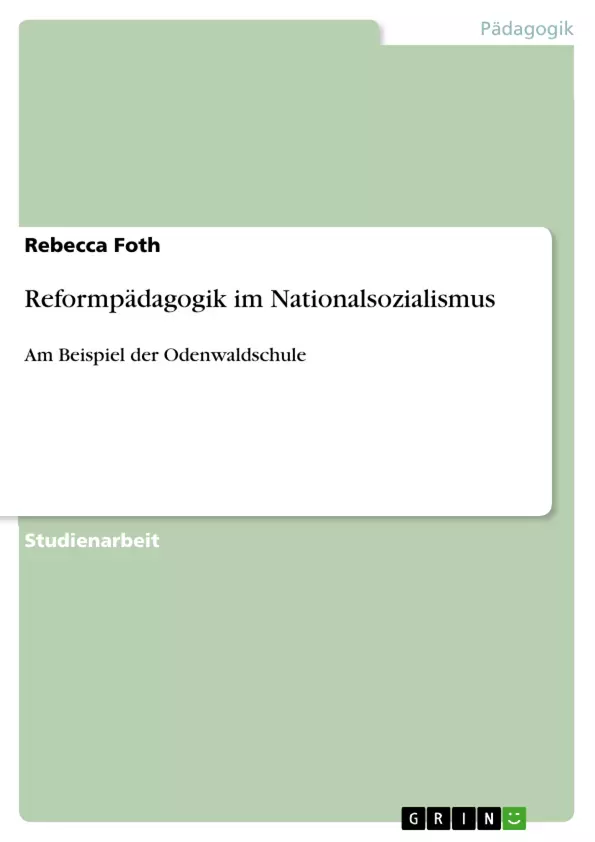Die 1910 gegründete Odenwaldschule zählte bereits 1920 zu den international
bekanntesten reformpädagogischen Schulen Deutschlands. Der
Begriff der Reformpädagogik konstituierte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts
und wird als eine Sammelbewegung zur Änderung von Erziehungsansätzen
in Schule und Unterricht beschrieben. Eine starke Beeinflussung
gab es mit anderen Bewegungen wie der Jugendbewegung, der
Arbeiter- und Frauenbewegung und dem „Wandervogel“. Als wichtigste
Zweige der Reformpädagogik etablierten sich in Deutschland die Arbeitsschule,
die Einheitsschule und die Landerziehungsheime. Auf letztere
möchte ich im Rahmen dieser Hausarbeit eingehen. Die Odenwaldschule
zählte neben den „Lietz-Schulen“ und der „Freien Schulgemeinde Wickersdorf“
zu der Landerziehungsheimbewegung. Diese Schule versuchte
sich, wie auch andere reformpädagogische Schulen, vom Staat zu lösen,
um allen sozialen Schichten eine freie und humanistische Bildung zu ermöglichen.
Daher musste sie zur Zeit des Nationalsozialismus in Konflikt
mit dem Regime geraten. In meiner Hausarbeit werde ich diesen Konflikt
näher erläutern und die in der Schule vorgenommenen Veränderungen
während dieser Zeit aufzeigen. Dabei ist es wichtig auf den Gründer dieser
Schule, ohne diesen es die Schule nicht gegeben hätte, näher einzugehen.
Das Pädagogische Konzept unter der Schulleitung Geheebs wird
im zweiten Kapitel behandelt. Dies ist notwendig, um die Anpassungen an
das NS-Regime einschätzen zu können. Der Nationalsozialismus hatte
auch auf Erziehung und Bildung einen verheerenden Einfluss. Das dritte
Kapitel versucht die Veränderungen, denen sowohl Schüler und Lehrer
unterworfen waren, darzulegen. Mit einem Fazit soll die Arbeit abschließen.
Aus Platzgründen wird in der Arbeit nicht auf die auf die Zeit der Reformpädagogik,
die Pädagogik im Nationalsozialismus im Allgemeinen und den
Aufbau der Odenwaldschule eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kurzbiografie Paul Geheeb
- 2 Das Pädagogische Konzept der „,alten“ Odenwaldschule
- 2.1 Koedukation
- 2.2 Das „Familiensystem“
- 2.3 Die,,Schulgemeinde“
- 2.4 Das „,offene Kurssystem“ und die Unterrichtsorganisation
- 3 Die Odenwaldschule im Nationalsozialismus
- 3.1 Die Odenwaldschule im Übergang 1933/34
- 3.1.1 Aufhebung der Koedukation und Erneuerung des Lehrerkollegiums
- 3.1.2 Abschaffung des „Wartesystems\" und Verbot der Schulschließung
- 3.1.3 Veränderungen im Unterrichtsablauf ab Herbst 1933
- 3.1.4 Die Gleichschaltung der Vereinigung der deutschen Landerziehungsheime
- 3.2 Die „Gemeinschaft der Odenwaldschule“
- 3.3 Die Jahre 1945/1946
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Einfluss des Nationalsozialismus auf die Odenwaldschule, eine der bekanntesten reformpädagogischen Schulen Deutschlands. Ziel ist es, den Konflikt zwischen dem reformpädagogischen Konzept der Schule und dem NS-Regime aufzuzeigen sowie die Veränderungen innerhalb der Schule während dieser Zeit zu beleuchten.
- Biographie und Pädagogisches Konzept von Paul Geheeb
- Die Odenwaldschule als Reformpädagogische Schule
- Die Odenwaldschule im Übergang 1933/34
- Die „Gemeinschaft der Odenwaldschule“ unter dem NS-Regime
- Die Odenwaldschule nach dem Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Diese Kapitel stellt Paul Geheeb, den Gründer der Odenwaldschule, vor und erläutert seine Biographie und seine pädagogischen Ideen.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet das pädagogische Konzept der Odenwaldschule vor der Machtergreifung der Nazis, insbesondere die Koedukation, das „Familiensystem“, die „Schulgemeinde“ und die Unterrichtsorganisation.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die Odenwaldschule unter dem NS-Regime. Es beleuchtet die Anpassungen an die NS-Ideologie und die Veränderungen in Bezug auf die Koedukation, das Lehrerkollegium und die Unterrichtsorganisation.
Schlüsselwörter
Reformpädagogik, Odenwaldschule, Paul Geheeb, Koedukation, Landerziehungsheim, Nationalsozialismus, Gleichschaltung, NS-Regime, „Familiensystem“, „Schulgemeinde“, Unterrichtsorganisation, Veränderungen, Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Odenwaldschule?
Sie war eine 1910 von Paul Geheeb gegründete reformpädagogische Schule, die als Landerziehungsheim internationale Bekanntheit erlangte.
Welche pädagogischen Prinzipien vertrat Paul Geheeb?
Zentral waren die Koedukation (gemeinsames Lernen von Jungen und Mädchen), das Familiensystem und die Selbstverwaltung in der Schulgemeinde.
Wie veränderte sich die Schule im Nationalsozialismus?
Die Schule wurde "gleichgeschaltet": Die Koedukation wurde aufgehoben, das Lehrerkollegium erneuert und der Unterricht an die NS-Ideologie angepasst.
Was passierte mit Paul Geheeb nach 1933?
Geheeb emigrierte 1934 in die Schweiz, um dort eine neue Schule (die Ecole d'Humanité) zu gründen, da er seine Ideale in Deutschland nicht mehr umsetzen konnte.
Was war das "Familiensystem" der Odenwaldschule?
Schüler und Lehrer lebten in kleinen, familienähnlichen Gruppen zusammen, was ein vertrauensvolles und ganzheitliches Lernen ermöglichen sollte.
- Quote paper
- Rebecca Foth (Author), 2009, Reformpädagogik im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171277