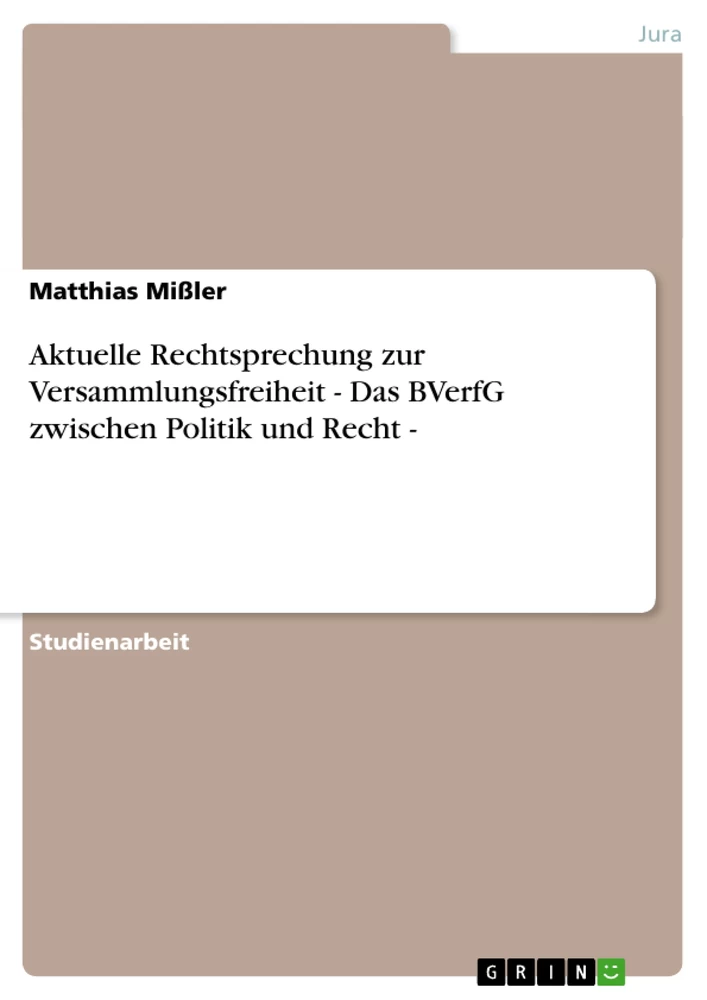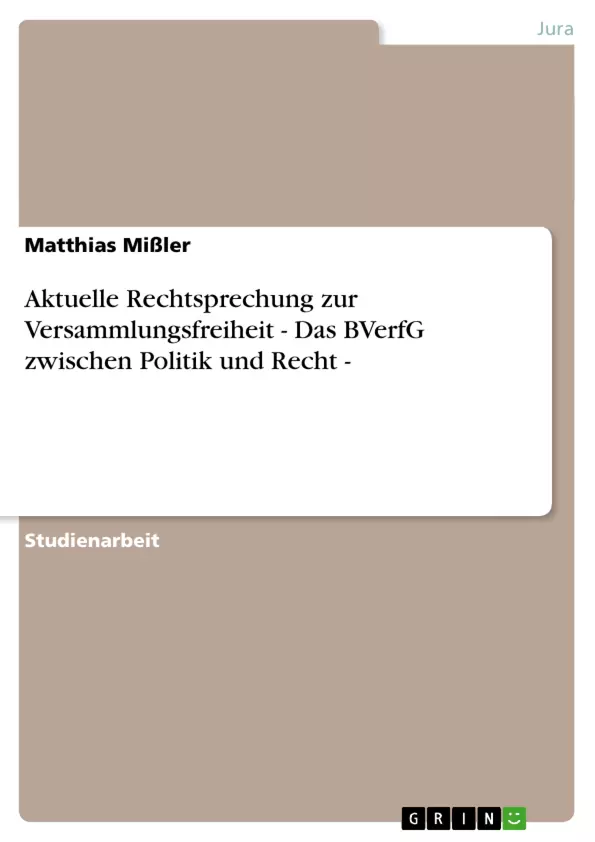Das Recht, sich gem. Art. 8 GG friedlich und ohne Waffen zur öffentlichen Diskussion zu versammeln, wird vom BVerfG als „wesentliches Element der demokratischen Offenheit“1 beschrieben. Denn eine pluralistische und demokratische Gesellschaft lebt von der argumentativen Auseinandersetzung zwischen ihren Bürgerinnen und Bürgern. Natürlich gehört in einer Demokratie, wie der unseren, ganz wesentlich und selbstverständlich die Möglichkeit dazu, dies in der Form einer gemeinschaftlichen Bekundung des politischen Willens tun zu dürfen.
Wer sind vor allem diejenigen, die sich am häufigsten auf dieses Recht berufen? Besonders sind es Gruppierungen, die sich in den Massenmedien oder durch parlamentarische Mehrheiten unterrepräsentiert fühlen. Sie versuchen durch Versammlungen und Aufzüge, für welche sich der Begriff „Demonstrationen“ eingebürgert hat, ihrem politischen Willen zur Wahrnehmung durch einen größeren Adressatenkreis zu verhelfen und die Dringlichkeit ihres Anliegens zu verdeutlichen. Desweiteren sind es Gruppierungen, die sich gegen das Auftreten, die Meinungen und die Verhaltensweisen anderer Kräfte und Gruppierungen wenden, welche nach ihrer Auffassung eine Gefahr für die eigenen Werte darstellen. Welche Ziele und Zwecke werden von den Demonstrierenden verfolgt? Sehr häufig besteht der Zweck einer Demonstration darin, ein Verlangen nach Handlung an staatliche Organe oder andere an der staatlichen Willensbildung beteiligten Akteure zu vermitteln. Teils sind es aber auch gesellschaftliche Akteure, die dazu aufgefordert werden sollen, ihre Positionen nochmals zu überdenken und im Idealfall zu ändern. Vor einer rechtlichen Herausforderung steht der Staat, wenn eine „tripolare Situation“2 zwischen den Akteuren besteht. In dem die in diesem Beispiel herangenommenen linken Demonstranten den Staat auffordern, für ihr Anliegen Partei zu ergreifen, bringen sie den Staat in eine verfassungsrechtliche Problemlage, da von ihm Neutralität gegenüber beiden Gruppierungen verlangt wird. Eine ähnliche problematische Situation stellt sich dar, wenn der Inhalt der Demonstration sich gegen die Verfassung richtet. Hier stellt sich ebenfalls in besonderer Schärfe die Frage, inwieweit der Staat zur Neutralität verpflichtet ist.
1 BverfGE 69, 315, 344 f.
2 Bull, Hans Peter: Grenzen des grundrechtlichen Schutzes für rechtsextremistische Demonstrationen. 2000, S. 8
Inhaltsverzeichnis
- Die Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 GG im Gefüge der Verfassung und der parlamentarischen Demokratie
- Bedeutung - Schutzbereich - Schranken des Grundrechts aus Art. 8 GG
- Die Bedeutung des Art. 8 GG anhand des Brokdorf-Beschlusses
- Schutzbereich des Art. 8 GG
- Eingriffe/Schranken
- Neuere Rechtsprechung des BVerfG zur Versammlungsfreiheit
- Einzelne Überlegungen zu speziellen Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Versammlungsfreiheit, insbesondere im Kontext von rechtsextremen Demonstrationen. Das Hauptziel ist es, die Bedeutung des Art. 8 GG als wesentliches Element der demokratischen Offenheit zu beleuchten und die Herausforderungen für das BVerfG aufzuzeigen, wenn es zwischen den Prinzipien der Versammlungsfreiheit und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abwägen muss.
- Die Bedeutung des Art. 8 GG als Funktionselement der freiheitlich demokratischen Grundordnung
- Die Herausforderungen der Abwägung zwischen Versammlungsfreiheit und öffentlichem Schutz
- Die Rechtsprechung des BVerfG in Bezug auf rechtsextreme Demonstrationen
- Die Rolle des Staates in Bezug auf Demonstrationen mit verfassungsfeindlichem Inhalt
- Die Anwendung des Versammlungsrechts im Kontext von rechtsextremistischen Demonstrationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Versammlungsfreiheit als wichtiges Element der demokratischen Offenheit. Hier wird die Funktionsweise des Art. 8 GG in der freiheitlich demokratischen Grundordnung erläutert und der Brokdorf-Beschluss als maßgebliche Rechtsprechung zum Schutzbereich des Grundrechts vorgestellt. Das zweite Kapitel behandelt die Schutzbereichs des Art. 8 GG, die Schranken des Grundrechts und die Anwendung des Gesetzesvorbehalts des Art. 8 II GG. Es wird auch auf die Einschränkungen nach §§ 14 und 15 VersG eingegangen. Das dritte Kapitel untersucht die aktuelle Rechtsprechung des BVerfG in Bezug auf die Versammlungsfreiheit. Es werden verschiedene Fälle von rechtsextremen Demonstrationen behandelt, die dem BVerfG vorlagen, und die Herausforderungen im Umgang mit solchen Demonstrationen beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich einzelnen Überlegungen zu speziellen Fragen, wie z.B. dem Wandel vom BannmG zum BefBezG und dem Eilrechtsschutz im Versammlungsrecht.
Schlüsselwörter
Versammlungsfreiheit, Art. 8 GG, Bundesverfassungsgericht, Rechtsextremismus, Demonstrationen, öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung, Brokdorf-Beschluss, Versammlungsrecht, Verfassungsschutz, Neutralitätspflicht des Staates, freiheitlich demokratische Grundordnung.
- Citation du texte
- Matthias Mißler (Auteur), 2003, Aktuelle Rechtsprechung zur Versammlungsfreiheit - Das BVerfG zwischen Politik und Recht -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17131