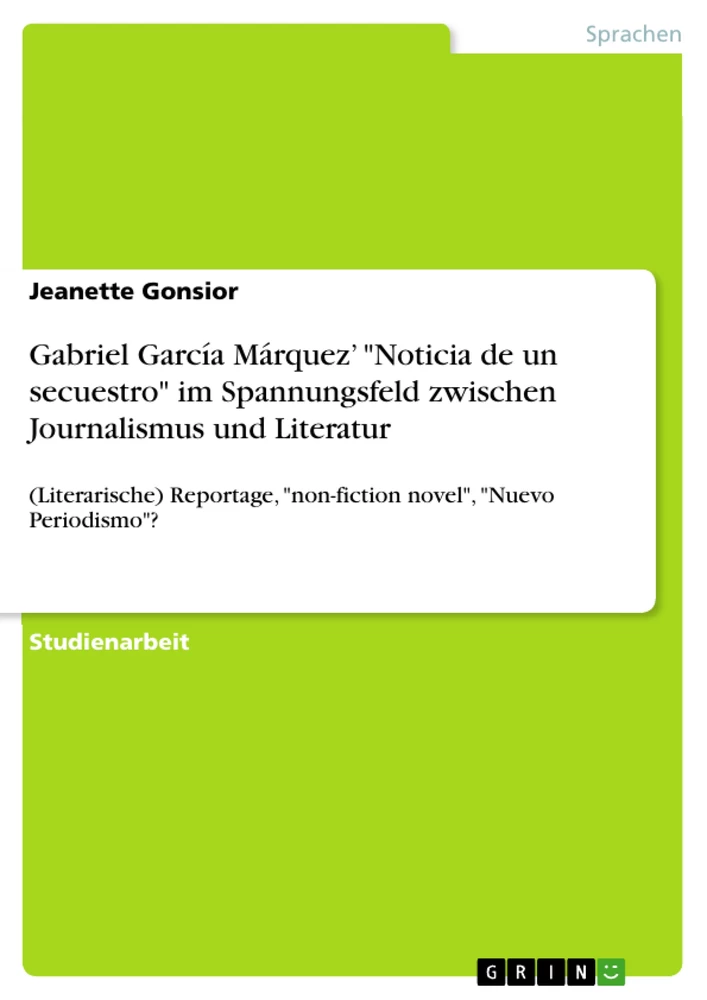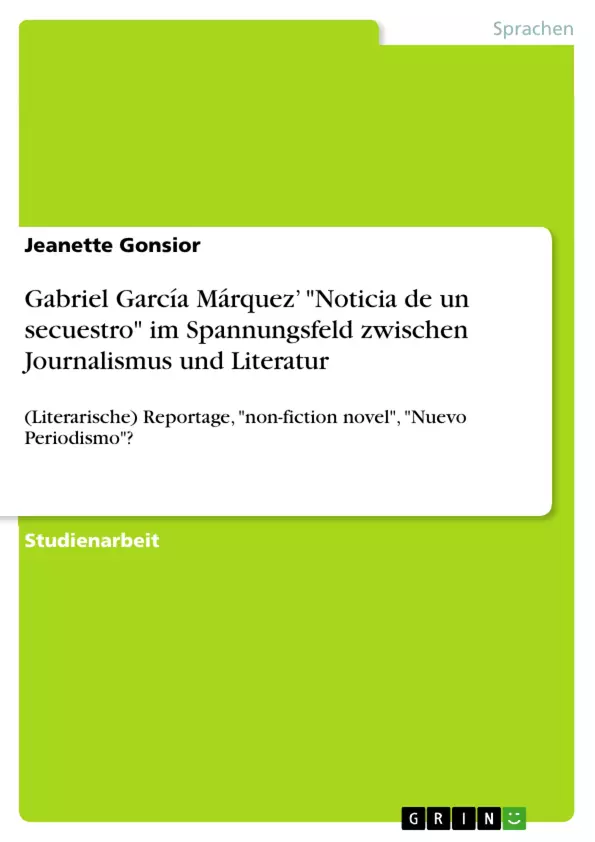Gabriel García Márquez‘ schriftstellerischen Wurzeln liegen im Journalismus: 1948 veröffentlichte er seine erste Kolumne unter dem Titel "Punto y aparte" in der kolumbianischen Tageszeitung "El Universal". Es folgte eine jahrelange Tätigkeit als Reporter und Auslandskorrespondent für diverse Zeitungen sowie als Korrespondent der kubanischen Presseagentur "Prensa Latina", bis ihm 1967 mit "Cien años de soledad" der literarische Durchbruch gelang. 1996 kehrt das Aushängeschild der lateinamerikanischen Boom-Generation erneut zu seinen journalistischen Wurzeln zurück und veröffentlicht mit "Noticia de un secuestro" eine genau recherchierte Rekonstruktion von realen Geiselnahmen durch die kolumbianische Drogenmafia unter Pablo Escobar zwischen August 1990 und Juni 1991. Diese versuchte, die Regierung unter Präsident César Gaviria Trujillo durch die Entführungen politisch unter Druck zu setzen.
(...)
Nichts habe er erfunden, Unstimmigkeiten mit den tatsächlichen Ereignissen sind entsprechend als Fehler zu verbuchen. Doch welchem Genre ist "Noticia de un secestro" zuzurechnen? Handelt es sich um eine "non-fiction novel" oder um eine (literarische) Reportage? Ist es ein journalistisches oder literarisches Werk? Oder eine hybride Form? Oder ist "Nachricht von einer Entführung" dem "New Journalism" zuzurechnen? Die vorliegende Hauptseminararbeit untersucht "Noticia de un secuestro" im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur und diskutiert die Gattungszugehörigkeit des Werks. Bezüglich der Einordung ergeben sich Problemstellungen auf unterschiedlichen Ebenen. Kapitel 3.1 nähert sich dem Genre der Reportage an und versucht, die literarische Reportage von der journalistischen abzugrenzen. Kapitel 3.2 befasst sich mit der sog. "new non-fiction", zu der die "non-fiction novel" und der "New Journalism" gezählt werden – beides Grenzgänger zwischen Literatur und Journalismus. In Kapitel 3.3 wird die Einteilung von Fakt und Fiktion und in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung von journalistischem und fiktionalem Schreiben problematisiert. Dabei werden besonders Hybridphänomene – Gattungen, die Fakten und Fiktionen vermischen – betrachtet und diskutiert. Ähnlichkeiten und Wechselbeziehungen zwischen der literarischen Reportage und der "non-fiction novel" (und dem "New Journalism") sollen aufgezeigt werden.
(...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftlicher und historischer Kontext: Violencia und Nueva Violencia in Kolumbien
- Die Geschichte Kolumbiens im 20. Jahrhundert
- Die Violencia (1948-58)
- Die Nueva Violencia
- Gattungstheoretische Betrachtung: Noticia de un secuestro im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur
- Annäherungen an das Genre der (literarischen) Reportage
- New non-fiction: New Journalism und non-fiction novel
- Fact-fiction "faction": Zur problematischen Unterscheidung zwischen Faktizität und Fiktion in journalistischen und literarischen Texten
- Fakt vs. Fiktion? Fiktionalisierung von Fakten durch narrative Modellierung?
- Factual status vs. factual adequacy...
- Noticia de un secuestro: Fakten oder Fiktion?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hauptseminararbeit untersucht Gabriel García Márquez' Noticia de un secuestro im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur. Sie befasst sich mit der Frage, inwieweit das Werk als journalistische Reportage, non-fiction novel oder hybride Form einzustufen ist. Dabei werden die gattungstheoretischen Aspekte des Werkes im Kontext der kolumbianischen Geschichte und der Violencia beleuchtet.
- Die Rolle des Journalismus im Werk von Gabriel García Márquez
- Die Violencia in Kolumbien und ihre Auswirkungen auf die Literatur
- Die gattungstheoretischen Herausforderungen bei der Einordnung von Noticia de un secuestro
- Die Verbindung von Fakten und Fiktion in journalistischen und literarischen Texten
- Die Bedeutung von Hybridformen im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet García Márquez' journalistische Wurzeln und die Entstehung von Noticia de un secuestro. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor, die sich mit der Gattungszugehörigkeit des Werkes befassen.
Das zweite Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen und historischen Kontext der Violencia in Kolumbien. Es untersucht die politischen und sozialen Konflikte, die zur Eskalation der Gewalt führten, sowie die Auswirkungen auf die Literatur.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der gattungstheoretischen Betrachtung von Noticia de un secuestro. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition der (literarischen) Reportage, des New Journalism und der non-fiction novel vorgestellt und diskutiert. Die problematische Unterscheidung zwischen Faktizität und Fiktion in journalistischen und literarischen Texten wird beleuchtet, um die Einordnung von Noticia de un secuestro im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur zu analysieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Journalismus, Literatur, Reportage, non-fiction novel, New Journalism, Violencia, Kolumbien, Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, Faktizität, Fiktion, Hybridform.
Häufig gestellte Fragen
Welchem Genre gehört „Noticia de un secuestro“ an?
Die Arbeit diskutiert, ob es sich um eine literarische Reportage, eine „Non-Fiction Novel“ oder ein Werk des „New Journalism“ handelt.
Welches reale Ereignis liegt dem Buch zugrunde?
Es rekonstruiert die Entführungen durch die kolumbianische Drogenmafia unter Pablo Escobar zwischen 1990 und 1991.
Was ist der historische Kontext der „Violencia“ in Kolumbien?
Die Violencia (1948-58) und die anschließende Nueva Violencia beschreiben Phasen extremer politischer und krimineller Gewalt in Kolumbien.
Wie verbindet Márquez Journalismus und Literatur?
Márquez nutzt seine Wurzeln als Reporter für eine exakte Recherche (Fakten), wendet aber narrative Techniken der Literatur zur Darstellung an.
Was ist das Besondere am „New Journalism“?
New Journalism nutzt literarische Mittel, um journalistische Fakten subjektiver und atmosphärisch dichter zu erzählen, ohne die Wahrheit zu verfälschen.
- Arbeit zitieren
- Jeanette Gonsior (Autor:in), 2011, Gabriel García Márquez’ "Noticia de un secuestro" im Spannungsfeld zwischen Journalismus und Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171310