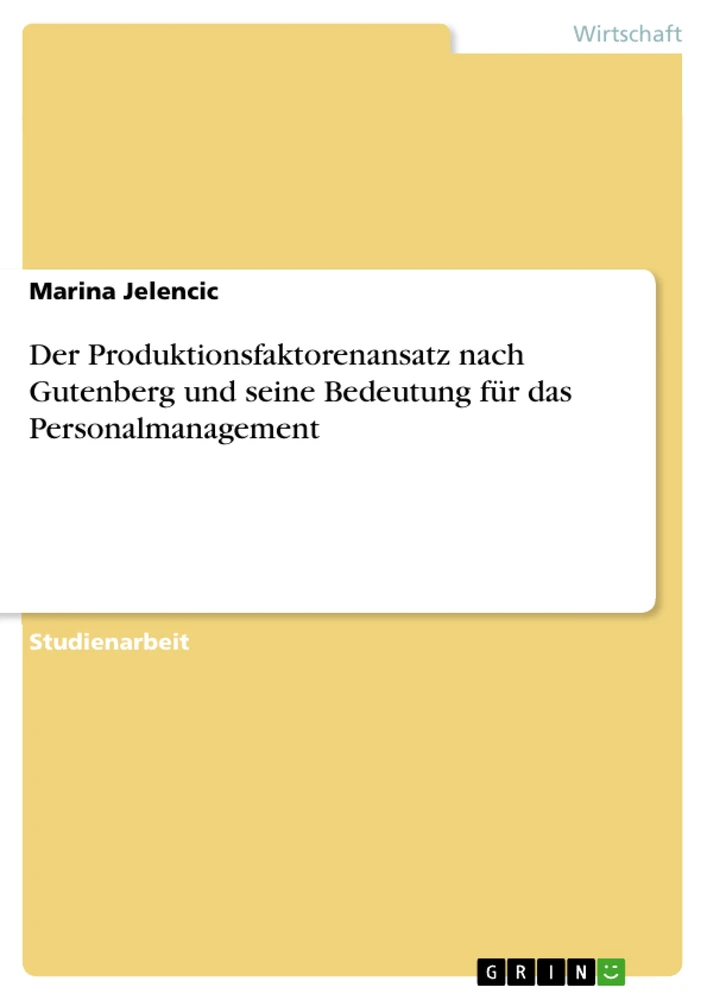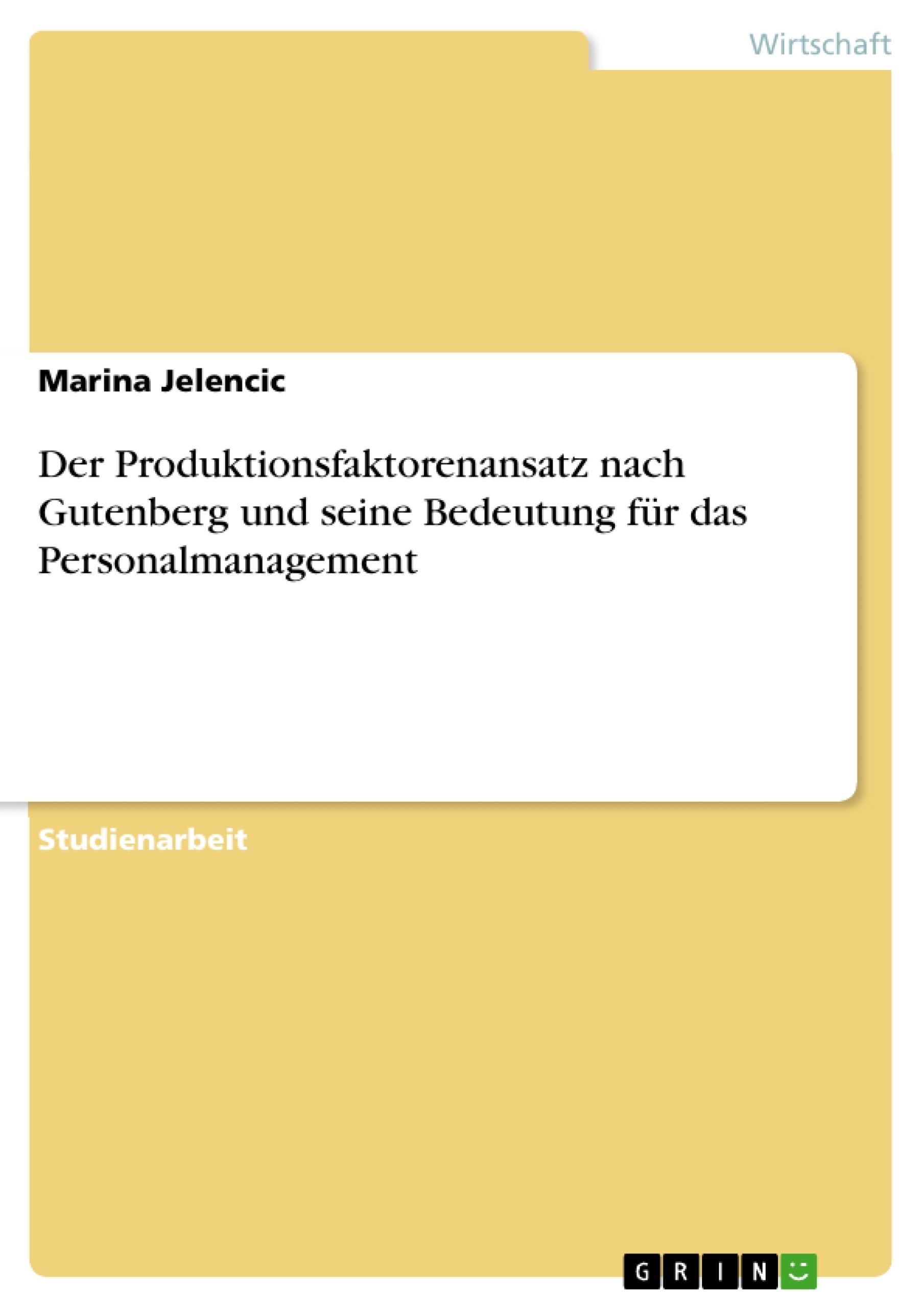In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entfachte eine lange politische Debatte über die Vorzüge eines landwirtschaftlichen bzw. marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems, aufgrund derer schließlich die „Soziale Marktwirtschaft“ im westlichen Teil Deutschlands eingeführt wurde. Dadurch wurde auch 1948 auf einer Fachtagung eine wissenschaftliche Diskussion um die zukünftige Ausrichtung der deutschen Betriebswirtschaftslehre entfacht.
Hier stand die Betriebswirtschaftslehre als „Wirtschaftlichkeitslehre der Unternehmung“ im Gegensatz zu einer „die Sach- und Sozialwelt des Unternehmens in gleicher Weise umfassenden Lehre“. Der Meinungsstreit um das „richtige“ Forschungskonzept wird im Grunde genommen noch heute geführt. Auf der einen Seite stehen die Anhänger einer erwerbswirtschaftlich ausgerichteten, an Effizienz und Rentabilität orientierten Betriebswirtschaftslehre, auf der anderen Seite die sozialwissenschaftlich geprägten Fachvertreter, die den Betrieb als spannungsreiches soziales Konstrukt begreifen, das größtenteils unter verhaltenswissenschaftlichen, soziologischen und psychologischen Aspekten zu untersuchen ist. Einer der wichtigsten Ansätze in diesem Bereich ist der produktivitätsorientierte Ansatz von Erich Gutenberg.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Geschichtliche Einordnung
- 2. Der Produktionsfaktoren-Ansatz
- 2.1. Die Elementarfaktoren
- 2.1.1. Die menschliche Arbeitskraft
- 2.1.2. Die Betriebsmittel
- 2.1.3. Die Werkstoffe
- 2.2. Die dispositiven Faktoren
- 2.2.1. Originärer Faktor: Die Geschäfts- und Betriebsleitung
- 2.2.2. Derivativer Faktor: Die Planung, Organisation und Kontrolle
- 2.1. Die Elementarfaktoren
- 3. Kritik und Bedeutung für das Personalmanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht Erich Gutenbergs Produktionsfaktoren-Ansatz und seine Relevanz für das Personalmanagement. Es beleuchtet die geschichtliche Einordnung des Ansatzes im Kontext der Nachkriegsentwicklung der Betriebswirtschaftslehre und analysiert die Kernkomponenten des Modells.
- Geschichtliche Entwicklung des Produktionsfaktoren-Ansatzes
- Die Unterscheidung zwischen Elementar- und dispositiven Faktoren
- Die Bedeutung der Produktivitätsbeziehung zwischen Input und Output
- Kritikpunkte am Gutenberg'schen Modell
- Implikationen für modernes Personalmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
1. Geschichtliche Einordnung: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Produktionsfaktoren-Ansatzes von Erich Gutenberg im Kontext der Nachkriegsdebatten um die Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland. Es zeigt den Gegensatz zwischen einer erwerbswirtschaftlich ausgerichteten und einer sozialwissenschaftlich geprägten Perspektive auf. Gutenberg wird als zentrale Figur im produktivitätsorientierten Ansatz positioniert, dessen Werk das ökonomische Denken einer Generation prägte. Der Fokus liegt auf der Abkehr von menschenzentrierten Modellen hin zu einem Modell, das den Kombinationsprozess von Produktionsfaktoren und die Produktivitätsbeziehung zwischen Input und Output in den Mittelpunkt stellt.
2. Der Produktionsfaktoren – Ansatz: Dieses Kapitel erläutert detailliert den Produktionsfaktoren-Ansatz nach Gutenberg. Es beschreibt Betriebe als Systeme produktiver Faktoren und analysiert die Bestimmungsfaktoren der Ergiebigkeit der eingesetzten Faktoren. Die Unterscheidung zwischen Elementarfaktoren (menschliche Arbeitskraft, Betriebsmittel, Werkstoffe) und dispositiven Faktoren (Geschäfts- und Betriebsleitung, Planung, Organisation und Kontrolle) wird im Detail dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des Verhältnisses zwischen Faktoreinsatz und Faktorertrag durch sinnvolle Kombination der Faktoren unter Berücksichtigung dispositiver Arbeit als eigenständiger Faktor.
Schlüsselwörter
Produktionsfaktoren, Erich Gutenberg, Betriebswirtschaftslehre, Elementarfaktoren, dispositive Faktoren, Produktivität, Input, Output, Personalmanagement, Soziale Marktwirtschaft, ökonomisches Denken.
Erich Gutenbergs Produktionsfaktoren-Ansatz: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Erich Gutenbergs Produktionsfaktoren-Ansatz. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Ansatzes und seiner Relevanz für das Personalmanagement.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: 1. Geschichtliche Einordnung, 2. Der Produktionsfaktoren-Ansatz (unterteilt in Elementarfaktoren und dispositive Faktoren) und 3. Kritik und Bedeutung für das Personalmanagement.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument untersucht Erich Gutenbergs Produktionsfaktoren-Ansatz und seine Bedeutung für das Personalmanagement. Es beleuchtet die historische Einordnung des Ansatzes, analysiert seine Kernkomponenten und diskutiert Kritikpunkte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: die geschichtliche Entwicklung des Produktionsfaktoren-Ansatzes, die Unterscheidung zwischen Elementar- und dispositiven Faktoren, die Bedeutung der Produktivitätsbeziehung zwischen Input und Output, Kritikpunkte am Gutenberg'schen Modell und die Implikationen für das moderne Personalmanagement.
Was sind Elementarfaktoren nach Gutenberg?
Nach Gutenberg gehören zur Gruppe der Elementarfaktoren die menschliche Arbeitskraft, die Betriebsmittel und die Werkstoffe. Diese Faktoren bilden die Grundlage des Produktionsprozesses.
Was sind dispositive Faktoren nach Gutenberg?
Zu den dispositiven Faktoren gehören die Geschäfts- und Betriebsleitung sowie die Planung, Organisation und Kontrolle. Sie steuern und koordinieren den Einsatz der Elementarfaktoren.
Welche Kritikpunkte werden am Gutenberg'schen Modell angesprochen?
Das Dokument erwähnt Kritikpunkte am Gutenberg'schen Modell, geht aber nicht im Detail darauf ein. Eine genauere Auseinandersetzung mit der Kritik findet im Kapitel 3 statt.
Welche Bedeutung hat der Ansatz für das Personalmanagement?
Die Bedeutung des Gutenberg'schen Ansatzes für das Personalmanagement wird im dritten Kapitel behandelt und untersucht die Implikationen des Modells für moderne Personalmanagementpraktiken.
Wie wird die geschichtliche Einordnung des Ansatzes dargestellt?
Die geschichtliche Einordnung beleuchtet die Entstehung des Ansatzes im Kontext der Nachkriegsdebatten in der Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und positioniert Gutenberg als zentrale Figur im produktivitätsorientierten Ansatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Ansatz am besten?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Produktionsfaktoren, Erich Gutenberg, Betriebswirtschaftslehre, Elementarfaktoren, dispositive Faktoren, Produktivität, Input, Output, Personalmanagement, Soziale Marktwirtschaft, ökonomisches Denken.
- Citation du texte
- Marina Jelencic (Auteur), 2010, Der Produktionsfaktorenansatz nach Gutenberg und seine Bedeutung für das Personalmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171357