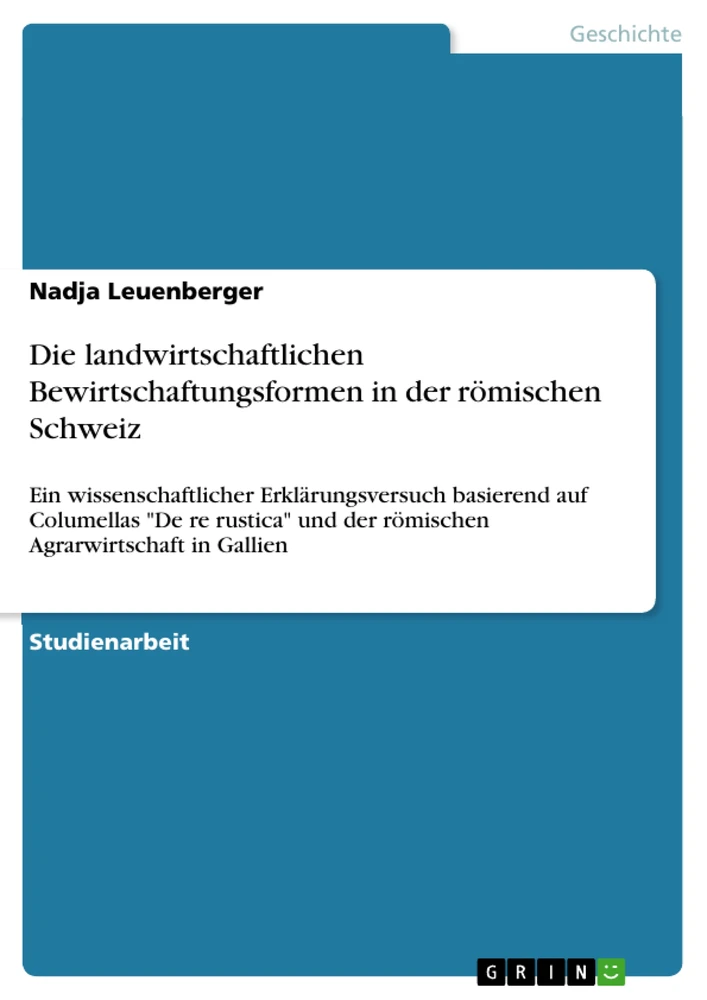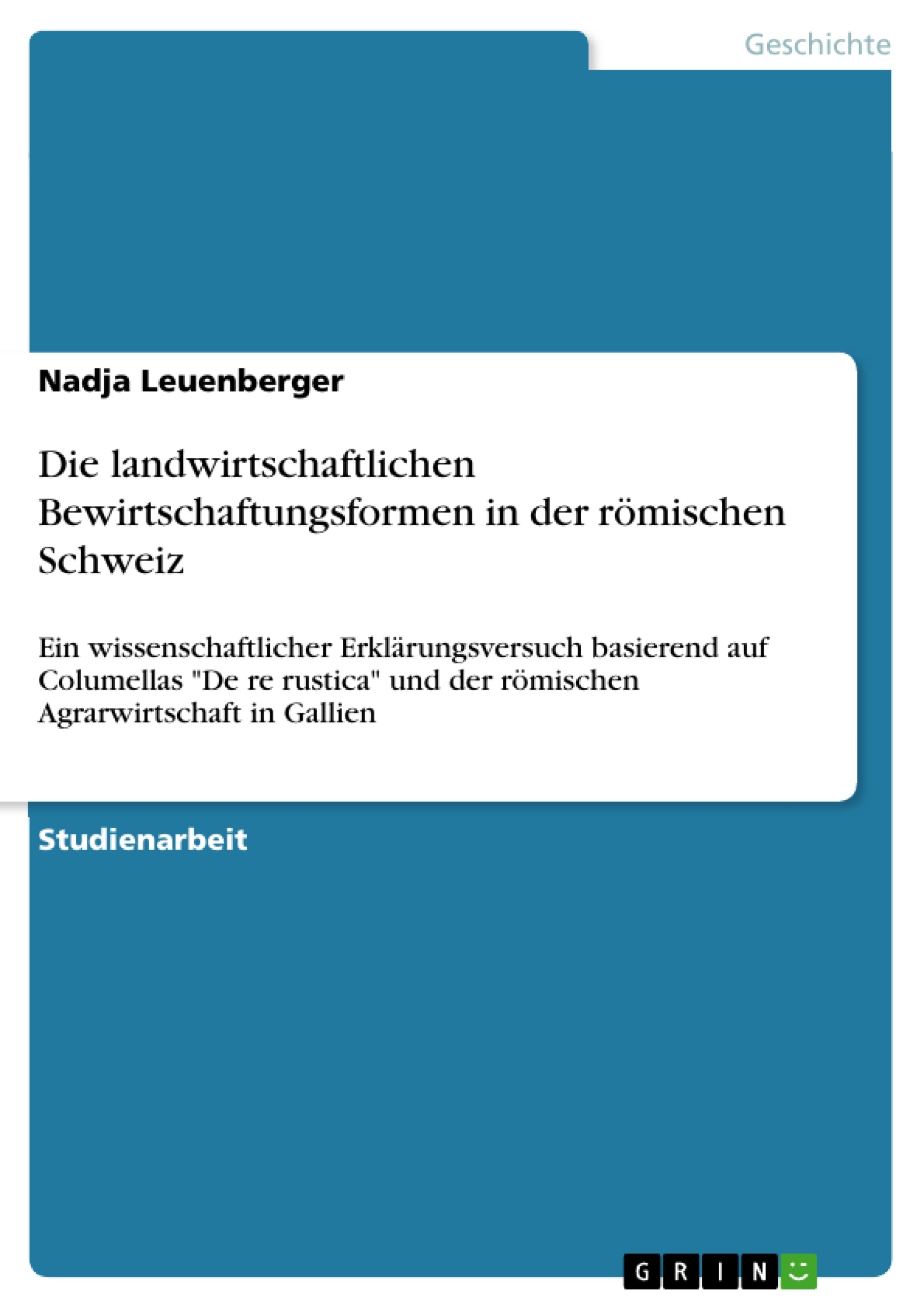Vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen in der römischen Schweiz. Im Zentrum steht die Frage nach der vorherrschenden Arbeitsorganisation. Da direkte Quellen zur Arbeitsorganisation für das Gebiet der heutigen Schweiz fehlen, soll aufgrund der Siedlungsstruktur, der Grösse der Villa und der Siedlungsdichte, sowie dem Grad der Romanisierung auf die Arbeitsorganisation geschlossen werden. Die Thematik wird von drei Seiten angegangen: Die Lage im Gebiet der heutigen Schweiz soll verglichen werden mit der Theorie Columellas und der landwirtschaftlichen Situation in Gallien.
Als Quelle dient das zwölfbändige Werk „De re rustica“ des römischen Agrarschriftstellers Columella, insbesondere die Passagen, die über die Arbeitsteilung auf einem landwirtschaftlichen Gut sowie die Wirtschaftlichkeit des Pachtwesens berichten.
Der Seminararbeit liegt die These zu Grunde, dass sich die landwirtschaftliche Situation Galliens unter römischer Herrschaft auf das Gebiet der römischen Schweiz übertragen lässt. Als Vergleichspunkte sollen das Siedlungsbild des ländlichen Galliens, die Entwicklung von der vorrömischen zur gallo-römischen Landwirtschaft und die Arbeitsorganisation dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Columella und die Arbeitsorganisation
- 1.1. Die verschiedenen Arbeitskräfte bei Columella
- 1.2. Anforderungen für das Funktionieren der Pachtwirtschaft
- 1.3. Von der Sklavenhaltung zum Kolonialsystem
- 2. Überblick über die Landwirtschaft in Gallien
- 2.1. Die gallo-römische Landwirtschaft
- 2.2. Die Romanisierung der gallischen Agrarwirtschaft
- 2.2.1. Die Entstehung der villa rustica
- 2.3. Die Arbeitsorganisation
- 3. Die Landwirtschaft in der römischen Schweiz
- 3.1. Die Romanisierung der heutigen Schweiz und die Folgen für die Landwirtschaft
- 3.2. Die villa rustica und ihre Entstehung
- 3.3. Das Siedlungsbild
- 3.4. Die Arbeitsorganisation
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen in der römischen Schweiz und konzentriert sich auf die Frage nach der vorherrschenden Arbeitsorganisation. Da direkte Quellen zur Arbeitsorganisation für das Gebiet der heutigen Schweiz fehlen, wird die Arbeitsorganisation anhand von Faktoren wie Siedlungsstruktur, Grösse der Villa, Siedlungsdichte und Romanisierungsgrad erschlossen. Die Analyse betrachtet die Situation in der Schweiz im Vergleich zur Theorie Columellas und der landwirtschaftlichen Situation in Gallien.
- Die Arbeitsorganisation auf landwirtschaftlichen Gütern in der römischen Schweiz
- Die Rolle von Columellas Werk „De re rustica“ für die Analyse der Arbeitsorganisation
- Vergleich der landwirtschaftlichen Situation in der Schweiz mit der in Gallien unter römischer Herrschaft
- Die Bedeutung der Villa rustica für die Organisation der Landwirtschaft
- Der Einfluss der Romanisierung auf die Landwirtschaft in der Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik vor und erläutert die Forschungsfrage sowie die methodische Vorgehensweise. Die wichtigsten Quellen und die These der Arbeit werden vorgestellt.
- 1. Columella und die Arbeitsorganisation: Dieses Kapitel analysiert das Werk von Columella „De re rustica“ im Hinblick auf die Arbeitsorganisation auf römischen Gutshöfen. Es werden die verschiedenen Arbeitskräfte, ihre Aufgaben und Rechte sowie die Herausforderungen der Pachtwirtschaft dargestellt.
- 2. Überblick über die Landwirtschaft in Gallien: Das Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Landwirtschaft in Gallien unter römischer Herrschaft. Es werden Themen wie die gallo-römische Landwirtschaft, die Romanisierung der Agrarwirtschaft, die Entstehung der Villa rustica und die Arbeitsorganisation in Gallien betrachtet.
- 3. Die Landwirtschaft in der römischen Schweiz: Dieses Kapitel untersucht die landwirtschaftliche Situation in der römischen Schweiz, indem es den Einfluss der Romanisierung auf die Landwirtschaft, die Entstehung der Villa rustica und das Siedlungsbild sowie die Arbeitsorganisation in der Schweiz analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der römischen Landwirtschaft, insbesondere der Arbeitsorganisation. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Columella, De re rustica, Villa rustica, Romanisierung, Sklavenhaltung, Pachtbauern, Siedlungsstruktur, Siedlungsdichte und die landwirtschaftliche Situation in Gallien und der Schweiz.
Häufig gestellte Fragen
Wie war die Landwirtschaft in der römischen Schweiz organisiert?
Die Organisation basierte maßgeblich auf Gutshöfen, sogenannten Villae Rusticae, wobei die Arbeitsorganisation oft durch Vergleiche mit Gallien erschlossen wird.
Welche Bedeutung hat Columella für dieses Thema?
Sein Werk „De re rustica“ liefert theoretische Einblicke in die antike Arbeitsteilung, Pachtwirtschaft und Sklavenhaltung auf römischen Landgütern.
Was ist eine Villa Rustica?
Eine Villa Rustica war ein ländlicher römischer Gutshof, der als Zentrum der landwirtschaftlichen Produktion und als Wohnsitz diente.
Inwiefern ähnelte die Situation in der Schweiz der in Gallien?
Die Arbeit vertritt die These, dass sich die gallo-römischen Bewirtschaftungsformen und Siedlungsstrukturen auf das Gebiet der heutigen Schweiz übertragen lassen.
Welche Rolle spielten Pachtbauern und Sklaven?
Die Arbeitskraft setzte sich aus Sklaven und freien Pachtbauern (Kolonen) zusammen, wobei ein Wandel von der Sklavenhaltung hin zum Kolonalsystem stattfand.
Wie beeinflusste die Romanisierung die Schweizer Agrarwirtschaft?
Die Romanisierung führte zur Einführung systematischer Anbaumethoden, neuer Gebäudetypen und einer stärkeren Einbindung in das römische Wirtschaftssystem.
- Arbeit zitieren
- Nadja Leuenberger (Autor:in), 2011, Die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen in der römischen Schweiz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171385