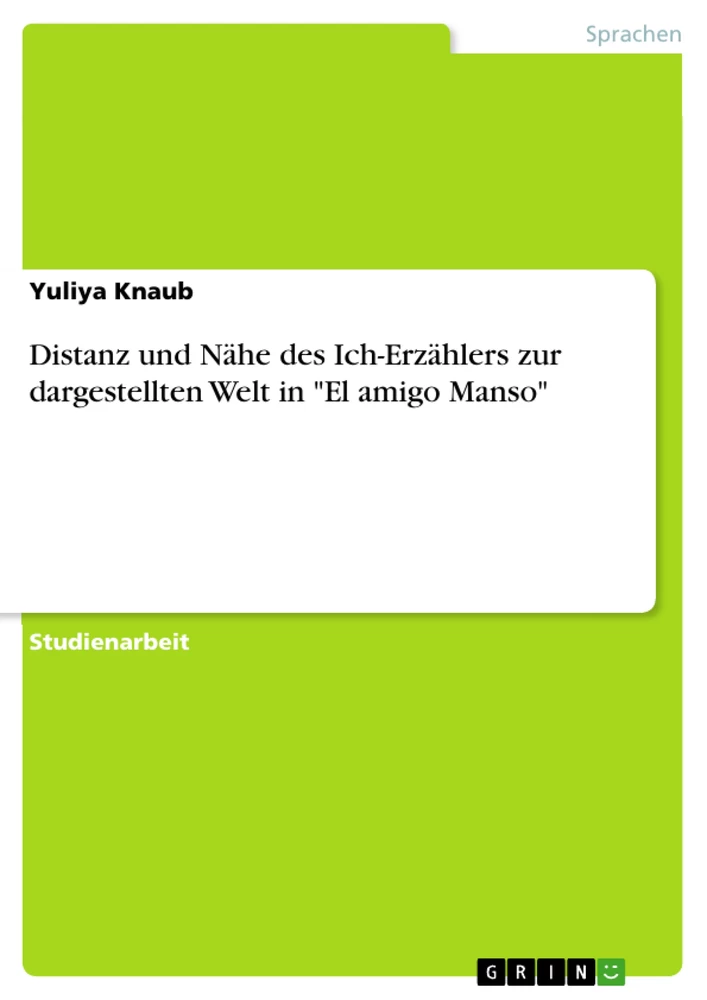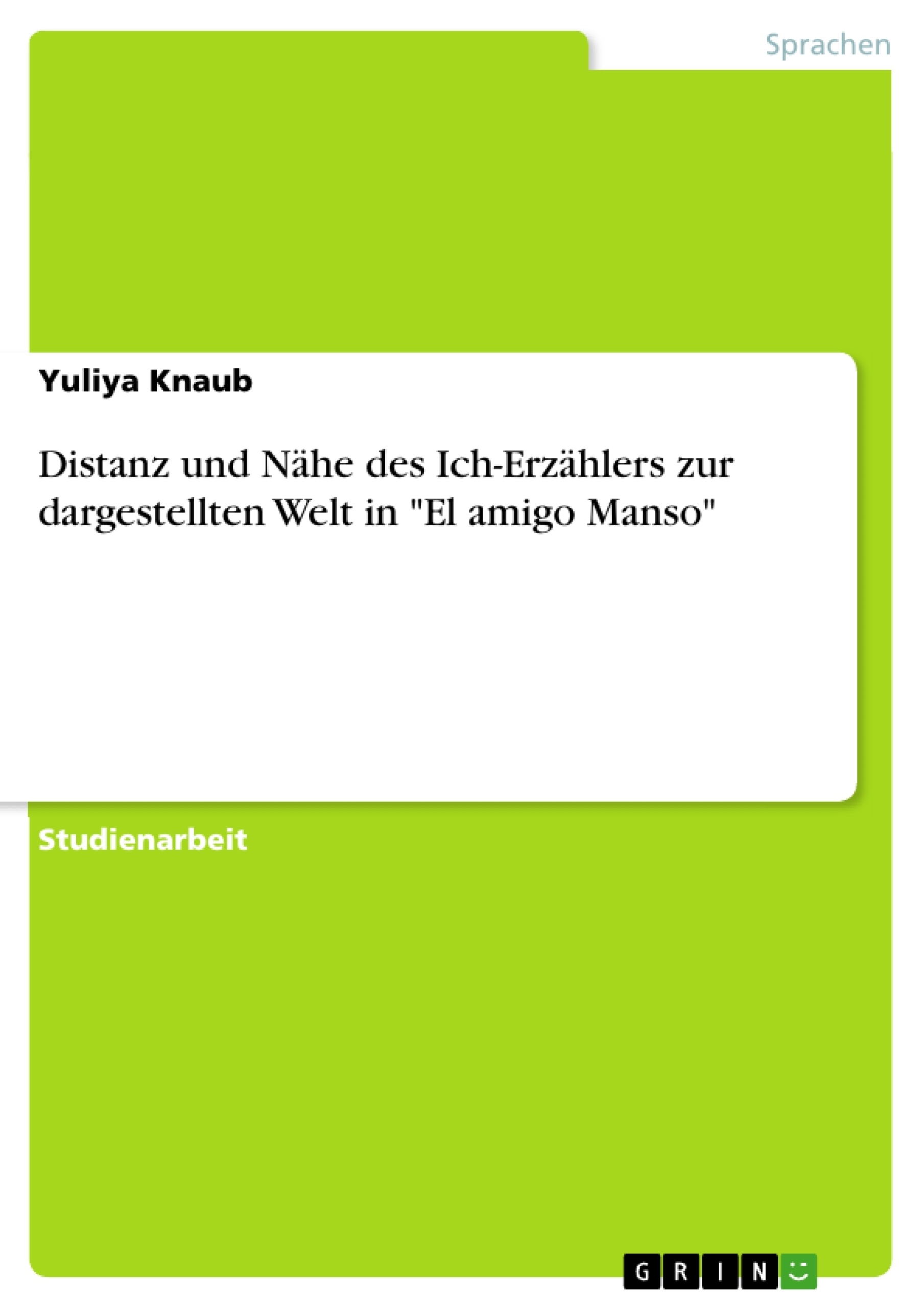Im Roman El Amigo Manso präsentiert uns Benito Pérez Galdós die Geschichte eines Philosophieprofessors, der ein zurückgezogenes Leben führt und sich für die äußere Welt nicht besonders interessiert. Ab dem gewissen Zeitpunkt ändert sich aber alles; und ab diesem Moment nähert er sich immer mehr der Gesellschaft. Die Distanz zwischen ihm und dem Lebensbereich hinter seiner Zimmertür verschwindet.
Das Thema dieser Hausarbeit impliziert die Beschreibung der Hauptfiguren des Romans, die im Mansos Leben eine wichtige Rolle spielten, und auch dazu beigetragen haben, dass der Betrachter zu einem Handelnden wurde.
Die Ausarbeitung des Themas möchte ich mit der Darstellung der drei hypothetischen Teile des Romans beginnen, die die Distanz beziehungsweise die Nähe der Hauptfigur zu der dargestellten Welt beschreiben.
Danach übergehe ich zu der ausführlichen Charakteristik von Manso, Irene, Peña, José María und Doña Cándida. Anhand von dieser Personenbeschreibung werde ich die Beziehungen zwischen ihnen und der Hauptfigur schildern, um zu zeigen, wie distanziert von der Realität seine Vorstellungen über die Welt und Menschen in seiner Umgebung am Anfang waren, und wie sich Mansos Meinung und Verhältnis im weiteren Verlauf des Romans verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINFÜHRUNG
- 2. DIE DREI WELTEN IM ROMAN EL AMIGO MANSO
- 2.1. Die Welt des Philosophen
- 2.2. Die Welt der Familie
- 2.3. Die Welt des Beobachters
- 3. MANSO - DIE HAUPTFIGUR DES ROMANS
- 4. IRENE
- 5. PEÑA
- 6. DER BRUDER JOSÉ MARÍA
- 7. DIE VERHASSTE DOÑA CANDIDA
- 8. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Beziehung des Ich-Erzählers, Maximo Manso, zur dargestellten Welt im Roman "El Amigo Manso" von Benito Pérez Galdós. Die Arbeit untersucht, wie sich Mansos Distanz und Nähe zur Gesellschaft im Laufe des Romans entwickeln und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflussen.
- Die drei Welten des Romans: Die Welt des Philosophen, die Welt der Familie und die Welt des Beobachters.
- Die Rolle des Ich-Erzählers als Beobachter und Handelnder.
- Die Beziehung Mansos zu den anderen Figuren im Roman, insbesondere zu Irene, Peña und José María.
- Die Entwicklung von Mansos Perspektive auf die Gesellschaft und seine eigene Rolle darin.
- Die Bedeutung der Fiktionalität und der Grenzen zwischen Realität und Fiktion im Roman.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Leser in die Welt des Philosophen Manso ein, der ein zurückgezogenes Leben führt und sich wenig für die Gesellschaft interessiert. Der zweite Abschnitt beleuchtet die Veränderung in Mansos Leben durch die Ankunft seines Bruders, der ihn in eine neue, dynamischere Welt einführt. Der dritte Teil schildert Mansos Transformation vom Beobachter zum Handelnden und seine spätere Rückkehr zum neutralen Beobachter nach seinem Tod.
Schlüsselwörter
Die Analyse konzentriert sich auf die Themen Distanz und Nähe, Ich-Erzähler, Beobachterrolle, Gesellschaft, Familie, fiktionale Welt, Realismus, "El Amigo Manso", Benito Pérez Galdós, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Roman „El amigo Manso“?
Der Roman von Benito Pérez Galdós erzählt die Geschichte des Philosophieprofessors Máximo Manso, der aus seiner isolierten Welt heraustritt und sich zunehmend der Gesellschaft nähert.
Welche „drei Welten“ werden im Roman unterschieden?
Die Arbeit unterteilt den Roman in die Welt des Philosophen (Isolation), die Welt der Familie (soziale Annäherung) und die Welt des Beobachters (Rückblick/Reflektion).
Wie verändert sich die Hauptfigur Máximo Manso?
Manso wandelt sich von einem distanzierten Theoretiker zu einem aktiv Handelnden, der tief in die Realität und die zwischenmenschlichen Beziehungen seiner Umgebung eintaucht.
Welche Rolle spielt die Figur Irene?
Irene ist eine zentrale Figur, durch die Manso erkennt, wie distanziert seine ursprünglichen Vorstellungen von der Realität waren, was zu einer schmerzhaften, aber wichtigen Bewusstseinsveränderung führt.
Was bedeutet „Distanz und Nähe“ in diesem Kontext?
Es beschreibt das Verhältnis des Ich-Erzählers zur Außenwelt – von der anfänglichen philosophischen Distanz bis zur emotionalen und sozialen Nähe im Verlauf der Handlung.
Ist „El amigo Manso“ ein realistischer Roman?
Ja, er gilt als Meisterwerk des spanischen Realismus, das jedoch meisterhaft mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion spielt, da Manso sich selbst als fiktionales Wesen einführt.
- Quote paper
- Yuliya Knaub (Author), 2008, Distanz und Nähe des Ich-Erzählers zur dargestellten Welt in "El amigo Manso", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171390