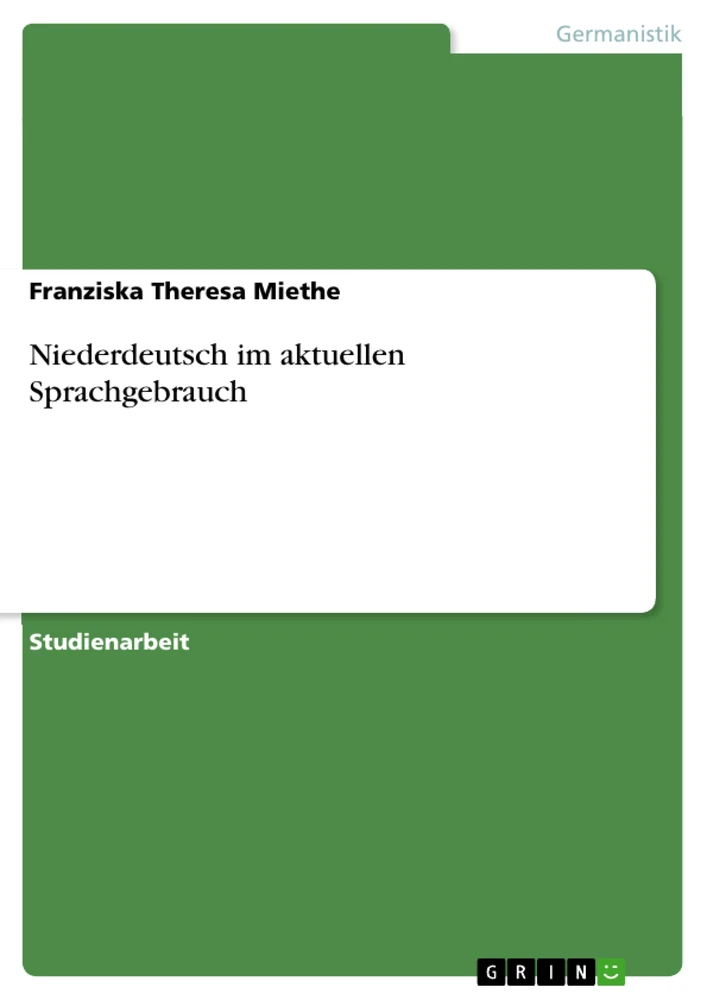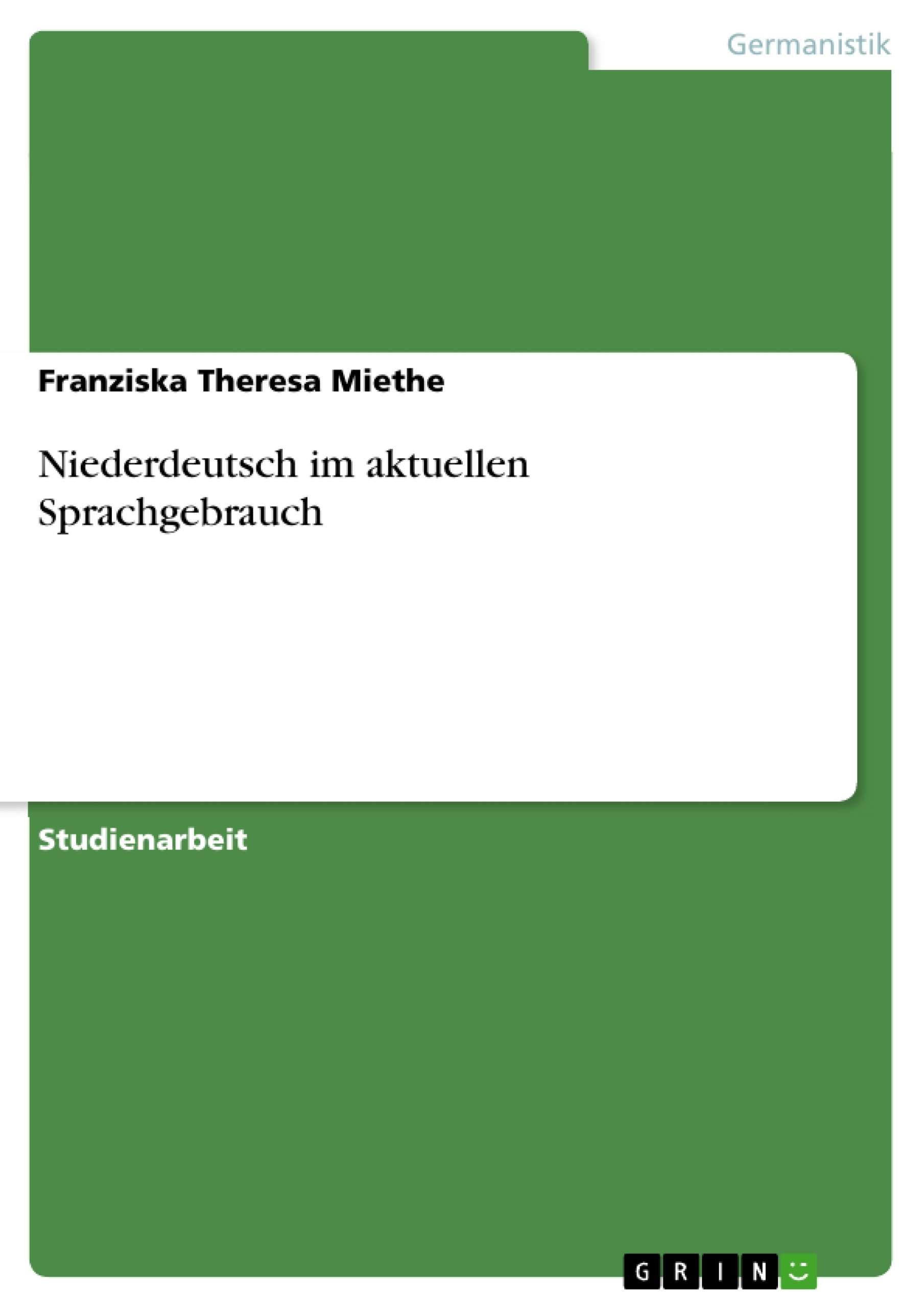Neben der hochdeutschen Sprache wurde das Niederdeutsche lange nicht gepflegt und wenig beachtet. Das liegt an der oft negativen Auffassung von Dialekten und der geringen Achtung, die den Menschen, die sie sprechen, entgegengebracht wird. Von Generation zu Generation gibt es dadurch immer weniger Menschen, die die niederdeutsche Sprache beherrschen.
Diese Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit überhaupt noch niederdeutsch gesprochen wird. Auch soll geklärt werden, in welcher Situation das Niederdeutsche dem Hochdeutschen vorgezogen wird.
Dabei soll es auch um das bestehende Vorurteil gehen, dass das Sprechen von Dialekten ein Zeichen für eine geringe Bildung sei.
Die verschiedenen Statistiken und Untersuchungen, die dazu herangezogen werden, beschäftigen sich größtenteils mit speziellen Orten oder größeren Gebieten.
Da hier aber der gesamte Sprachraum untersucht werden soll können die angegebenen Werte höchstens als Richtwerte gelten.
Dazu habe ich eine eigene kleine Befragung in meinem Heimatdorf Velstove (Stadt Wolfsburg) durchgeführt, die sich aber nur auf einige spezielle Fragen konzentriert und so keineswegs als empirische Untersuchung gelten kann, da sie nur an Einzelpersonen durchgeführt wurde.
Sie dient nur dazu, auf einige spezielle Sachverhalte hinzuweisen und auf besondere Fragen genauer einzugehen.
Näher werde ich darauf in Punkt 3 eingehen, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, in welchen Situationen die niederdeutsche Sprache angewendet wird und wann ihr das Hochdeutsche vorgezogen wird.
Dabei hilft die Befragung, die Gründe für einige Tatsachen zu klären, die in statistischen Untersuchungen nicht berücksichtigt werden können.
Unter Punkt 4 wird dann untersucht, inwieweit die niederdeutsche Sprache (wieder) gepflegt wird und was zu ihrem Erhalt unternommen wird.
Dabei soll geklärt werden, wie weit tatsächlich ein Imagewandel stattgefunden hat, durch den das Niederdeutsche wieder mehr Beachtung findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wer spricht niederdeutsch?
- In welchen Situationen wird niederdeutsch gesprochen?
- Private Verwendung des Niederdeutschen
- Öffentliche Verwendung des Niederdeutschen
- Die Pflege der niederdeutschen Sprache als Kulturgut
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit das Niederdeutsche im aktuellen Sprachgebrauch noch eine Rolle spielt. Sie untersucht die Verwendung des Niederdeutschen in verschiedenen Situationen und analysiert die Gründe für den Rückgang der Sprachkompetenz. Zudem werden die Herausforderungen bei der Pflege des Niederdeutschen als Kulturgut beleuchtet.
- Der Rückgang der niederdeutschen Sprachkompetenz von Generation zu Generation
- Die Verwendung des Niederdeutschen in privaten und öffentlichen Situationen
- Die soziale Bewertung des Niederdeutschen und die damit verbundenen Vorurteile
- Die Bedeutung des Niederdeutschen als Kulturgut und die Herausforderungen bei seiner Pflege
- Die Rolle des Niederdeutschen als Sprachvarietät und seine Bedeutung als Bereicherung der deutschen Sprachlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den historischen Kontext des Niederdeutschen. Es wird auf die oft negative Wahrnehmung von Dialekten und den damit verbundenen Rückgang der Sprachkompetenz eingegangen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wer heute noch niederdeutsch spricht. Es werden verschiedene Studien vorgestellt, die die niederdeutsche Sprachkompetenz in unterschiedlichen Altersgruppen und Regionen untersuchen. Dabei wird deutlich, dass der Rückgang der aktiven Sprachkompetenz besonders in städtischen Gebieten stärker ausgeprägt ist als in ländlichen Regionen.
Das dritte Kapitel untersucht die Situationen, in denen das Niederdeutsche verwendet wird. Dabei wird zwischen der privaten und der öffentlichen Verwendung unterschieden. Das Kapitel zeigt, dass die private Verwendung des Niederdeutschen vor allem in ländlichen Gebieten und in geschlossenen Gemeinschaften erhalten geblieben ist.
Das vierte Kapitel widmet sich der Frage, inwieweit die niederdeutsche Sprache (wieder) gepflegt wird und was zu ihrem Erhalt unternommen wird. Dabei wird untersucht, ob es einen Imagewandel des Niederdeutschen gibt und wie das Niederdeutsche als Kulturgut bewahrt werden kann.
Schlüsselwörter
Niederdeutsch, Sprachgebrauch, Dialekt, Sprachkompetenz, Sprachwandel, Kulturgut, Image, soziale Bewertung, private Verwendung, öffentliche Verwendung, Sprachpflege.
Häufig gestellte Fragen
Wird heute noch aktiv Niederdeutsch gesprochen?
Ja, allerdings nimmt die Zahl der Sprecher von Generation zu Generation ab, wobei es vor allem in ländlichen Regionen noch als Alltagssprache existiert.
Ist das Sprechen von Dialekt ein Zeichen geringer Bildung?
Dies ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Die Arbeit untersucht diesen Imagewandel und betont, dass Dialekte eine kulturelle Bereicherung darstellen.
In welchen Situationen wird Niederdeutsch dem Hochdeutschen vorgezogen?
Niederdeutsch wird oft im privaten Umfeld, in der Familie oder in vertrauten Gemeinschaften genutzt, während Hochdeutsch die Sprache des öffentlichen Lebens ist.
Was wird für den Erhalt der niederdeutschen Sprache getan?
Es gibt verstärkte Bemühungen zur Sprachpflege als Kulturgut, etwa durch Vereine, regionale Projekte und eine bewusstere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.
Gibt es regionale Unterschiede in der Sprachkompetenz?
Ja, in städtischen Gebieten ist der Rückgang deutlich stärker ausgeprägt, während in Dörfern wie Velstove (Beispiel aus der Arbeit) noch Reste der aktiven Verwendung zu finden sind.
- Arbeit zitieren
- Franziska Theresa Miethe (Autor:in), 2008, Niederdeutsch im aktuellen Sprachgebrauch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171429