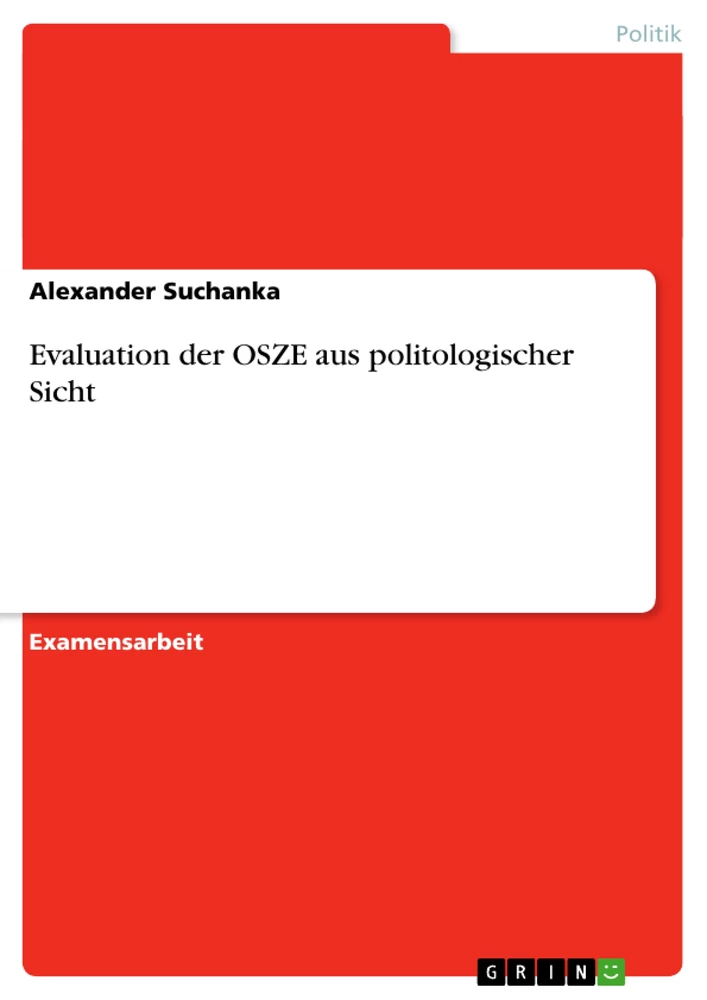Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, daß die gegenwärtige Sicherheitsarchitektur nicht in der Lage war diese Konflikte zu verhindern und auch die Beendigung der offenen kriegerischen Auseinandersetzungen in vielen Konflikten noch nicht zum angestrebten Ziel, einem dauerhaften Frieden, geführt hat.
Die OSZE verfolgt einen neuen sicherheitspolitischen Ansatz, die NATO hat sich gewandelt und auch die Europäische Union arbeitet an einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) um den Herausforderungen zu begegnen.
Die OSZE ist von all den genannten Organisationen die umfassendste und ist zudem als Nachfolgerin der KSZE noch mit einem sicherheitspolitischen Ansatz ausgestattet, der nach Auffassung vieler Autoren nicht unerheblich zur Überwindung des Kalten Kriegs beigetragen hat. Überdies wurden aufgrund der gemachten Erfahrungen der frühen 90er Jahre mehrere innovative Elemente zur Konfliktprävention und zum Krisenmanagement sowie zur Krisennachsorge innerhalb der OSZE entwickelt. Diese Instrumente und deren Einsatz sollen bei dieser Arbeit im Zentrum der Betrachtung stehen. Ihr Einsatz soll anhand ausgewählter Beispiele beschrieben werden und im Anschluß soll ihre Wirksamkeit in dem betreffenden Konflikt evaluiert werden.
Die Evaluation stellt jedoch ein grundsätzliches Problem dar. Bei den Instrumenten der OSZE handelt es sich im wesentlichen um Instrumente der Konfliktprävention, das heißt vereinfacht gesprochen, daß bei ihrer Wirksamkeit eben gerade nichts im Sinne kriegerischer Auseinandersetzungen geschieht. Natürlich wirft diese Situation sogleich die Frage nach dem "was wäre wenn" auf, die jedoch nur auf spekulativer Basis zu beantworten ist und angesichts der Fragestellung wenig hilfreich wäre. Um dennoch eine Bewertung zu ermöglichen, wird in dieser Analyse hauptsächlich auf die Berichte der OSZE selbst bzw. auf Berichte von Beteiligten zurückgegriffen, sowie auf Vorgänge, die sich unmittelbar auf OSZE-Aktivitäten zurückführen lassen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, daß es sich bei den Materialien zum Teil um Selbsteinschätzungen handelt, deren Objektivität man natürlich in Frage stellen kann. Allerdings liegen derzeit noch keine umfangreichen Fremdevaluationen vor. Daher soll anhand eben dieser Materialien ein Ansatz zur Evaluation der OSZE entwickelt werden, der ja teils auch durch handfeste Fakten angereichert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Kurze Historie - Von der Konferenz zur "Organisation"
- 1.2. Die Charta von Paris und die Neuorientierung
- 2. Erwartungen an die europäische Sicherheitsarchitektur
- 3. Die Entwicklung bzw. die aktuelle OSZE
- 3.1. Institutionen und Gremien
- 3.1.1. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs (Summits)
- 3.1.2. OSZE-Ministerrat (Ministerial Coucil)
- 3.1.3. Der Hohe Rat (Senior Council)
- 3.1.4. Der Ständige Rat (Permanent Council)
- 3.1.5. Der Amtierende Vorsitzende (Chairman-in-Office)
- 3.1.6. Der Generalsekretär und das Generalsekretariat (Secretary General and the Secretariat)
- 3.1.7. Das Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (Office for Democratic Institutions and Human Rights)
- 3.1.8. Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten (High Commissioner on National Minorities)
- 3.1.9. OSZE-Beauftragter für die Freiheit der Medien (Representive on Freedom of the Media)
- 3.1.10. Die parlamentarische Versammlung (Parliamentary Assembly)
- 3.1.11. Der OSZE-Vergleichs- und Schiedsgerichtshof (Court of Conciliation and Arbitration)
- 3.1.12. OSZE-Langzeitmissionen und andere Aktivitäten (Long-Term Missions and other Field Activities)
- 3.2. Weitere Institutionen und Mechanismen
- 3.3. Rechtliche Fragen
- 3.3.1. Rechtlicher Status der OSZE
- 3.3.2. Die OSZE als regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII der VN-Charta
- 3.3.3. Rechtlicher Status der OSZE-Dokumente
- 4. Finanzierung
- 5. Teilnehmer
- 6. Das umfassende kooperative Sicherheitskonzept der OSZE
- 7. Untersuchung der Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten der OSZE anhand der Tätigkeiten einzelner OSZE-Institutionen in ausgewählten Konflikten
- 7.1. Die OSZE-Langzeitmissionen
- 7.1.1. Die KSZE-Mission in das Kosovo, den Sandschak und die Vojvodina
- 7.1.2. Die Spillover Mission nach Skopje
- 7.1.3. Exkurs: Die OSZE und der Jugoslawienkonflikt
- 7.1.4. Die OSZE-Mission nach Bosnien-Herzegowina
- 7.1.5. Die OSZE-Mission in Estland
- 7.1.6. Die OSZE-Mission in Lettland
- 7.1.7. Die Kosovo Verifizierungs Mission
- 7.2. Zusammenfassung
- 7.3. Die Tätigkeit des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten
- 8. Die OSZE Konfliktlösungsmöglichkeiten und die Konfliktszenarien der nahen Zukunft
- 8.1. Konfliktszenarien
- 8.2. Die Konfliktlösungsmöglichkeiten der OSZE
- 8.2.1. Der Valetta Mechanismus
- 8.2.2. Der OSZE-Vergleichs- und Schiedsgerichtshof (Court of Conciliation and Arbitration) und die OSZE-Vergleichskommission
- 8.3. Anwendungsmöglichkeiten der Konfliktlösungmechanismen der OSZE
- 9. Analyse von Entwicklungen hinsichtlich der Verrechtlichung und Weiterentwicklung der OSZE
- 9.1. Die Position Rußlands zur OSZE in den 90er Jahren
- 9.2. Die Position der USA zur OSZE in den 90er Jahren
- 9.3. Die Position der BRD zur OSZE in den 90er Jahren
- 10. Fazit und Beurteilung der Entwicklung – Entwicklung einer eigenen Prognose
- 11. Literatur
- 12. Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus politologischer Sicht. Sie befasst sich mit der Entwicklung der OSZE seit ihrer Gründung als Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) bis hin zu ihrer aktuellen Rolle als umfassende Sicherheitsorganisation.
- Die Geschichte der OSZE und ihre institutionelle Entwicklung
- Die Rolle der OSZE in der Konfliktprävention und dem Krisenmanagement
- Die Wirksamkeit der OSZE-Instrumente in ausgewählten Konflikten
- Die Konfliktlösungsmöglichkeiten der OSZE und ihre Anwendung
- Die Positionierung verschiedener Staaten zur OSZE und ihre zukünftige Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung einer tragfähigen Sicherheitsarchitektur im europäischen Raum.
Kapitel 2 befasst sich mit den Erwartungen an die europäische Sicherheitsarchitektur im Kontext der Herausforderungen nach dem Kalten Krieg.
Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung und die aktuellen Strukturen der OSZE, einschließlich ihrer Institutionen, Gremien und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Kapitel 4 behandelt die Finanzierung der OSZE.
Kapitel 5 stellt die Teilnehmerstaaten der OSZE vor.
Kapitel 6 erläutert das umfassende kooperative Sicherheitskonzept der OSZE.
Kapitel 7 untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der OSZE anhand der Aktivitäten einzelner OSZE-Institutionen in ausgewählten Konflikten, wie z.B. im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina und in Estland.
Kapitel 8 analysiert die Konfliktlösungsmöglichkeiten der OSZE und die Konfliktszenarien der nahen Zukunft.
Kapitel 9 beleuchtet die Positionierung verschiedener Staaten zur OSZE, wie z.B. Russlands, der USA und der BRD, und die Entwicklungen hinsichtlich der Verrechtlichung und Weiterentwicklung der OSZE.
Schlüsselwörter
OSZE, KSZE, Sicherheit, Konfliktprävention, Krisenmanagement, Konfliktlösung, Europäische Sicherheitsarchitektur, Institutionen, Gremien, rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzierung, Teilnehmerstaaten, Russland, USA, BRD, Verrechtlichung, Weiterentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die OSZE und wie ist sie entstanden?
Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) ging aus der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) hervor und wandelte sich in den 90er Jahren zu einer permanenten Organisation.
Welche Instrumente nutzt die OSZE zur Konfliktprävention?
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Langzeitmissionen, der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten und der Beauftragte für die Freiheit der Medien.
In welchen Konflikten war die OSZE besonders aktiv?
Die Arbeit untersucht Einsätze im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina, Skopje (Nordmazedonien) sowie Missionen in Estland und Lettland.
Was ist das Problem bei der Evaluation von Konfliktprävention?
Es stellt sich die „Was-wäre-wenn-Frage“: Wenn Prävention erfolgreich ist, passiert nichts (kein Krieg), was statistisch schwer als direkter Erfolg der Maßnahmen zu beweisen ist.
Wie ist der rechtliche Status der OSZE-Dokumente?
Die Dokumente der OSZE sind politisch verbindlich, besitzen jedoch meist keinen völkerrechtlich bindenden Status im Sinne eines Vertrages.
Welche Rolle spielt der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten?
Er fungiert als Instrument der Frühwarnung, um Spannungen im Zusammenhang mit Minderheitenfragen zu identifizieren, bevor sie in offene Konflikte eskalieren.
- Arbeit zitieren
- Alexander Suchanka (Autor:in), 2000, Evaluation der OSZE aus politologischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171467