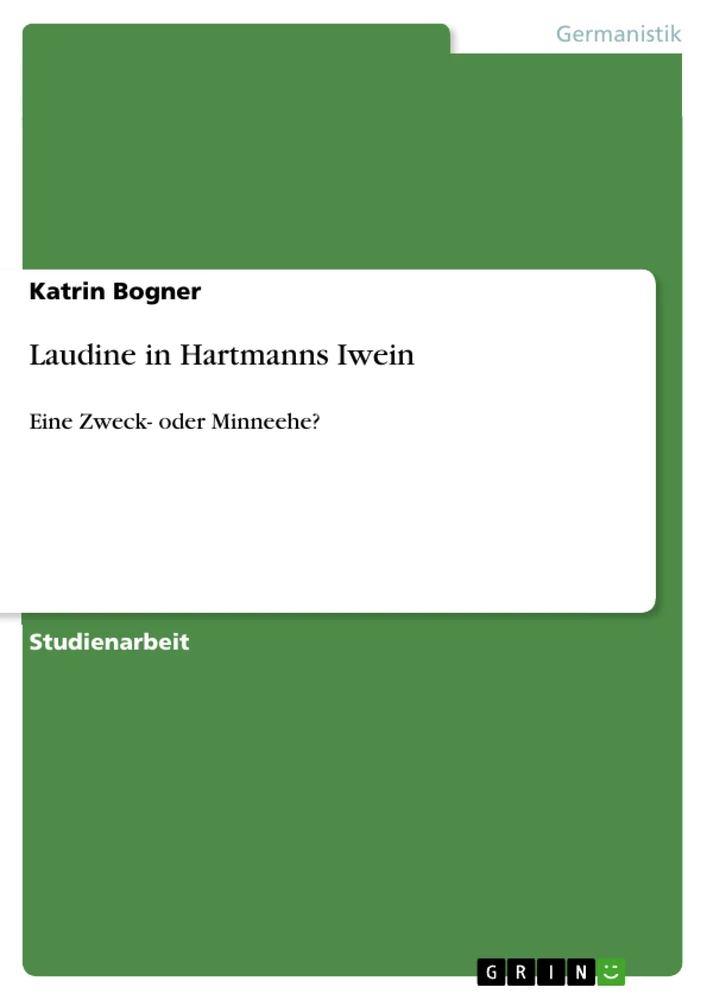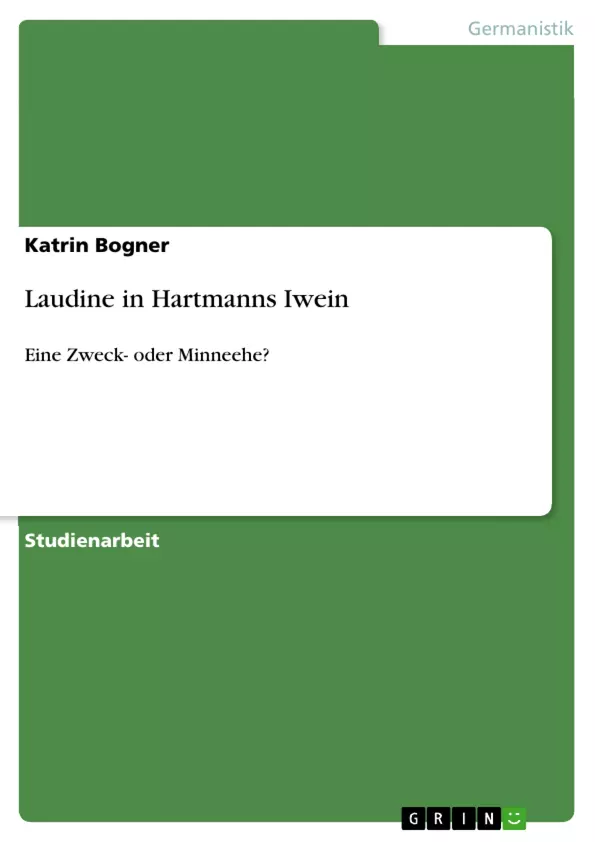„In keinem anderen höfischen Roman werden an derart exponierter Stelle, nämlich an der weiblichen Hauptgestalt, die politischen Zwänge, denen verwitwete Damen des Hochadels ausgesetzt waren, so realitätsnah vorgeführt wie im „Iwein“ des Hartmann von Aue.“ In der Tat waren die Witwen des Hochadels im Mittelalter dem Edikt unterworfen, ihr Leben gänzlich dem politischen Interesse ihres Landes unterzuordnen resp. auszurichten. Laudine in Hartmanns Iwein verkörpert eine Frauenfigur, die dem Zugzwang der damaligen Heiratspolitik unterliegt. Bereits nach kurzer Zeit nach dem Tod ihres Mannes Ascalon wird ihr von ihrer Zofe Lunete angeraten, erneut in den Stand der Ehe zu treten. Die daraufhin schnell erfolgende Heirat mit Ritter Iwein ist ein vielfach diskutiertes und interpretiertes Thema der Forschung. In dieser Arbeit richtet sich der Fokus auf die Frage, ob „Laudines Heiratsentschluss […] von kühler Berechnung eingegeben“ ist und die Königin Iwein allein aus politischen Gründen - im Sinne einer Zweckehe – zu ihrem Gatten erwählt. Oder aber kann doch von einer Minnehe gesprochen werden, die beide Protagonisten verbindet?
Hierzu wird zunächst dargelegt, wie die Heiratspolitik der höfischen Dame in der mittelalterlichen Literatur aufgegriffen resp. dargelegt wird. Im Anschluss daran folgt eine Durchleuchtung der Heiratspolitik Laudines, indem ihre Verhaltens- und Handlungsweisen analysiert und Anzeichen herausgearbeitet werden, die auf eine Zweck- resp. Minnehe schließen lassen. Die hierbei erarbeiteten Ergebnisse werden im nächsten Punkt diskutiert und gegeneinander abgewogen, wobei diverse Forschungsmeinungen ihre Berücksichtigung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Heiratspolitik der höfischen Damen in der mittelalterlichen Literatur
- Die Heiratspolitik Laudines - Zweck- oder Minneehe?
- Anzeichen für eine Zweckehe
- Anzeichen für eine Minnehe
- Diskussion unter in Bezugnahme diverser Forschermeinungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Heiratspolitik der höfischen Dame im Mittelalter, insbesondere im Kontext von Hartmanns "Iwein". Die Analyse der Heiratspolitik Laudines, der Witwe des Ascalon, steht im Mittelpunkt. Die Arbeit untersucht die Frage, ob Laudines Heiratsentscheidung mit Iwein aus politischen Gründen (Zweckehe) oder aus Liebe (Minnehe) resultiert.
- Heiratspolitik der höfischen Damen in der mittelalterlichen Literatur
- Laudines Heiratsentscheidung: Zweck- oder Minneehe?
- Analyse von Laudines Verhaltens- und Handlungsweisen
- Diskussion und Abwägung verschiedener Forschungsmeinungen
- Bedeutung von Minne und Politik in der Heiratspolitik der höfischen Damen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Heiratspolitik der höfischen Damen in der mittelalterlichen Literatur ein und präsentiert die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Analyse von Laudines Heiratsentscheidung in Hartmanns "Iwein".
Das zweite Kapitel beleuchtet die allgemeine Heiratspolitik der höfischen Damen in der Literatur. Es werden verschiedene Fallbeispiele aus mittelalterlichen Romanen vorgestellt, um die verschiedenen Aspekte und Motive der Heiratspolitik zu verdeutlichen.
Im dritten Kapitel wird Laudines Heiratspolitik unter die Lupe genommen. Die Verhaltens- und Handlungsweisen der Königin werden analysiert, um Anzeichen für eine Zweckehe oder eine Minneehe herauszuarbeiten.
Das vierte Kapitel dient der Diskussion der im dritten Kapitel erarbeiteten Ergebnisse und der Abwägung verschiedener Forschungsmeinungen. Es wird die Bedeutung der Minne und der Politik im Kontext von Laudines Heiratsentscheidung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Thema der Heiratspolitik der höfischen Damen im Mittelalter, insbesondere im Kontext von Hartmanns "Iwein". Zentrale Begriffe sind: Heiratspolitik, Minneehe, Zweckehe, Laudine, Hartmann von Aue, "Iwein", höfische Literatur, politische Zwänge, gesellschaftliche Normen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit über Laudine?
Die Arbeit untersucht, ob Laudines Entscheidung, Iwein zu heiraten, eine kühle politische Zweckehe oder eine auf Liebe basierende Minneehe war.
Welchen politischen Zwängen unterlagen Witwen im Mittelalter?
Witwen des Hochadels mussten ihr Leben und ihre Wiederverheiratung oft gänzlich den politischen Interessen ihres Landes unterordnen.
Welche Rolle spielt die Zofe Lunete in Hartmanns "Iwein"?
Lunete ist diejenige, die Laudine kurz nach dem Tod ihres Mannes Ascalon dazu rät, aus strategischen Gründen erneut zu heiraten.
Wie wird die Heiratspolitik in der höfischen Literatur dargestellt?
Die Literatur spiegelt die realitätsnahen Zwänge der Heiratspolitik wider, wobei oft zwischen gesellschaftlichen Normen und individuellen Gefühlen abgewogen wird.
Gibt es Anzeichen für eine Minneehe zwischen Laudine und Iwein?
Die Arbeit analysiert spezifische Verhaltensweisen und Textstellen, die darauf hindeuten könnten, dass trotz der politischen Notwendigkeit auch echte Zuneigung (Minne) eine Rolle spielte.
- Quote paper
- Katrin Bogner (Author), 2010, Laudine in Hartmanns Iwein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171481