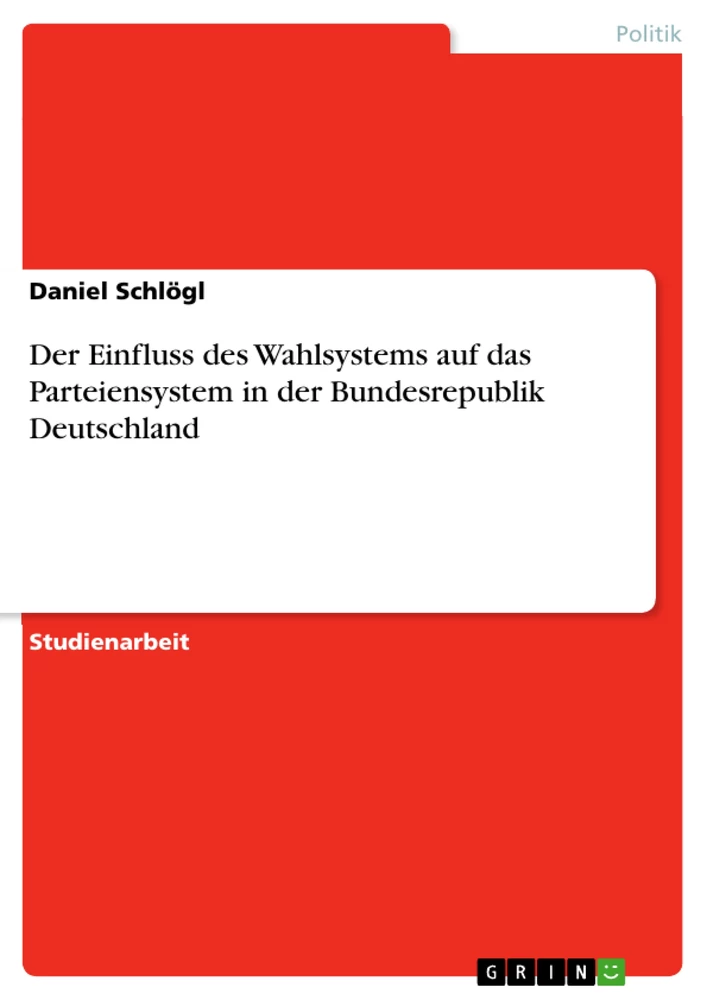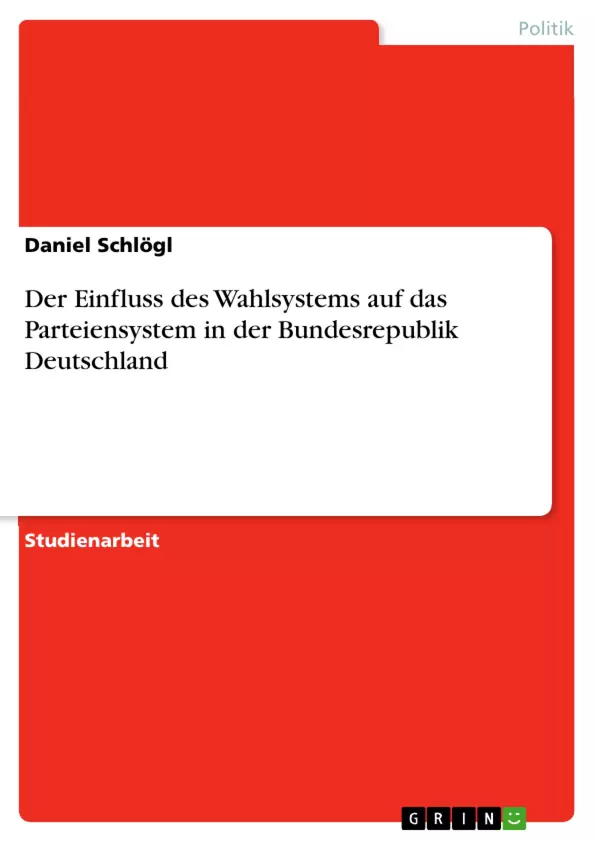Durch die Wahl des Bundestages hat der Bürger die Chance das politische Geschehen mitzugestalten. Mit der Abgabe seiner Stimme für die Partei bzw. für den Kandidaten erhofft sich der Bürger, dass seine Meinungen und Interessen im Bundestag bestmöglich vertreten werden. Dabei hat das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren Vorbildfunktion für andere westliche Staaten angenommen und besitzt eine beeindruckende Kontinuität in den letzten 50 Jahren (Behnke 2007: 5). Das Wahlsystem organisiert nicht nur den Ordnungsrahmen während der Wahl sowie die Verrechnung der Stimmenanteile auf die verfügbaren Sitze im Parlament. Vielmehr hat das Wahlsystem einer Nation gravierenden Einfluss auf das politische System und besonders auf die Entwicklung der Parteienlandschaft. Dies erkannte bereits der französische Politikwissenschaftler Maurice Duverger 1959 mit der Veröffentlichung der „Duverger‘schen Gesetze“ in denen der Zusammenhang zwischen Wahl- und Parteiensystem beschrieben wird (Duverger 1959: 219, zitiert nach: Baedermann 2006: 42). Die zugrundeliegende Fragestellung der Hausarbeit beschäftigt sich mit genau diesem Thema in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland: Hat das Wahlsystem wirklich einen so großen Einfluss auf die Entwicklung des Parteiensystems?
Zur Beantwortung dieser Frage werden zunächst in Kapitel 2 und 3 die Wahl- bzw. Parteiensysteme separat vorgestellt. Dabei wird in Kapitel 2.1 kurz auf den Begriff des Wahlsystems und dessen Funktionen eingegangen, bevor in Kapitel 2.2 verschiedene Typologien von Wahlsystemen nach Nohlen abgehandelt werden. Das Kapitel 2.3 stellt das Wahlsystem der Bundesrepublik in groben Zügen dar. Nach der Beschreibung des Wahlsystems, setzt sich die Hausarbeit in Kapitel 3 zunächst mit der Entstehung von Parteiensystemen (3.1) sowie mit den Parteiensystemeigenschaften nach Oskar Niedermayer auseinander. Nach der Beschreibung von Wahl- bzw. Parteiensystemen, widmet sich das vierte Kapitel letztendlich der Beantwortung der Frage, ob das Wahlsystem die Parteienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst. In Kapitel 5 wird eine kurze Zusammenfassung gegeben sowie ein Ausblick möglicher Entwicklungen des Wahlsystems beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wahlsysteme
- 2.1 Definition und Funktion von Wahlsystemen
- 2.2 Typologien von Wahlsystemen
- 2.3 Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland
- 3. Parteiensysteme
- 3.1 Entstehung von Parteiensystemen
- 3.2 Eigenschaften von Parteiensystemen
- 4. Einfluss des Wahlsystems auf das Parteiensystem in der BRD
- 4.1 „Gesetzmäßigkeiten“ des Zusammenhangs von Wahlsystem und Parteiensystem
- 4.2 Einfluss des Wahlsystems auf das Parteiensystem ab 1949
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Einfluss des Wahlsystems auf das Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Wahlsystem und Parteiensystem und beleuchtet, inwiefern das Wahlsystem die Entwicklung der Parteienlandschaft beeinflusst.
- Definition und Funktionen von Wahlsystemen
- Typologien von Wahlsystemen
- Entstehung und Eigenschaften von Parteiensystemen
- „Gesetzmäßigkeiten“ des Zusammenhangs von Wahlsystem und Parteiensystem
- Einfluss des Wahlsystems auf das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 definiert den Begriff des Wahlsystems und stellt dessen Funktionen vor. Es werden verschiedene Typologien von Wahlsystemen vorgestellt, bevor das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland näher betrachtet wird. Kapitel 3 befasst sich mit der Entstehung von Parteiensystemen und den Eigenschaften von Parteiensystemen nach Oskar Niedermayer. Kapitel 4 untersucht die Frage, ob das Wahlsystem die Parteienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst.
Schlüsselwörter
Wahlsystem, Parteiensystem, Bundesrepublik Deutschland, Repräsentation, Konzentration, Partizipation, Mehrheitswahl, Verhältniswahl, „Duverger‘sche Gesetze“, Parteiensystemeigenschaften.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das Wahlsystem auf die Parteienlandschaft?
Das Wahlsystem bestimmt maßgeblich mit, wie viele Parteien im Parlament vertreten sind und wie stabil die Regierungsbildung ist.
Was sind die „Duverger’schen Gesetze“?
Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen dem Wahlsystem (z. B. Mehrheitswahl) und der Anzahl der Parteien (z. B. Zweiparteiensystem).
Wie funktioniert das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland?
Es handelt sich um eine personalisierte Verhältniswahl, die Elemente der Personenwahl mit der Listenwahl kombiniert.
Was versteht man unter Repräsentation und Konzentration bei Wahlen?
Repräsentation zielt auf ein genaues Abbild des Wählerwillens ab, während Konzentration die Bildung stabiler Mehrheiten fördern soll.
Hat sich das deutsche Parteiensystem seit 1949 stark verändert?
Ja, die Arbeit untersucht die Entwicklung von einem konzentrierten System hin zu einer vielfältigeren Parteienlandschaft unter dem Einfluss des Wahlrechts.
- Quote paper
- Daniel Schlögl (Author), 2011, Der Einfluss des Wahlsystems auf das Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171506