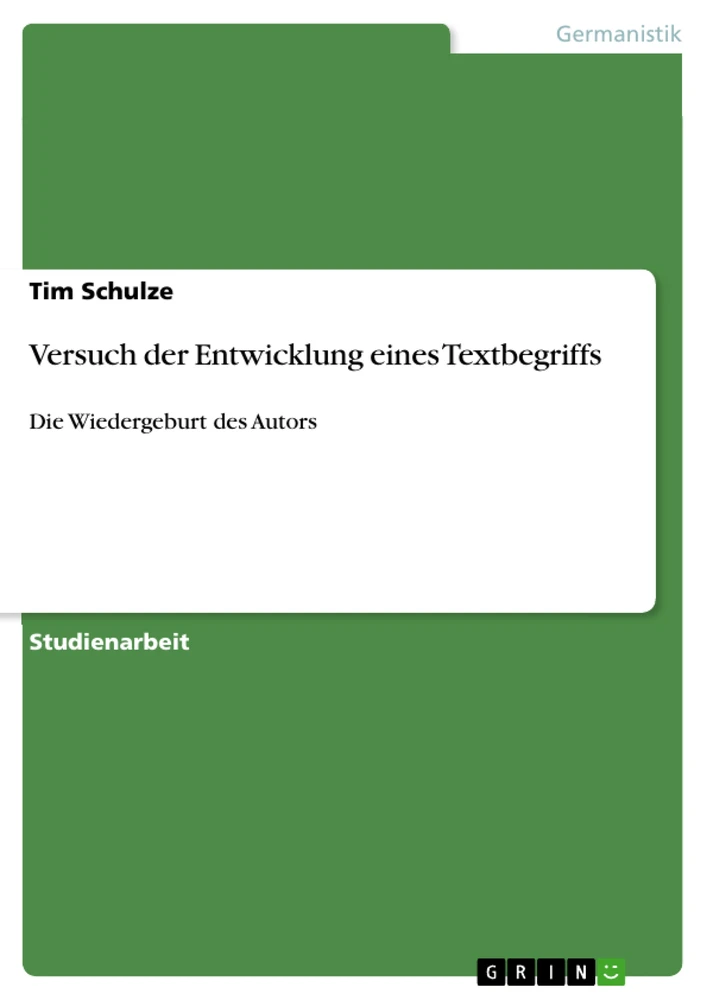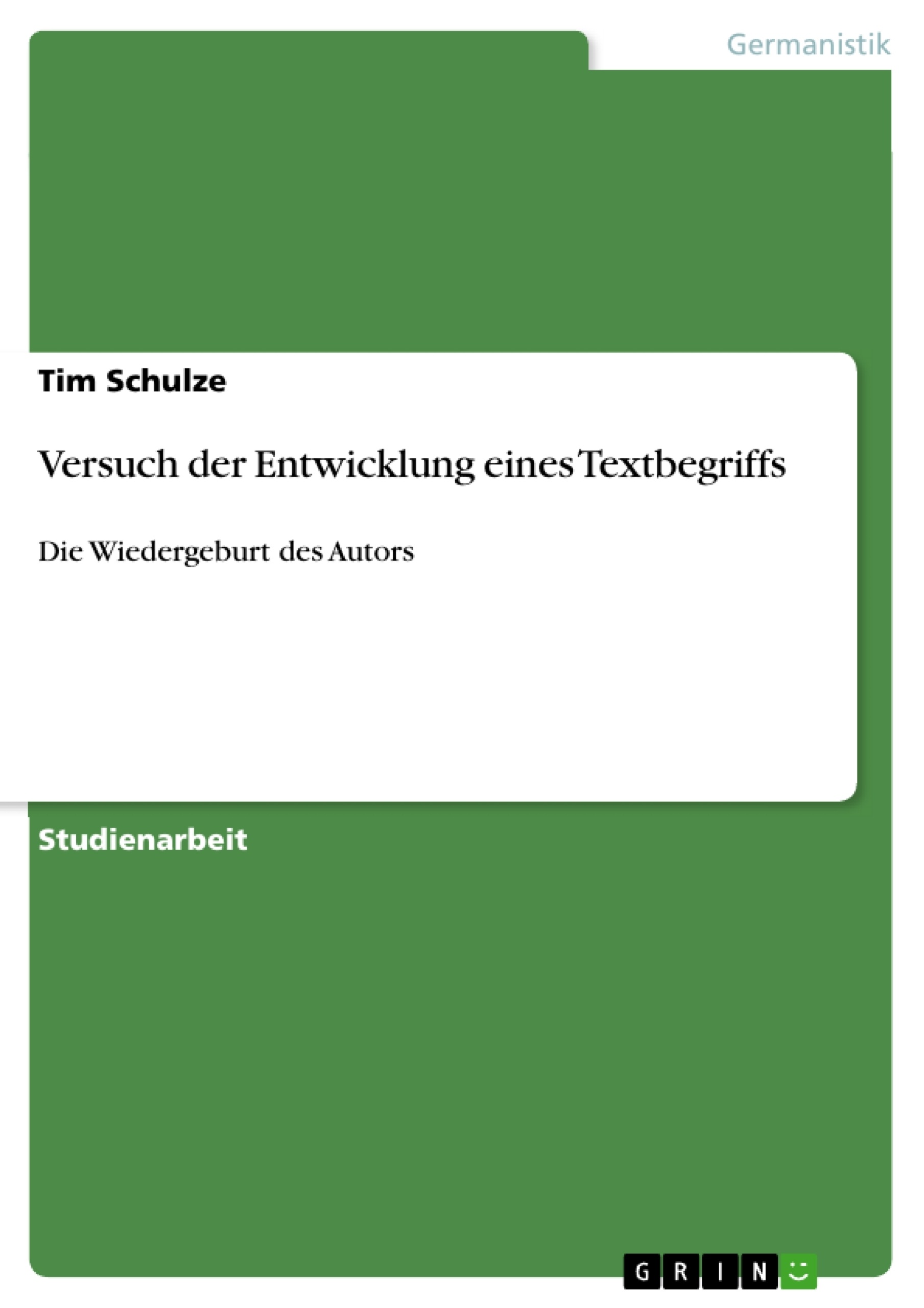„Der Text ruht in der Sprache“ , heißt es in Roland Barthes Aufsatz Vom Werk zum Text. Die folgenden Ausführungen werden diese Aussage in Zweifel ziehen, sodass der Text an einen ganz eigenen Ort verlegt werden kann. Die Frage, mit der sich diese Abhandlung beschäftigt, lautet: Was bezeichnet den Text wirklich?
Barthes würde vermutlich bereits den Gedanken an diese Fragestellung einen Rückschritt zum Signifikat nennen. Jedoch sollen bei der folgenden Analyse gerade Vorüberlegungen, wie die des Strukturalismus, zunächst außer Acht gelassen werden, um sich dem Textbegriff aus einer anderen Perspektive annähern zu können. Der zu entwickelnde Textbegriff soll sich der Naivität eines hermeneutischen Textbegriffs entziehen, sich aber nicht der Dekonstruktion verschreiben wie poststrukturalistische Theorien.
Als Ausgangspunkt sind die theoretischen Aufsätze Die Redevielfalt im Roman und Das Problem des Textes von Michail Bachtin von Nutze, da er der Hermeneutik zwar durchaus kritisch gegenüber steht, aber traditionelle Begrifflichkeiten dennoch nicht verwirft. Allerdings richtet sich das Hauptaugenmerk hier weniger auf das Verständnis von Text als auf das Wesen des Textes. Die folgenden Erörterungen sollen vor allem darüber Aufschluss geben, was ein Text ist. Während sich bei Bachtin, je nach Blickwinkel, ein engerer oder weiterer Begriff von Text ausmachen lässt , soll in der folgenden Argumentation eine möglichst prägnante Vorstellung davon erarbeitet werden, was einen Text ausmacht. Nachdem in den ersten Kapiteln die nötigen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Textbegriffs geschaffen werden, wird im Folgeteil der Arbeit versucht, diese Erkenntnisse in einen literatur-theoretischen Ansatz einzubinden, welcher zu einer Art Vereinigung verschiedener Elemente hermeneutischer und poststrukturalistischer Thesen gelangt.
Zu diesem Zweck werden Bezüge zu verschiedenen Theorien der Textualität hergestellt, andere Ansätze integriert sowie kritisch beleuchtet. Besonders in den Blick-punkt rücken die Positionen von Roland Barthes, Karlheinz Stierle, Julia Kristeva und natürlich Michail M. Bachtin. Nach einer Begriffseinführung in den ersten Kapiteln dient Bachtins Begriff der Dialogizität als Grundlage im Hinblick auf das Konzept der Intertextualität von Julia Kristeva, um im letzten Schritt, konträr zu Roland Barthes Aufsatz Der Tod des Autors, die Wiedergeburt des Autors zu feiern [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG – ÜBER DIE ENTWICKLUNG EINES TEXTBEGRIffs.
- 2. WAS IST EIN TEXT?
- 2.1. Über das Wesen des Textes.......
- 2.2. Der Text in Rede und Schrift.
- 3. ABGRENZUNG DES TEXTBEGRIFFS .............
- 3.1. Der Textbegriff in Abgrenzung vom Handlungsbegriff….....
- 3.2. Der Textbegriff in Abgrenzung vom Werkbegriff.
- 4. VON MICHAIL BACHTIN ZU JULIA KRISTEVA – DIALOGIZITÄT, INTERTEXTUALITÄT UND AUTORSCHAFT.
- 5. DIE WIEDERGEBURT DES AUTORS...................
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Textbegriffs und analysiert dessen Wesen in Abgrenzung zu anderen Begriffen. Ziel ist es, eine prägnante Vorstellung vom Text zu erarbeiten, die sowohl hermeneutische als auch poststrukturalistische Ansätze berücksichtigt.
- Entwicklung eines Textbegriffs, der sich der Naivität des hermeneutischen Textbegriffs entzieht, aber auch nicht der Dekonstruktion poststrukturalistischer Theorien folgt
- Analyse des Textbegriffs im Kontext der Rede und Schrift
- Abgrenzung des Textbegriffs vom Handlungsbegriff und Werkbegriff
- Integration von theoretischen Ansätzen von Bachtin, Barthes, Stierle und Kristeva
- Die Bedeutung der Dialogizität und Intertextualität für das Konzept der Autorschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Über die Entwicklung eines Textbegriffs: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung nach dem Wesen des Textes vor. Es beleuchtet die Problematik des hermeneutischen und poststrukturalistischen Textbegriffs und legt den Fokus auf die Entwicklung eines eigenen Textbegriffs, der beide Ansätze vereint.
- Kapitel 2: Was ist ein Text?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Eigenschaften des Textes. Es wird erläutert, dass der Text nicht materiell ist, sondern ein Prozess der symbolischen Übersetzung. Es wird die Verbindung von Sprache und Text analysiert und die Rolle des Subjekts in der Textproduktion und -rezeption beleuchtet.
- Kapitel 2.1: Über das Wesen des Textes: In diesem Kapitel wird der Text als ein Prozess der symbolischen Übersetzung definiert. Der Text ist weder materiell noch aus Formen oder Funktionen von Zeichen aufgebaut.
- Kapitel 2.2: Der Text in Rede und Schrift: Dieses Kapitel stellt die Unterscheidung zwischen Rede- und Schrifttexten dar. Es beleuchtet die Unterschiede in der Textproduktion und -rezeption sowie die spezifischen Eigenschaften beider Textformen.
- Kapitel 3: Abgrenzung des Textbegriffs: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung des Textbegriffs von anderen zentralen Begriffen wie Handlung und Werk. Es wird darauf eingegangen, wie der Text als eigenständiger Begriff definiert werden kann.
- Kapitel 3.1: Der Textbegriff in Abgrenzung vom Handlungsbegriff: In diesem Kapitel wird die Unterscheidung zwischen Text und Handlung erläutert. Es wird die These vertreten, dass der Text nicht mit der Handlung identisch ist, sondern eine eigene Ebene der Bedeutungskonstruktion bildet.
- Kapitel 3.2: Der Textbegriff in Abgrenzung vom Werkbegriff: Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen Text und Werk. Es wird argumentiert, dass das Werk als ein konkretes Objekt betrachtet werden kann, während der Text ein abstrakter Prozess der Bedeutungsproduktion darstellt.
- Kapitel 4: Von Michail Bachtin zu Julia Kristeva – Dialogizität, Intertextualität und Autorschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einbindung von Bachtin und Kristeva in die Texttheorie. Es wird der Einfluss von Bachtins Konzepten der Dialogizität auf Kristevas Theorie der Intertextualität untersucht.
- Kapitel 5: Die Wiedergeburt des Autors: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Autorschaft im Kontext der Intertextualität. Es wird argumentiert, dass die Autorschaft trotz des Einflusses von Intertextualität eine wichtige Rolle in der Textproduktion und -interpretation spielt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Texttheorie: Textbegriff, Dialogizität, Intertextualität, Autorschaft, Werk, Handlung, hermeneutischer Textbegriff, poststrukturalistischer Textbegriff. Sie setzt sich mit dem Wesen des Textes auseinander und analysiert dessen Abgrenzung zu anderen Begriffen. Im Fokus stehen die Theorien von Bachtin, Barthes, Stierle und Kristeva.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Ziel der Untersuchung des Textbegriffs?
Ziel ist die Entwicklung eines prägnanten Textbegriffs, der hermeneutische und poststrukturalistische Ansätze vereint, ohne in Naivität oder reine Dekonstruktion zu verfallen.
Wie unterscheidet sich der Text vom Werk?
Das Werk wird als konkretes, materielles Objekt betrachtet, während der Text als abstrakter Prozess der Bedeutungsproduktion und symbolischen Übersetzung definiert wird.
Welche Rolle spielt die Dialogizität nach Michail Bachtin?
Bachtins Konzept der Dialogizität dient als Grundlage für das Verständnis, wie Texte miteinander in Beziehung stehen und wie Sprache im sozialen Kontext wirkt.
Was versteht Julia Kristeva unter Intertextualität?
Intertextualität beschreibt bei Kristeva die Eigenschaft von Texten, sich auf andere Texte zu beziehen und aus einem Geflecht von Verweisen zu bestehen.
Wie wird die Rolle des Autors in der Arbeit bewertet?
Entgegen Roland Barthes' These vom „Tod des Autors“ plädiert die Arbeit für eine „Wiedergeburt des Autors“, der trotz intertextueller Einflüsse eine wichtige Rolle spielt.
Ist ein Text ein materielles Objekt?
Nein, der hier entwickelte Textbegriff definiert den Text als einen immateriellen Prozess der symbolischen Übersetzung, nicht als bloße Aneinanderreihung von Zeichen.
- Citar trabajo
- Tim Schulze (Autor), 2010, Versuch der Entwicklung eines Textbegriffs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171651