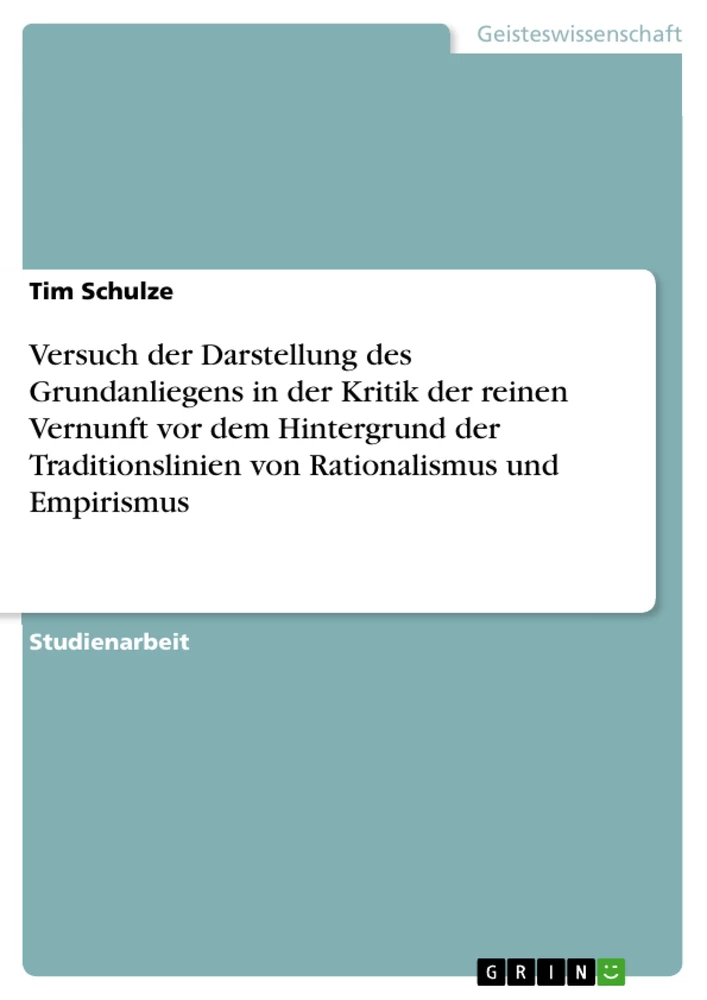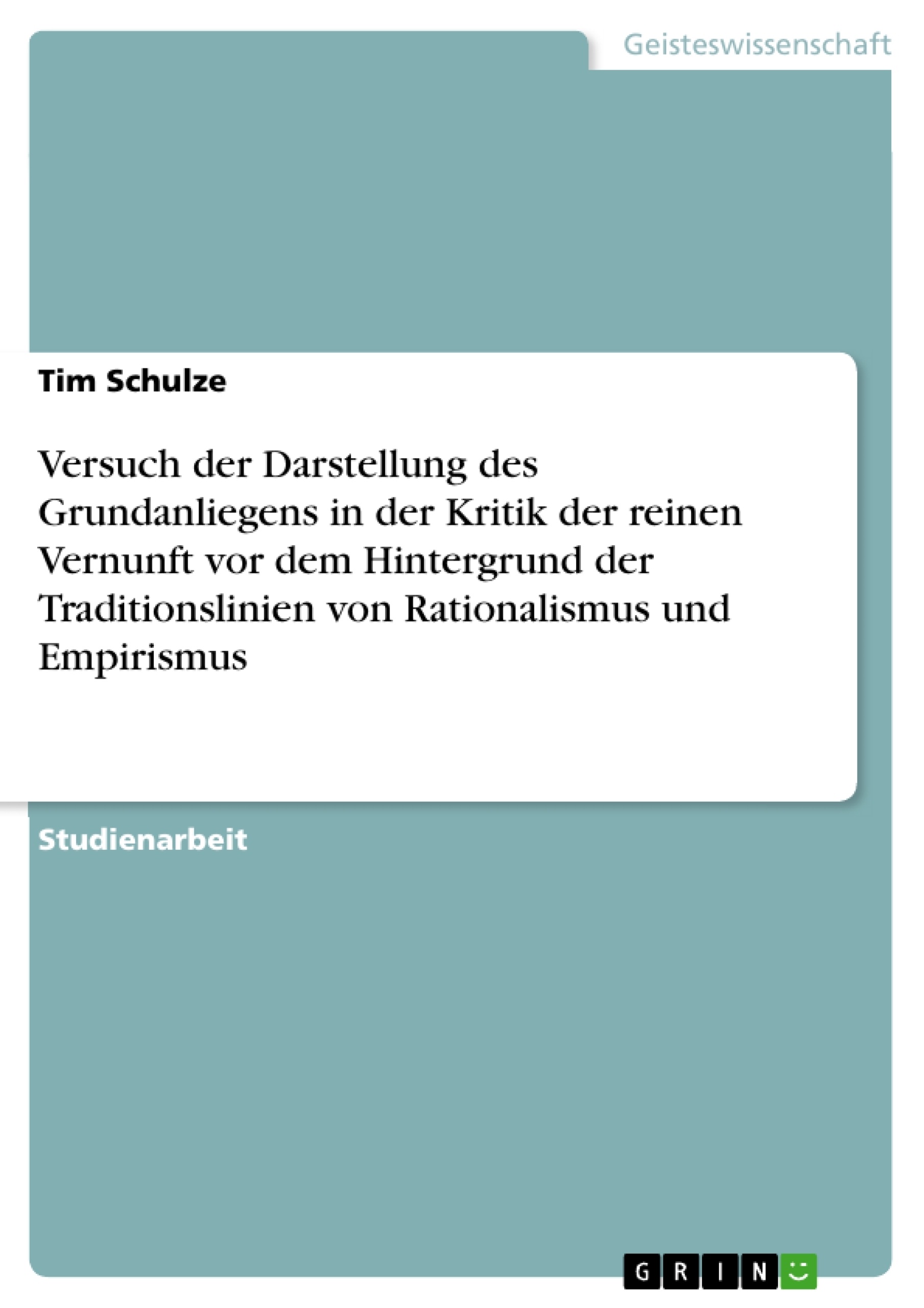„Was kann ich wissen? “ – So lautet Immanuel Kants entscheidende Fragestellung zu der 1781 in der ersten und 1787 in der überarbeiteten zweiten Auflage erschienenen Kritik der reinen Vernunft. Mit dieser Schrift beeinflusste er die neuzeitliche Philosophie wie kein anderer Denker sonst. Aufgrund der maßgeblichen Bedeutung der Theorie spricht man parallel zur Astronomie von der „kopernikanischen Wende“ in der Philosophie. Denn entscheidend ist wie bei Kopernikus der Perspektivwechsel, welchen Kant in der Kritik der reinen Vernunft vollzieht. Ähnlich wie seine berühmten Vorgän¬ger John Locke, David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz und René Descartes unter¬sucht Kant die Grenzen menschlicher Erkenntnis.
Die Frage „Was kann ich wissen?“ bezieht sich auf die Möglichkeit und Bedingung von Erkenntnissen überhaupt. Diese Untersuchung der Bedingung der Möglichkeit von etwas begründet die transzendentale Erkenntnistheorie in der Kritik der reinen Vernunft. Diese befasst sich nicht mit Gott oder etwas Übersinnlichen, denn der Anspruch Kants ist es gerade, die spekulative Philosophie aus der Erkenntnistheorie auszuschließen bzw. eine Antwort auf die weiterreichende Frage zu erhalten, ob und wie Metaphysik als Wissenschaft begründet werden kann. Diese soll in Form einer kritischen Untersuchung der Vernunft an sich selbst beantwortet werden und mündet letztlich in der Frage nach der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori.
Ob Immanuel Kant mehr dem Empirismus oder Rationalismus zugetan war, lässt sich nicht beantworten, da er in der Kritik der reinen Vernunft zuletzt beide Methoden ver-wirft. Kant entwickelte sein Denken jedoch eindeutig aus der rationalistischen Richtung; so beschäftigte er sich schon 30 Jahre vor Entstehung der Kritik der reinen Ver-nunft vornehmlich mit den neuesten Erkenntnissen in der Mathematik und den Natur-wissenschaft z.B. bei Isaac Newton und Moses Mendelssohn. Daher ist Kant noch bis 1750/60 dem Rationalismus von Leibniz und Wolff zuzurechnen. Dieser Zeitpunkt fällt in den Abschnitt, den man in der Kantforschung als vorkritische Periode bezeichnet, im Unterschied zur kritischen Phase, welche etwas mehr als zehn Jahre vor der Nieder-schrift der Kritik der reinen Vernunft einsetzt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Traditionslinien rationalistischer und empiristischer Philosophie
- Darstellung der Grundlagen rationalistischer Positionen ....
- Darstellung der Grundlagen empiristischer Positionen...
- Die Konzeption Kants Transzendentalphilosophie in der Kritik der reinen Vernunft
als Synthese von Empirismus und Rationalismus.
- Die Synthese von Empirismus und Rationalismus .
- Kopernikanische Wende - Die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich ..........\li>
- Raum und Zeit als Anschauungsformen a priori
- Die Kategorien - Reine Verstandesbegriffe.
- Über die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori und einer Metaphysik, die als Wissenschaft gelten darf..
- Zusammenfassung...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, das Grundanliegen der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant vor dem Hintergrund der traditionsreichen Debatte zwischen Rationalismus und Empirismus darzustellen. Die Arbeit untersucht, wie Kants transzendentale Erkenntnistheorie eine Synthese dieser beiden philosophischen Strömungen darstellt und die Grenzen menschlicher Erkenntnis neu definiert.
- Kants Kritik der reinen Vernunft als Synthese von Empirismus und Rationalismus
- Die Rolle der transzendentalen Erkenntnistheorie
- Die "kopernikanische Wende" und die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich
- Die Bedeutung von Raum und Zeit als Anschauungsformen a priori
- Die Kategorien als reine Verstandesbegriffe und ihre Funktion in der Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Kritik der reinen Vernunft ein: "Was kann ich wissen?". Sie beleuchtet Kants Einfluss auf die neuzeitliche Philosophie und seine "kopernikanische Wende" im Bereich der Erkenntnistheorie. Das erste Kapitel stellt die traditionsreichen Strömungen des Rationalismus und Empirismus vor. Es beleuchtet die wichtigsten Vertreter wie René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, John Locke und David Hume und ihre jeweiligen Ansätze zur Erkenntnisgewinnung. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf Kants transzendentale Erkenntnistheorie und analysiert die Synthese von Empirismus und Rationalismus in der Kritik der reinen Vernunft. Es behandelt die "kopernikanische Wende", die Unterscheidung von Erscheinung und Ding an sich, sowie die Rolle von Raum und Zeit als Anschauungsformen a priori. Des Weiteren werden die Kategorien als reine Verstandesbegriffe und ihre Funktion in der Erkenntnis erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant, transzendentale Erkenntnistheorie, Rationalismus, Empirismus, "kopernikanische Wende", Erscheinung, Ding an sich, Raum, Zeit, Anschauungsformen a priori, Kategorien, synthetische Urteile a priori, Metaphysik. Die Arbeit befasst sich mit den Grenzen menschlicher Erkenntnis, der Frage nach der Möglichkeit von Wissen und der Kritik an traditionellen philosophischen Strömungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Fragestellung in Kants „Kritik der reinen Vernunft“?
Die entscheidende Frage lautet: „Was kann ich wissen?“ und bezieht sich auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt.
Was versteht man unter der „kopernikanischen Wende“ in der Philosophie?
Es beschreibt Kants Perspektivwechsel, bei dem sich die Erkenntnis nicht nach den Gegenständen richtet, sondern die Gegenstände nach unseren Erkenntnisformen.
Wie verbindet Kant Rationalismus und Empirismus?
Kant betrachtet seine Transzendentalphilosophie als Synthese, indem er zeigt, dass Erkenntnis sowohl Sinneserfahrung als auch reine Verstandesbegriffe erfordert.
Was bedeuten „Raum und Zeit“ bei Kant?
Kant definiert Raum und Zeit als Anschauungsformen a priori, die notwendige Voraussetzungen für jede menschliche Erfahrung sind.
Was ist der Unterschied zwischen „Erscheinung“ und „Ding an sich“?
Wir erkennen Dinge nur so, wie sie uns erscheinen (Erscheinung), während das Wesen der Dinge unabhängig von unserer Wahrnehmung (Ding an sich) unzugänglich bleibt.
- Quote paper
- Tim Schulze (Author), 2010, Versuch der Darstellung des Grundanliegens in der Kritik der reinen Vernunft vor dem Hintergrund der Traditionslinien von Rationalismus und Empirismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171652