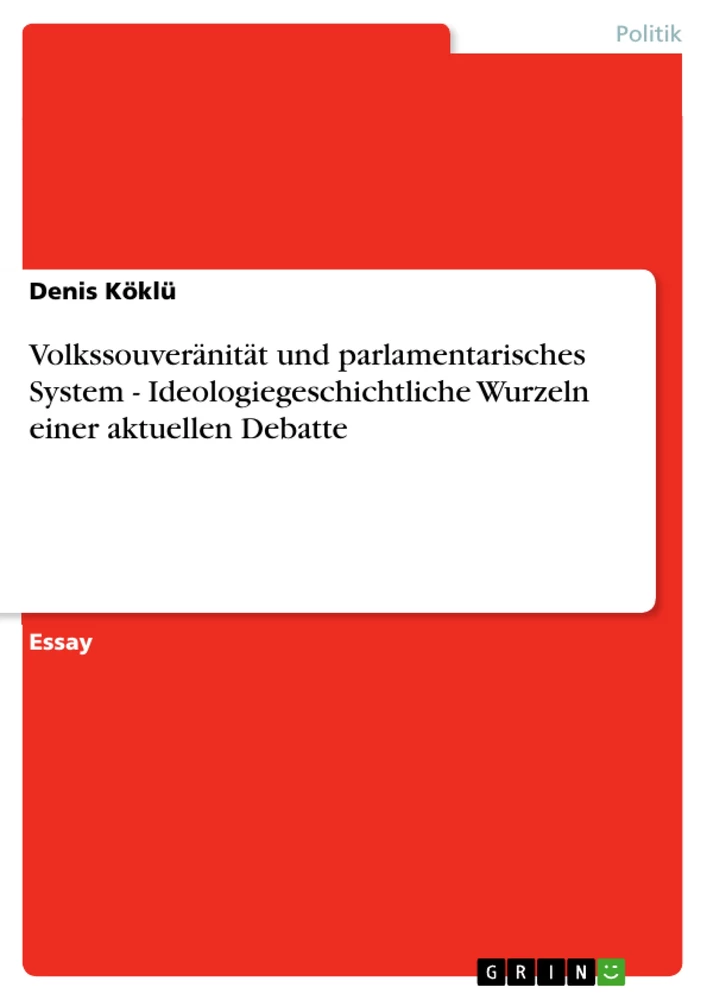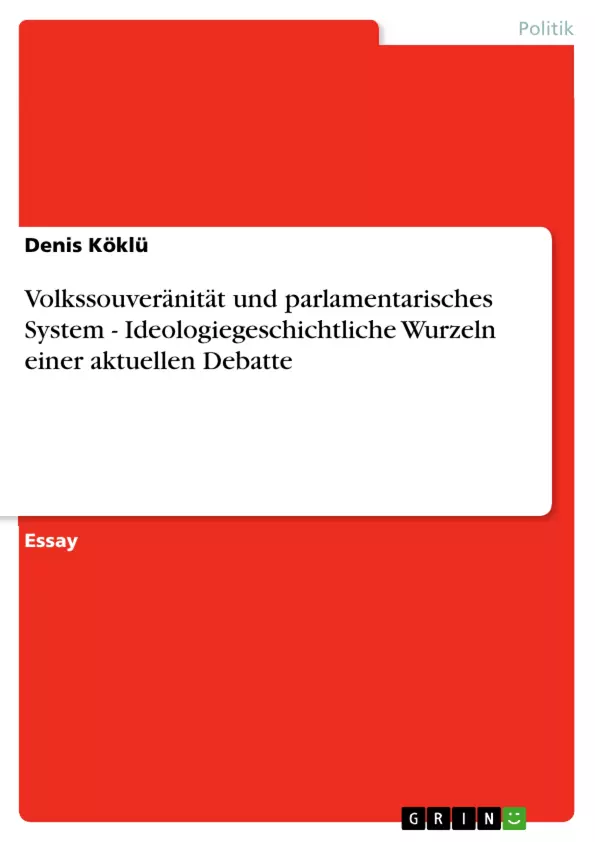Der Sozialwissenschaftler Tilman Evers gibt sich in dem von ihm verfassten Text „Volkssouveränität und parlamentarisches System […]“ als Verfechter Verfahren direkter Demokratie zu erkennen.
Zu Beginn des Textes, in der Einleitung, weist der Autor auf die Bedenken der Gegner hinsichtlich direktdemokratischer Verfahren - in der Mehrheit Konservative - hin, auf deren Widerlegung - dies natürlich im Hauptteil - der Leser zu hoffen beginnt. Die Rede ist von Demagogie und Irrationalität, für die Verfahren direkter Demokratie laut Gegenpartei anfällig seien, während ihrer Auffassung nach allein das parlamentarische System legitimiert und imstande sei, das Gemeinwohl zu artikulieren. Was Evers im Hauptteil seines Textes dem zu entgegnen hat und ob er zu überzeugen vermag, wird der Essay im Folgenden zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsbeschreibung und kritische Auseinandersetzung
- II. Eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Tilman Evers befasst sich mit der Frage der Volkssouveränität und der Rolle direkter Demokratie im Verhältnis zum parlamentarischen System. Er analysiert die historische Entwicklung des Begriffs der Volkssouveränität und argumentiert, dass direkte Demokratie eine wichtige Ergänzung zum parlamentarischen System darstellt.
- Die Genese des Begriffs der Volkssouveränität
- Der innere Widerstreit des Liberalismus zwischen politischer und ökonomischer Freiheit
- Die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Partizipation
- Die Notwendigkeit direkter Demokratie als Ergänzung zum parlamentarischen System
- Die Rolle der politischen Bildung in der direkten Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Inhaltsbeschreibung und kritische Auseinandersetzung
Der Autor stellt zunächst die Bedenken von Konservativen gegenüber direkter Demokratie dar, die diese als anfällig für Demagogie und Irrationalität ansehen. Evers argumentiert, dass direkte Demokratie eine Form der Partizipation ermöglicht, die repräsentative Verfahren übertrifft. Er sieht den Disput um direkte Demokratie als Analogie zum inneren Konflikt des Liberalismus zwischen politischer und ökonomischer Freiheit. Im Kontext der westlichen Demokratien kritisiert er die Dominanz der wirtschaftsliberalen Komponente, die zu einer passiven Rolle der Bürger in der Wirtschaft und einer Konzentration des Politischen im Staat führt. Evers plädiert für mehr direkte Demokratie auf Bundesebene und verweist auf die Bürgerbewegungen in der ehemaligen DDR als Beleg für das Bedürfnis nach Partizipation.
Im weiteren Verlauf des Kapitels kritisiert Evers das Beispiel der doppelten Staatsbürgerschaft als Beleg für die fragwürdige Effizienz direkter Demokratie. Er argumentiert, dass die politische Bildung der Bevölkerung eine notwendige Voraussetzung für die Einführung direkter Demokratie sei, um Demagogie und Populismus zu verhindern.
II. Eigene Meinung
Der Autor des Essays teilt die Ansicht Evers, dass die gegenwärtige repräsentative Demokratie nur eine Vorstufe auf dem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung sein kann. Er betont jedoch, dass die Reife der Bürger für die Einführung direkter Demokratie entscheidend ist. Als Beispiel für die mangelnde Reife des deutschen Volkes nennt er den großen Zuspruch des Buches von Sarrazin.
Schlüsselwörter
Volkssouveränität, parlamentarisches System, direkte Demokratie, politische Partizipation, zivilgesellschaftliche Beteiligung, politische Bildung, Demagogie, Irrationalität, Liberalismus, wirtschaftsliberale Komponente,
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese von Tilman Evers zur direkten Demokratie?
Evers argumentiert, dass direkte Demokratie eine notwendige Ergänzung zum parlamentarischen System ist, um die Volkssouveränität und zivilgesellschaftliche Partizipation zu stärken.
Welche Bedenken haben Konservative gegenüber direktdemokratischen Verfahren?
Kritiker befürchten eine Anfälligkeit für Demagogie und Irrationalität und sehen nur das parlamentarische System als legitimiert an, das Gemeinwohl zu artikulieren.
Wie wird der Konflikt des Liberalismus in diesem Kontext beschrieben?
Es besteht ein Widerstreit zwischen politischer und ökonomischer Freiheit, wobei oft die wirtschaftsliberale Komponente dominiert und Bürger in eine passive Rolle drängt.
Welche Rolle spielt die politische Bildung für die direkte Demokratie?
Politische Bildung wird als notwendige Voraussetzung angesehen, um Populismus zu verhindern und die "Reife" der Bürger für Mitbestimmung zu gewährleisten.
Warum werden die Bürgerbewegungen der DDR erwähnt?
Evers nutzt sie als Beleg für das tiefsitzende Bedürfnis der Bevölkerung nach aktiver politischer Partizipation jenseits rein repräsentativer Strukturen.
- Quote paper
- Denis Köklü (Author), 2011, Volkssouveränität und parlamentarisches System - Ideologiegeschichtliche Wurzeln einer aktuellen Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171655