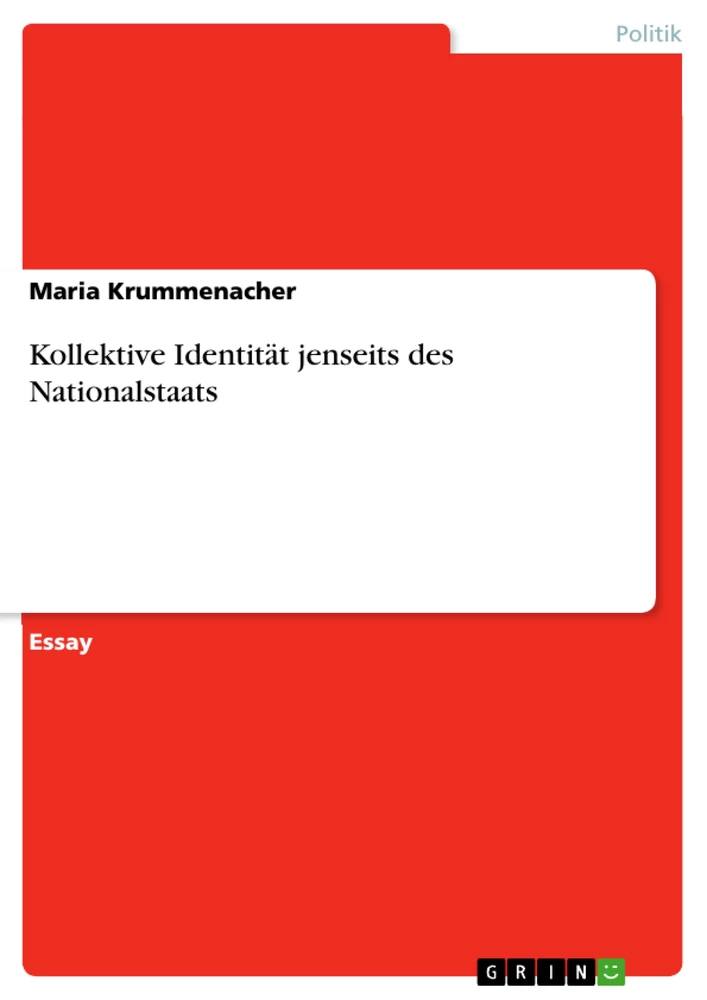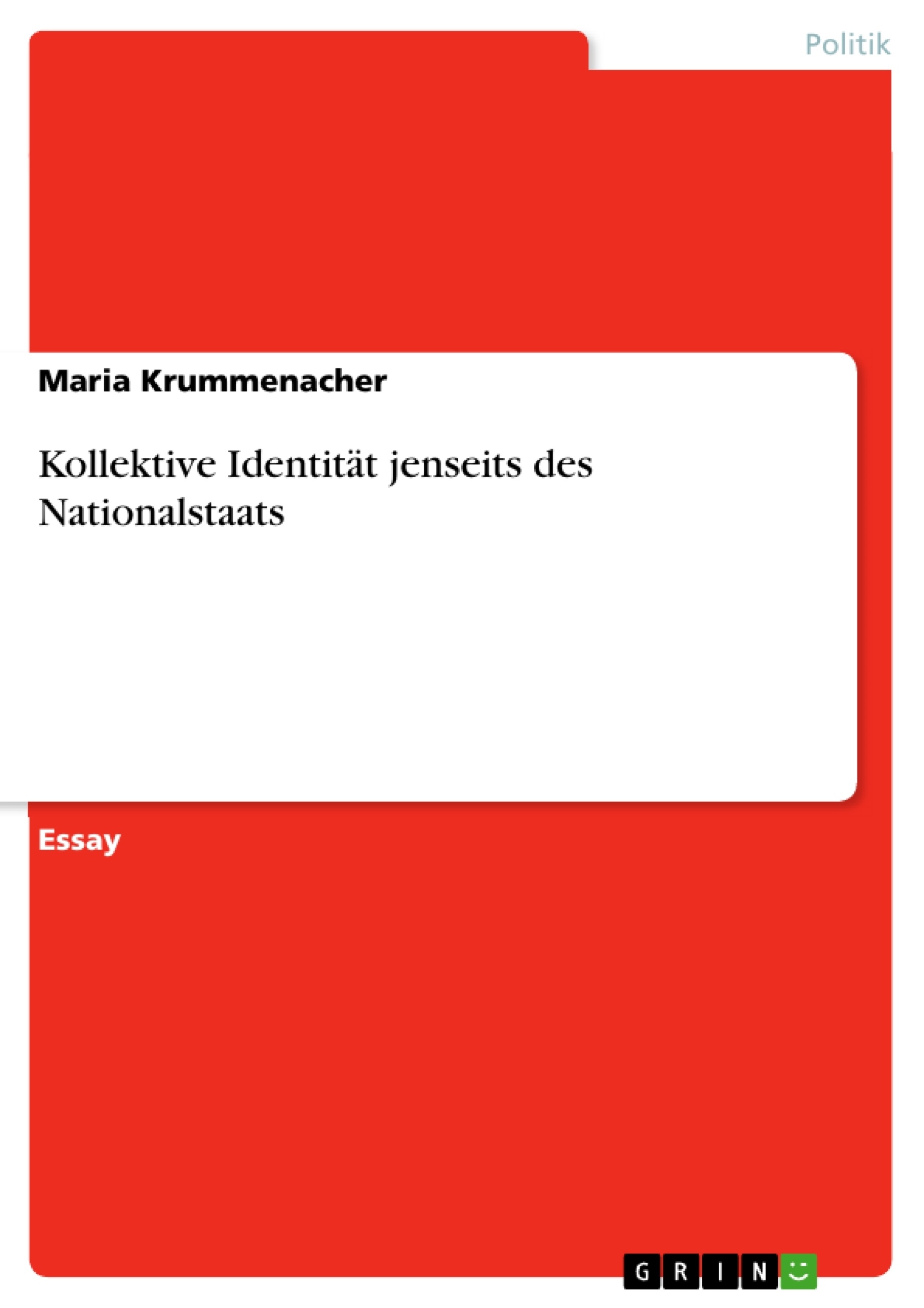Eine Nation ist eine Gemeinschaft von Individuen, die den Zusammenschluss in einem Staat anstrebt. Ihren Ursprung hat die Nation in einem Volk. Gemäß der kulturellen Konzeption von Nation wurzelt das Wir-Gefühl eines Volk in historisch gewachsenen Familien und Stämmen mit einem gemeinsamen kollektiven Gedächtnis, gemeinsamen Symbolen und Traditionen. Gelingt es den Mitgliedern der Nation, einen Staat zu bilden, so wird das Volk zum Träger von Souveränität. Es ist sowohl das zentrale Objekt der Loyalität als auch die Basis der kollektiven Solidarität zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft.
Aus der Kombination von Nation und Staat entsteht der Nationalstaat, der sich sowohl auf weit zurückreichende kulturelle Identitäten, als auch auf die abstrakten Ideale der politischen Konzeption stützt. Die Leistung des Nationalstaates ist es, eine große Anzahl von untereinander nur lose verknüpften sozialen Einheiten zu einem Volkskörper zu vereinen.
Vor allem in den 1990er Jahren wurde die Fähigkeit des Nationalstaates, eine solche Integrations- und Identifikationsfunktion noch auszuüben, angezweifelt. Gemäß dieser Überlegungen, wird die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der nationalen Regierungen durch die Globalisierung eingeschränkt. Um in einer immer interdependenteren Weltwirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben, sind Anpassungen an die Logik der globalen Märkte nötig. Damit verlieren die Staaten ihre Souveränität über gewisse Teilbereiche des Systems.
Die Globalisierung hat auch eine kulturelle Dimension und durch diese Einfluss auf die Gesellschaft. Mit weltumspannenden Medien, Kommunikations- und Fortbewegungsmitteln werden die Menschen mehr und mehr zu Weltbürgern. Es ist nicht mehr der Nationalstaat alleine, der dem Menschen das Gefühl gibt, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Die Menschen können sich ihre Zugehörigkeit entweder in kleineren, regionalen Einheiten oder auf überstaatlicher Ebene suchen. Die nationalstaatliche Identität wäre dann nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung unter einem Dach aus gemeinsamem Gedächtnis, Sprache und Kultur zu vereinen. Es stellt sich die Frage, ob ein anderes Prinzip diese Funktion übernehmen könnte. Von diesen Überlegungen ausgehend soll in diesem Essay folgende Fragestellung behandelt werden: Gibt es einen Mechanismus, der die Integrationsfunktion der nationalstaatlichen Identität ersetzen kann?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Regionalisierungstendenzen
- Loslösung von allen territorialen Verbundenheiten und Identifikationen
- Die Europäische Union (EU)
- Solidarität und das Zusammengehörigkeitsgefühl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Frage, ob es einen Mechanismus gibt, der die Integrationsfunktion der nationalstaatlichen Identität ersetzen kann. Er untersucht die beiden Hauptalternativen zur nationalstaatlichen Identität: die Hinwendung zu regionalen Einheiten und die Loslösung von allen territorialen Bindungen.
- Die schwindende Bedeutung der nationalstaatlichen Identität in der Globalisierung
- Die Herausforderungen der Regionalisierung und mögliche Folgen von Sezessionismus
- Die Europäische Union als Beispiel für eine supranationale Integration
- Die Rolle der Öffentlichkeit und des Verfassungspatriotismus für die Entstehung einer europäischen Identität
- Die Herausforderungen der sprachlichen Segmentierung und der fehlenden länderübergreifenden Zivilgesellschaft in Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Grundannahmen des Essays dar: Die Nation als Gemeinschaft von Individuen, die sich in einem Staat zusammenschließen, und die Herausforderungen an die nationalstaatliche Identität durch die Globalisierung. Die Fragestellung des Essays lautet: Gibt es einen Mechanismus, der die Integrationsfunktion der nationalstaatlichen Identität ersetzen kann?
Hauptteil
Regionalisierungstendenzen
Der Abschnitt beleuchtet die wachsenden Regionalisierungstendenzen in Europa und stellt verschiedene Beispiele für sezessionistische Bewegungen vor. Er zeigt auf, dass diese Bewegungen den Nationalstaat in Frage stellen und das Risiko bergen, ethnische Konflikte zu verschärfen.
Loslösung von allen territorialen Verbundenheiten und Identifikationen
Dieser Abschnitt betrachtet die Alternative zur nationalstaatlichen Identität, die Loslösung von allen territorialen Bindungen und die Identifikation mit supranationalen Gebilden. Die Europäische Union dient als Beispiel für eine Integration von Nationalstaaten in ein supranationales Gebilde.
Solidarität und das Zusammengehörigkeitsgefühl
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle der Öffentlichkeit und des Verfassungspatriotismus für die Entstehung einer europäischen Identität. Er argumentiert, dass eine europäische Öffentlichkeit notwendig ist, um eine länderübergreifende Solidarität und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen.
Schlüsselwörter
Nationalstaat, Identität, Globalisierung, Regionalisierung, Sezessionismus, Europäische Union, Verfassungspatriotismus, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft, Sprache, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was gefährdet die Identitätsfunktion des Nationalstaates?
Die Globalisierung schränkt die Souveränität von Staaten ein, während Menschen sich zunehmend über regionale Einheiten oder als Weltbürger identifizieren.
Was ist Verfassungspatriotismus?
Dies ist ein Konzept, bei dem sich die Identität nicht auf eine gemeinsame Kultur oder Abstammung stützt, sondern auf die Anerkennung gemeinsamer demokratischer Werte und Rechte.
Kann die EU eine kollektive Identität schaffen?
Dies wird kontrovers diskutiert; Herausforderungen sind die sprachliche Segmentierung und das Fehlen einer länderübergreifenden Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit.
Welche Rolle spielt die Regionalisierung in Europa?
Regionalisierungstendenzen und sezessionistische Bewegungen fordern den Nationalstaat heraus und suchen Identität in kleineren, historisch gewachsenen Einheiten.
Was ist die Integrationsfunktion einer Nation?
Sie vereint lose verknüpfte soziale Einheiten durch ein gemeinsames kollektives Gedächtnis, Sprache und Kultur zu einem solidarischen Volkskörper.
- Quote paper
- Maria Krummenacher (Author), 2011, Kollektive Identität jenseits des Nationalstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171761