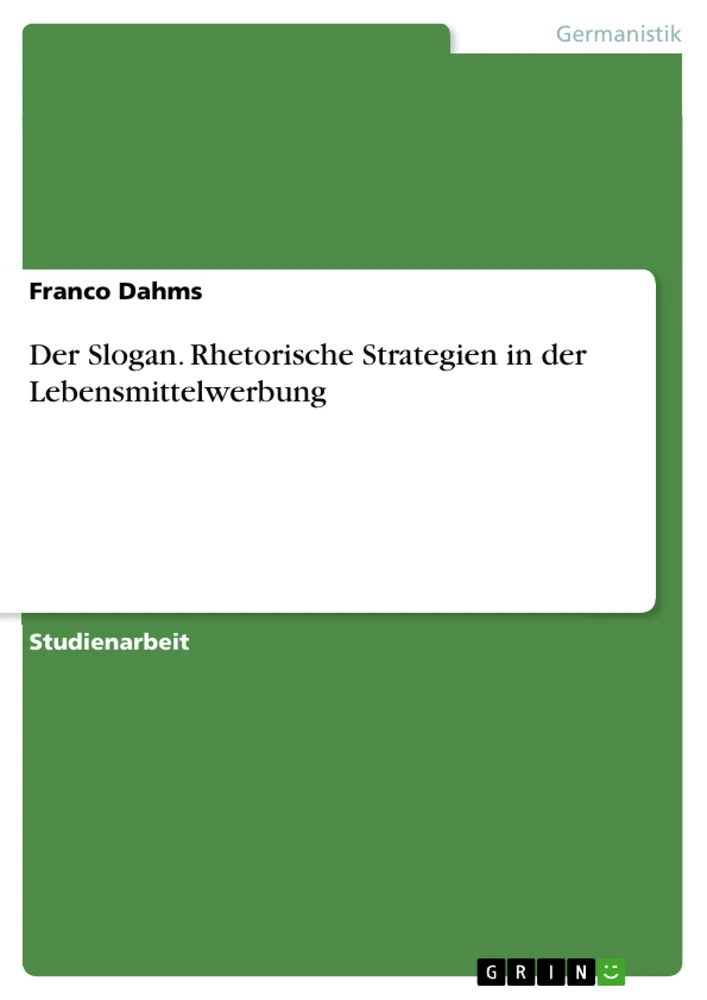Diese Arbeit befasst sich mit der rhetorischen Strategie von Werbeslogans, genau genommen mit solchen aus der Nahrungsmittelwerbung. Dabei sollen Funktions- und Wirkungsweise des Slogans anhand eines Slogan-Korpus, das in sich unterschiedliche Nahrungsmittelressorts bedient, exemplifiziert werden. Einerseits können so allgemeine Aussagen über die Struktur und Psychologie bzw. Ideologie von Slogans getroffen und andererseits auch spezifische Tendenzen der Nahrungsmittelwerbung, im engeren Sinne eventuell sogar die der (jeweiligen) ressorteigenen Slogan-Strategien aufgezeigt werden.
In einem ersten Schritt wird zunächst skizziert, was Werbung ist respektive will. Über die anschließende konzeptionelle Positionierung des Slogans innerhalb der Werbung [Werbesprache] hinaus werden dann die frequentesten Umsetzungen des Slogans auf stilistisch-rhetorischer Ebene, also die relevantesten Repräsentationsformen der rhetorischen Strategie benannt und beschrieben.
Nach eingehender Formulierung der theoretischen, d.h. werbesprachlichen, sloganspezifischen und rhetorisch-terminologischen Grundlagen folgt im zweiten Teil dieser Arbeit das praktisch-empirische Äquivalent; Darin wird primär das Korpus präzisiert, um sich nachfolgend jeder einzelnen korpusinhärenten (Produkt-)Marke und deren stellvertretendem Slogan zu widmen – wobei zwischen fünf verschiedenen Nahrungsmittelressorts unterschieden wird (über die genaue Konfiguration wird im betreffenden Abschnitt berichtet). Ziel dieser kontrastiven Analyse ist wie gesagt die typologische Diskriminierung der Slogans auch innerhalb der verschiedenen Typen von Nahrungsmitteln bzw. -werbeträgern. Dadurch soll u.a. geklärt werden, ob beispielsweise Süßwaren slogantechnisch, besser gesagt semantisch anders behandelt werden als Tiefkühlkost oder auch Grundnahrungsmittel wie Butter/Margarine.
Diese Gegenüberstellung erfolgt jedoch nicht nur synchron, auch diachron soll kontrastiert werden – und konstatiert, ob und in welchem Maße eine Differenz und in letzterem Sinne ein Wandel in der rhetorischen Strategie von Slogans besteht. Das entsprechende Postulat lautet: Wenn Sprache dynamisch ist und (unter anderen) signifikant mit soziokulturellen Faktoren korreliert, sollte sich dies dann nicht in der rhetorischen Strategie von Slogans widerspiegeln?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Werbung
- 1.2 Der Slogan
- 1.3 Rhetorische Strategien
- 2. Analyse
- 2.1 Das Korpus
- 2.2 Die Marken / Produkte
- 2.2.1 Becks
- 2.2.2 Müllermilch
- 2.2.3 Milka
- 2.2.4 Ritter Sport
- 2.2.5 Sanella
- 2.2.6 Lätta
- 2.2.7 Knorr
- 2.2.8 Maggi
- 2.2.9 Iglo
- 2.2.10 Frosta
- 3. Resümee & Aussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die rhetorischen Strategien in Werbeslogans der Lebensmittelindustrie. Ziel ist es, die Funktions- und Wirkungsweise von Slogans anhand eines Korpus verschiedener Lebensmittelmarken zu exemplifizieren und allgemeine Aussagen über deren Struktur und zugrundeliegende Psychologie/Ideologie zu treffen. Zusätzlich sollen spezifische Tendenzen der Nahrungsmittelwerbung und ressortspezifische Slogan-Strategien aufgezeigt werden.
- Analyse der rhetorischen Strategien in Lebensmittelwerbeslogans
- Untersuchung der Funktions- und Wirkungsweise von Slogans
- Vergleich slogantechnischer Strategien verschiedener Lebensmittelressorts
- Identifizierung von Trends und Entwicklungen in der rhetorischen Strategie von Slogans
- Beziehung zwischen Sprache, soziokulturellen Faktoren und Slogan-Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der rhetorischen Strategien in Werbeslogans der Lebensmittelbranche ein. Sie definiert den Begriff der Werbung, positioniert den Slogan innerhalb des Werbekontextes und benennt die relevanten stilistisch-rhetorischen Ebenen der Slogan-Analyse. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der methodischen Vorgehensweise, die eine theoretische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Werbesprache und Slogan-Gestaltung mit einer empirischen Analyse eines Slogan-Korpus verbindet. Die Arbeit skizziert das Ziel, sowohl allgemeine als auch spezifische Tendenzen der Nahrungsmittelwerbung aufzuzeigen, und stellt die Hypothese auf, dass sich soziokulturelle Veränderungen in der rhetorischen Strategie von Slogans widerspiegeln.
2. Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Analyse des Slogan-Korpus. Es spezifiziert die Auswahl der Marken und Produkte aus verschiedenen Nahrungsmittelressorts (z.B. Getränke, Milchprodukte, Süßwaren, Fette/Öle, Fertiggerichte, Tiefkühlkost) und deren repräsentative Slogans. Die kontrastive Analyse zielt auf die typologische Unterscheidung der Slogans innerhalb der verschiedenen Nahrungsmittelkategorien und die Untersuchung möglicher diachroner Veränderungen in deren rhetorischen Strategien. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, ob und wie sich unterschiedliche Produktkategorien in ihren Slogan-Strategien unterscheiden und ob ein Wandel in der Anwendung rhetorischer Mittel im Laufe der Zeit erkennbar ist.
Schlüsselwörter
Werbeslogans, Lebensmittelwerbung, Rhetorische Strategien, Nahrungsmittelressorts, Markenanalyse, Kontrastive Analyse, Soziokulturelle Faktoren, Sprachwandel, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Rhetorische Strategien in Werbeslogans der Lebensmittelindustrie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die rhetorischen Strategien in Werbeslogans der Lebensmittelindustrie. Sie untersucht die Funktionsweise und Wirkung von Slogans anhand eines Korpus verschiedener Lebensmittelmarken und zielt darauf ab, allgemeine Aussagen über deren Struktur und zugrundeliegende Psychologie/Ideologie zu treffen. Zusätzlich werden spezifische Tendenzen der Nahrungsmittelwerbung und ressortspezifische Slogan-Strategien aufgezeigt.
Welche Marken und Produkte werden untersucht?
Die Analyse umfasst ein Korpus verschiedener Marken und Produkte aus unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, darunter Getränke (z.B. Becks), Milchprodukte (z.B. Müllermilch), Süßwaren (z.B. Milka, Ritter Sport), Fette/Öle (z.B. Sanella, Lätta), Fertiggerichte (z.B. Knorr, Maggi) und Tiefkühlkost (z.B. Iglo, Frosta). Die Auswahl der Marken und Produkte soll repräsentativ für die verschiedenen Nahrungsmittelressorts sein.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit kombiniert eine theoretische Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Werbesprache und Slogan-Gestaltung mit einer empirischen Analyse. Es wird eine kontrastive Analyse durchgeführt, um die typologische Unterscheidung der Slogans innerhalb verschiedener Nahrungsmittelkategorien und mögliche diachrone Veränderungen in deren rhetorischen Strategien zu untersuchen. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, ob und wie sich unterschiedliche Produktkategorien in ihren Slogan-Strategien unterscheiden und ob ein Wandel in der Anwendung rhetorischer Mittel im Laufe der Zeit erkennbar ist.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit verfolgt mehrere Ziele: die Analyse der rhetorischen Strategien in Lebensmittelwerbeslogans, die Untersuchung der Funktions- und Wirkungsweise von Slogans, der Vergleich slogantechnischer Strategien verschiedener Lebensmittelressorts, die Identifizierung von Trends und Entwicklungen in der rhetorischen Strategie von Slogans und die Untersuchung der Beziehung zwischen Sprache, soziokulturellen Faktoren und Slogan-Strategien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: eine Einleitung, die das Thema einführt und die methodische Vorgehensweise erläutert; ein Analysekapitel, das die empirische Untersuchung des Slogan-Korpus beschreibt; und ein Resümee mit Ausblick, das die Ergebnisse zusammenfasst und zukünftige Forschungsfragen aufwirft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werbeslogans, Lebensmittelwerbung, Rhetorische Strategien, Nahrungsmittelressorts, Markenanalyse, Kontrastive Analyse, Soziokulturelle Faktoren, Sprachwandel, Konsumentenverhalten.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass sich soziokulturelle Veränderungen in der rhetorischen Strategie von Slogans widerspiegeln.
- Quote paper
- Franco Dahms (Author), 2008, Der Slogan. Rhetorische Strategien in der Lebensmittelwerbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171787