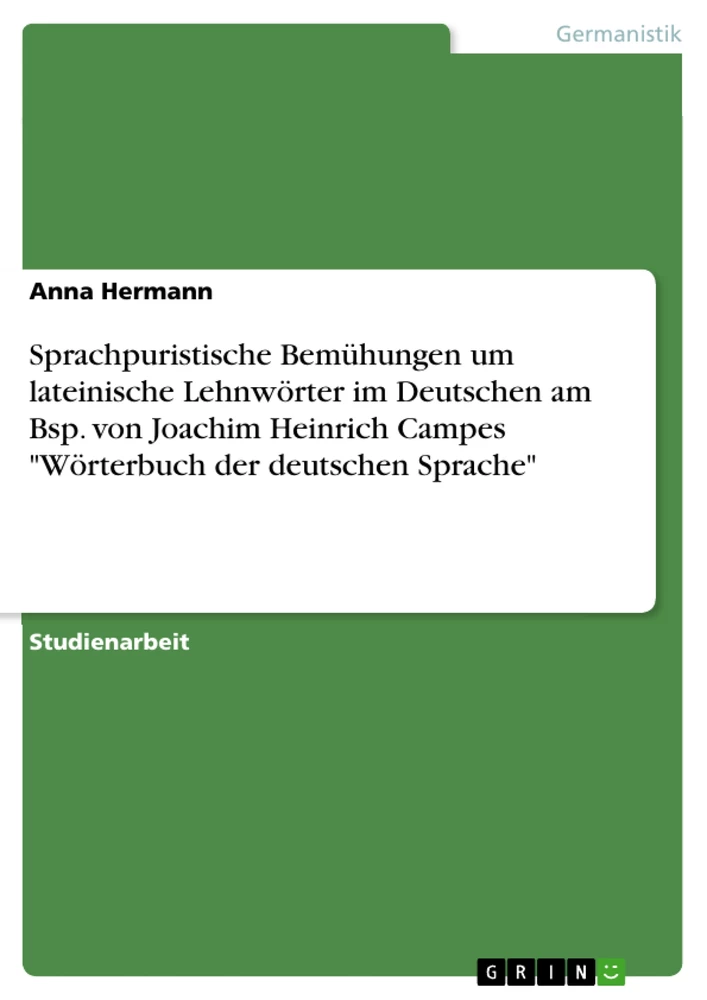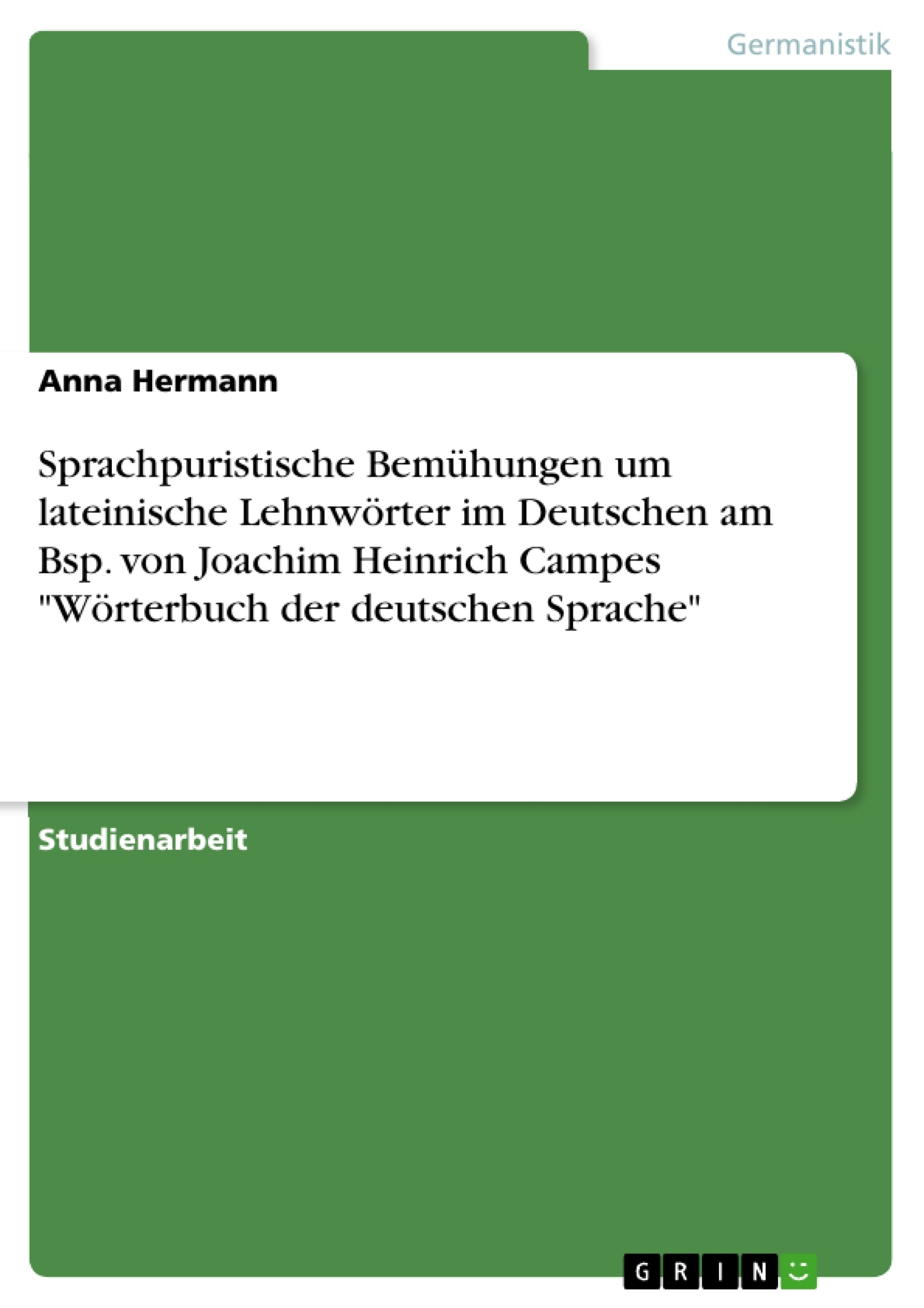Der Sprachpurismus hat in Deutschland eine lange, programmatische Tradition, die sich bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Die einzelnen puristischen Konzeptionen unterscheiden sich dabei teilweise stark in ihrer Motivik und auch in der Behandlung fremdsprachlicher Lexeme.
Diese Hausarbeit gibt am Beispiel von Joachim Heinrich Campe einen Einblick in die sprachpuristischen Bemühungen um lateinische Lehnwörter, die das Deutsche sowohl qualitativ als auch quantitativ im Vergleich zu anderen Gebersprachen am meisten beeinflusst haben.
Dazu werden zunächst die einzelnen Entlehnungsschübe aus dem Lateinischen erläutert. Daran schließt sich eine Erklärung Campes sprachpuristischer Motive und seines Konzepts an. Daraufhin sollen durch eine stichprobenartige empirische Analyse, auf Grundlage von Campes Wörterbuch der deutschen Sprache, seine theoretischen Grundlagen innerhalb der praktischen Umsetzung überprüft werden. Der Fokus liegt dabei auf den Entlehnungen lateinischen Ursprungs. Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse erfolgt dann eine kritische Bewertung Campes sprachpuristischer Konzeptionen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lateinische Lehnwörter im Deutschen
- 2.1 Entlehnungen zur Zeit des römischen Reiches (etwa 1. Jhd. v. Chr. bis 5. Jhd. n. Chr.)
- 2.2 Entlehnungen zur Zeit der Christianisierung (etwa 6. bis 9. Jhd.)
- 2.3 Entlehnungen zur Zeit des Humanismus (etwa 15. bis 16. Jhd.)
- 2.4 Entlehnungen zur Bildung von Kunstwörtern (vorwiegend 19. Jhd.)
- 3. Sprachpurismus in Deutschland
- 3.1 Der Sprachpurist Joachim Heinrich Campe
- 3.1.1 Motive
- 3.1.2 Konzeption
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1 Textkorpus
- 4.2 Leitfragen und methodisches Vorgehen
- 4.3 Untersuchungsergebnisse
- 4.4 Erklärung der Untersuchungsergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die sprachpuristischen Bemühungen um lateinische Lehnwörter im Deutschen am Beispiel des Wörterbuchs von Joachim Heinrich Campe. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entlehnungsphasen des Lateinischen ins Deutsche, analysiert Campes sprachpuristische Motive und Konzeption, und überprüft diese theoretisch anhand einer empirischen Untersuchung von Campes Wörterbuch. Der Fokus liegt dabei auf den Entlehnungen lateinischen Ursprungs.
- Die verschiedenen Entlehnungsphasen des Lateinischen ins Deutsche
- Die sprachpuristischen Motive und Konzeptionen von Joachim Heinrich Campe
- Die empirische Untersuchung von Campes Wörterbuch der deutschen Sprache
- Eine kritische Bewertung von Campes sprachpuristischen Konzeptionen
- Die Bedeutung von lateinischen Lehnwörtern für den deutschen Wortschatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sprachpurismus in Deutschland ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Hausarbeit vor. Kapitel 2 behandelt die Geschichte der lateinischen Lehnwörter im Deutschen und unterscheidet dabei vier verschiedene Entlehnungsphasen: die Zeit des römischen Reiches, die Christianisierung, der Humanismus und die Bildung von Kunstwörtern. Kapitel 3 widmet sich dem Sprachpurismus in Deutschland und stellt den Sprachpuristen Joachim Heinrich Campe vor, indem es seine Motive und seine Konzeption beleuchtet. Kapitel 4 präsentiert die empirische Untersuchung von Campes Wörterbuch der deutschen Sprache, die auf Grundlage einer Stichprobe die theoretischen Grundlagen von Campes Konzeption überprüft. Abschließend wird in Kapitel 5 ein Fazit gezogen, das die Ergebnisse der Hausarbeit zusammenfasst und kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Sprachpurismus, Joachim Heinrich Campe, Lateinische Lehnwörter, Wörterbuch der deutschen Sprache, Entlehnungsphasen, Empirische Untersuchung, Motivik, Konzeption, Kunstwörter, Wortschatzentwicklung, Deutsch als Fremdsprache.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Joachim Heinrich Campe?
Joachim Heinrich Campe war ein bedeutender deutscher Sprachpurist und Pädagoge, der für seine Bemühungen bekannt ist, Fremdwörter durch deutsche Begriffe zu ersetzen.
Wann kamen die meisten lateinischen Lehnwörter ins Deutsche?
Es gab mehrere Schübe: während der römischen Kaiserzeit, der Christianisierung und besonders intensiv während des Humanismus im 15. und 16. Jahrhundert.
Welche Motive hatte der Sprachpurismus im 18./19. Jahrhundert?
Neben nationalistischen Motiven ging es oft um die Verständlichkeit der Sprache für alle Volksschichten und die Reinigung von "unnötigen" Fremdeinflüssen.
Wie erfolgreich waren Campes Verdeutschungen?
Viele seiner Wortschöpfungen (z.B. "Altertum" für "Antike") sind bis heute fest im deutschen Wortschatz verankert, während andere sich nicht durchsetzten.
Was ist ein "Lehnwort" im Gegensatz zu einem "Fremdwort"?
Lehnwörter sind sprachlich so weit angepasst, dass ihr fremder Ursprung kaum noch erkennbar ist (z.B. "Mauer"), während Fremdwörter als solche erkennbar bleiben.
- Quote paper
- Anna Hermann (Author), 2011, Sprachpuristische Bemühungen um lateinische Lehnwörter im Deutschen am Bsp. von Joachim Heinrich Campes "Wörterbuch der deutschen Sprache", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171794