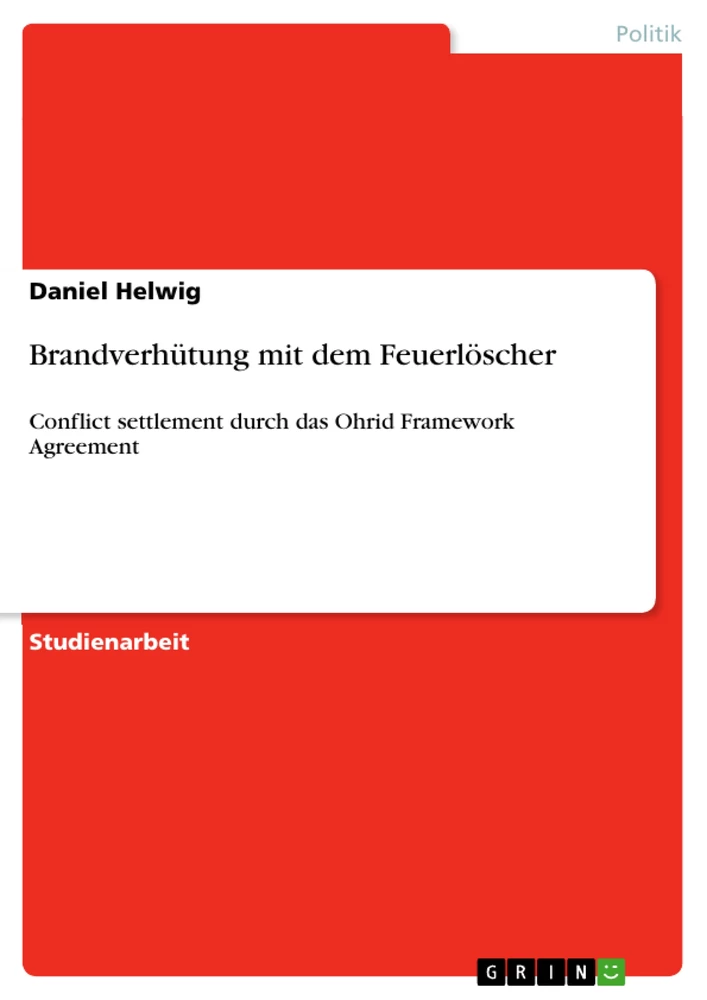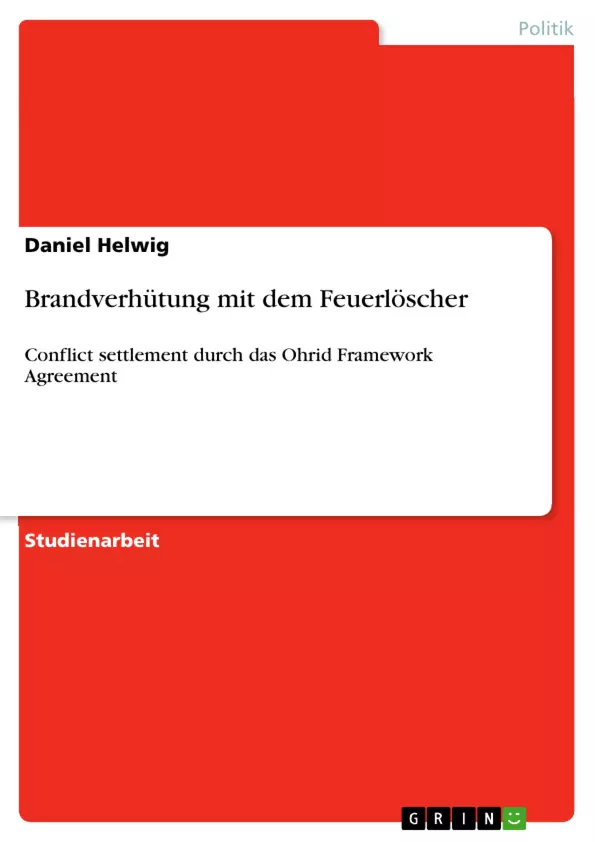Die Arbeit untersucht die langfristig befriedende Wirkung des Ohrid Framework Agreement (OFA), welches 2001 einen mazedonischen Bürgerkrieg verhindern konnte.
Um eine Aussage über die Chancen der Dauerhaftigkeit des interethnischen Friedens in Mazedonien zu treffen, wird ein Analyseraster entwickelt, anhand dessen dafür maßgebliche Einflüsse isoliert werden. Hierfür wird zunächst die besondere Natur eines ethno-nationalen Konflikts vorgestellt und dessen Begründung in einer systematischen Schlechterstellung einer ethno-nationalen Gruppe verdeutlicht. Daraus abgeleitet, erfolgt im Anschluss eine Darstellung von Erfordernissen zur Konfliktregulierung. Es wird hierfür eine Unterscheidung von Konfliktmanagement und Conflict settlement vor-
genommen. Folgend auf den Nachweis, dass insb. die Konkordanzdemokratie zur nachhaltigen Regulierung innerstaatlicher ethnischer Konflikte geeignet ist, wird diese Form demokratischer Entscheidungsfindung hinsichtlich ihrer institutionellen Bausteine untersucht. Damit sie dauerhaft zu Kompromiss und Konsens führen kann, sind begünstigende Faktoren nötig, welche in einem nächsten Abschnitt vorgestellt werden. Aus den theoretischen Erkenntnissen über die Dauerhaftigkeit von konkordanzdemokratischer Konfliktregulierung wird schließlich das anzuwendende Analyseraster formuliert. Das Fallbeispiel OFA wird begonnen durch den Nachweis einer systematischen
Schlechterstellung der albanischen Bevölkerung. Gezeigt wird, dass das Rahmenabkommen versucht, der Diskriminierung durch die Etablierung institutioneller Bausteine einer Konkordanzdemokratie Herr zu werden. Den Vorgaben des Rasters folgend, wird der Implementierungsprozess der OFA-Bestimmungen untersucht und dieser als widerwillig und nicht von Einigungswillen getragen qualifiziert. Weiterführend wird gezeigt, dass die Komposition der begünstigenden Faktoren auch nach fortschreitender Implementierung gegen eine Dauerhaftigkeit spricht. Die Ausführungen führen zu dem Schluss, dass das OFA selbst nicht genügt, um Mazedonien dauerhaft von ethno-nationalem Konflikt zu befreien. Die Implikationen dieses Schlusses für konkordanzdemokratische Konfliktregulierung allgemein als auch für die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für eine Stabilisierung der mazedonischen Situation, werden im abschließenden Teil der Arbeit behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Ethno-nationaler Konflikt
- III. Konfliktregulierung
- IV. Konkordanzdemokratie und power-sharing
- IV.1 Institutionelle Bausteine
- IV.2 Begünstigende Faktoren und Analyseraster
- V. Mazedonien und das OFA
- V.1 Interethnische Beziehungen
- V.2 Power-sharing durch das OFA
- VI. Chancen auf Dauerhaftigkeit?
- VI.1 Umsetzungsprobleme
- VI.2 Faktorenkomposition
- VII. Fazit und Implikationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Ohrid Framework Agreements (OFA) bei der Konfliktregulierung im ethnisch gespaltenen Mazedonien. Der Fokus liegt auf der Analyse der konkordanzdemokratischen Elemente im OFA und deren Eignung zur nachhaltigen Konfliktlösung. Es wird untersucht, ob das OFA als „Feuerlöscher“ fungierte, der den akuten Gewaltausbruch im Jahr 2001 beendete, aber die zugrundeliegenden Spannungen nicht nachhaltig beseitigen konnte.
- Die besondere Natur des ethno-nationalen Konflikts und die systematische Schlechterstellung einer ethno-nationalen Gruppe.
- Die Bedeutung von Konfliktregulierung und die Unterscheidung von Konfliktmanagement und conflict settlement.
- Die Rolle der Konkordanzdemokratie bei der nachhaltigen Regulierung innerstaatlicher ethnischer Konflikte.
- Die Analyse des OFA im Kontext der konkordanzdemokratischen Konfliktregulierung.
- Die Chancen und Herausforderungen der Dauerhaftigkeit des interethnischen Friedens in Mazedonien.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Arbeit stellt die aktuelle Situation in Mazedonien im Kontext des ethno-nationalen Konflikts zwischen Mazedoniern und Albanern vor und erläutert die Zielsetzung der Analyse. Das OFA wird als ein wichtiger Schritt zur Konfliktregulierung vorgestellt, jedoch werden Zweifel an seiner langfristigen Wirksamkeit geäußert.
II. Ethno-nationaler Konflikt: Dieses Kapitel definiert den Begriff des ethno-nationalen Konflikts und erläutert dessen Ursachen und Merkmale. Der Fokus liegt auf der systematischen Benachteiligung einer ethno-nationalen Gruppe durch die Mehrheitsgesellschaft.
III. Konfliktregulierung: Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Ansätzen der Konfliktregulierung, insbesondere der Unterscheidung zwischen Konfliktmanagement und conflict settlement. Es werden die Anforderungen an eine nachhaltige Konfliktlösung beleuchtet.
IV. Konkordanzdemokratie und power-sharing: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Konkordanzdemokratie bei der Regulierung ethnischer Konflikte. Die institutionellen Bausteine der Konkordanzdemokratie werden analysiert und die begünstigenden Faktoren für ihre erfolgreiche Implementierung erörtert.
V. Mazedonien und das OFA: Dieses Kapitel analysiert die interethnischen Beziehungen in Mazedonien und untersucht, inwieweit das OFA versucht, Diskriminierung durch die Etablierung institutioneller Bausteine der Konkordanzdemokratie zu überwinden.
VI. Chancen auf Dauerhaftigkeit?: Dieses Kapitel untersucht die Umsetzung des OFA und analysiert die Faktoren, die für oder gegen eine dauerhafte Konfliktlösung sprechen. Es wird gezeigt, dass die Implementierung des OFA nicht von Einigungswillen geprägt war und die Komposition der begünstigenden Faktoren eine dauerhafte Lösung in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Ethno-nationaler Konflikt, Konfliktregulierung, Konkordanzdemokratie, power-sharing, Ohrid Framework Agreement (OFA), Mazedonien, Albaner, Mazedonier, interethnischer Frieden, Dauerhaftigkeit, Umsetzungsprobleme.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Ohrid Framework Agreement (OFA)?
Das Abkommen von 2001 sollte den drohenden Bürgerkrieg in Mazedonien verhindern und den ethnischen Konflikt zwischen Mazedoniern und Albanern befrieden.
Was versteht man unter „Konkordanzdemokratie“ in diesem Kontext?
Es ist eine Regierungsform, die auf Machtteilung (Power-sharing) und Proporz basiert, um Minderheiten in gespaltenen Gesellschaften aktiv einzubinden.
Warum wird das OFA als „Feuerlöscher“ bezeichnet?
Weil es zwar den akuten Gewaltausbruch löschte, aber die tieferliegenden Ursachen des ethno-nationalen Konflikts laut Analyse nicht nachhaltig beseitigen konnte.
Welche Umsetzungsprobleme gab es beim OFA?
Der Implementierungsprozess war oft widerwillig und nicht von echtem Einigungswillen der politischen Akteure getragen.
Was ist das Fazit zur Dauerhaftigkeit des Friedens?
Das OFA allein genügt wahrscheinlich nicht, um Mazedonien dauerhaft stabil zu halten; es bedarf weiterer Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft.
- Quote paper
- Daniel Helwig (Author), 2011, Brandverhütung mit dem Feuerlöscher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171816