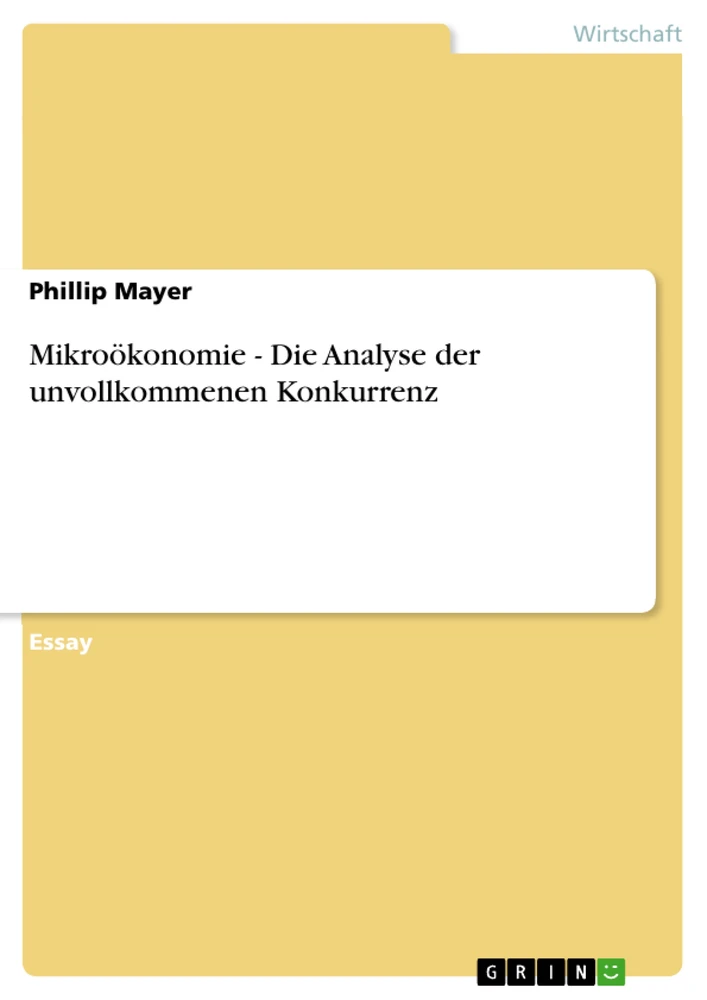Kurzfassung
Der Wettbewerbskapitalismus, als idealtypisches Wirtschaftssystem gehört seit Beginn des 20. Jahrhundert unwiederbringlich der Vergangenheit an. Der Wettbewerb der großen Volkswirtschaften wird von relativ wenigen, marktmächtigen Großunternehmen geprägt. In diesem Stadium der Konzentration und Zentralisation der Unternehmensmacht folgt die Bestimmung von Preisen und Mengen nicht mehr den Gesetzmäßigkeiten, die in einer Situation vollkommener Konkurrenz herrscht. Um daher ein realistisches Bild des Wettbewerbs zu erhalten, widmet sich die vorliegende Studienarbeit, dem Modell der unvollständigen Konkurrenz.
Abstract
The competition-capitalism as a characteristic ideal economic system belongs since the beginning of the 20th century to the past. Ever since the competition of the biggest economies is affected by relatively few and market powerfully companies. In this new position state of concentration and centralisation the determination of prices and quantity doesn’t match the regularities of the perfect competition. Therefore target of this paper is, to create a realistic picture of the imperfect competition.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Hinleitung zur Thematik
- 1.2 Wesen und Formen von Märkten
- 1.3 Konzentration
- 1.4 Vollkommene Konkurrenz
- 1.5 Unvollkommene Konkurrenz
- 2 Marktmacht und Marktversagen
- 2.1 Externalitäten
- 2.2 Öffentliche Güter
- 3 Monopol
- 3.1 Marktform im Monopol
- 3.2 Ursachen von Monopolen
- 3.3 Preisabsatzfunktion im Monopol
- 3.4 Wohlfahrtsverlust im Monopol
- 3.5 Preisdifferenzierung und Effizienz im Monopol
- 4 Oligopol
- 4.1 Marktform im Oligopol
- 4.2 Oligopolistischer Mengenwettbewerb
- 4.3 Oligopolistischer Preiswettbewerb
- 4.4 Einflussfaktoren im Oligopol
- 5 Monopolistische Konkurrenz
- 5.1 Marktform der monopolistischen Konkurrenz
- 5.2 Monopolistische Konkurrenz nach Hotelling
- 5.3 Monopolisitische Konkurrenz nach Chamberlin
- 6 Interventionsstrategie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Modell der unvollkommenen Konkurrenz als realistischeres Abbild des modernen Wettbewerbs im Gegensatz zum idealtypischen Modell der vollkommenen Konkurrenz. Sie untersucht die verschiedenen Marktformen, die im Rahmen unvollkommener Konkurrenz auftreten, und deren Auswirkungen auf Preisbildung und Wohlfahrt.
- Analyse der unvollkommenen Konkurrenz als Gegenstück zur vollkommenen Konkurrenz
- Untersuchung verschiedener Marktformen (Monopol, Oligopol, monopolistische Konkurrenz)
- Beschreibung der Auswirkungen von Marktmacht auf Preise und Mengen
- Analyse von Marktversagen wie Externalitäten und öffentlichen Gütern
- Betrachtung möglicher Interventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Analyse der unvollkommenen Konkurrenz. Es beginnt mit einer Einführung in die Thematik und erläutert das Wesen und die Formen von Märkten, einschließlich des Konzepts der Konzentration. Es werden die Modelle der vollkommenen und unvollkommenen Konkurrenz kontrastiert, um den Kontext für die spätere detailliertere Untersuchung der unvollkommenen Marktstrukturen zu schaffen. Die Unterscheidung zwischen idealisierten und realen Marktbedingungen bildet den zentralen Punkt dieses einleitenden Kapitels, das die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel liefert.
2 Marktmacht und Marktversagen: Dieses Kapitel befasst sich mit den negativen Folgen von Marktmacht und Marktversagen. Es definiert und erläutert detailliert Externalitäten und öffentliche Güter als zentrale Beispiele für Marktversagen. Die Analyse dieser Aspekte hebt die Bedeutung staatlicher Intervention hervor, um die Allokation von Ressourcen zu optimieren und negative Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt zu minimieren. Es dient als Brücke zum Verständnis, warum unvollkommene Märkte nicht immer effizient sind.
3 Monopol: Das Kapitel konzentriert sich auf die Marktform des Monopols, analysiert seine Ursachen, die Preisbildung unter Monopolbedingungen und die resultierenden Wohlfahrtsverluste. Es untersucht verschiedene Strategien der Preisdifferenzierung und deren Auswirkungen auf die Effizienz. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Mechanismen, die zu Monopolen führen, wie z.B. hohe Markteintrittsbarrieren oder staatliche Regulierungen, und deren Konsequenzen für Konsumenten und die Gesellschaft.
4 Oligopol: Dieses Kapitel befasst sich mit der Marktform des Oligopols, charakterisiert durch wenige, miteinander konkurrierende Unternehmen. Es analysiert verschiedene Wettbewerbsformen im Oligopol, wie Mengen- und Preiswettbewerb, und deren Auswirkungen auf die Preisbildung und die Marktstruktur. Der Einfluss von Faktoren wie die gegenseitige Abhängigkeit der Unternehmen und die strategischen Entscheidungen werden detailliert untersucht. Die Komplexität des strategischen Verhaltens im Oligopol im Gegensatz zu anderen Marktformen steht im Mittelpunkt.
5 Monopolistische Konkurrenz: Das Kapitel beschreibt die Marktform der monopolistischen Konkurrenz, die durch viele Unternehmen mit leicht differenzierten Produkten gekennzeichnet ist. Es werden die Modelle von Hotelling und Chamberlin vorgestellt und verglichen, um die Besonderheiten dieser Marktstruktur herauszuarbeiten und deren Auswirkungen auf Preisbildung und Wettbewerb zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Produktdifferenzierung als zentralem Merkmal und deren Folgen für die Marktstruktur und das Konsumentenverhalten.
Schlüsselwörter
Unvollkommene Konkurrenz, vollkommene Konkurrenz, Monopol, Oligopol, monopolistische Konkurrenz, Marktmacht, Marktversagen, Externalitäten, öffentliche Güter, Preisbildung, Wohlfahrtsverlust, Preisdifferenzierung, Interventionsstrategien, Konzentration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text über Unvollkommene Konkurrenz
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Theorie der unvollkommenen Konkurrenz. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Text vergleicht die unvollkommene Konkurrenz mit dem idealisierten Modell der vollkommenen Konkurrenz und analysiert verschiedene Marktformen wie Monopol, Oligopol und monopolistische Konkurrenz.
Welche Marktformen werden behandelt?
Der Text behandelt die folgenden Marktformen im Detail: vollkommene Konkurrenz, unvollkommene Konkurrenz, Monopol, Oligopol und monopolistische Konkurrenz. Für jede Marktform werden die charakteristischen Merkmale, die Preisbildung und die Auswirkungen auf die Wohlfahrt beschrieben.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind die Analyse der unvollkommenen Konkurrenz im Vergleich zur vollkommenen Konkurrenz, die Untersuchung verschiedener Marktformen (Monopol, Oligopol, monopolistische Konkurrenz), die Beschreibung der Auswirkungen von Marktmacht auf Preise und Mengen, die Analyse von Marktversagen (Externalitäten und öffentliche Güter) und die Betrachtung möglicher Interventionsstrategien.
Wie wird das Monopol behandelt?
Das Kapitel zum Monopol analysiert die Ursachen von Monopolen, die Preisbildung unter Monopolbedingungen, die resultierenden Wohlfahrtsverluste und verschiedene Strategien der Preisdifferenzierung. Es untersucht, wie Monopolmechanismen zu hohen Markteintrittsbarrieren oder staatlichen Regulierungen führen und welche Folgen dies für Konsumenten und die Gesellschaft hat.
Wie wird das Oligopol behandelt?
Das Kapitel zum Oligopol beschreibt die Marktform, die durch wenige konkurrierende Unternehmen gekennzeichnet ist. Es analysiert verschiedene Wettbewerbsformen (Mengen- und Preiswettbewerb) und deren Auswirkungen auf die Preisbildung und die Marktstruktur. Die gegenseitige Abhängigkeit der Unternehmen und deren strategische Entscheidungen werden detailliert untersucht. Die Komplexität des strategischen Verhaltens im Oligopol im Vergleich zu anderen Marktformen steht im Mittelpunkt.
Wie wird die monopolistische Konkurrenz behandelt?
Die monopolistische Konkurrenz, gekennzeichnet durch viele Unternehmen mit leicht differenzierten Produkten, wird durch die Modelle von Hotelling und Chamberlin erläutert und verglichen. Der Text analysiert die Auswirkungen der Produktdifferenzierung auf die Marktstruktur, die Preisbildung und das Konsumentenverhalten.
Was sind Externalitäten und öffentliche Güter im Kontext des Textes?
Externalitäten und öffentliche Güter werden als zentrale Beispiele für Marktversagen im Kapitel "Marktmacht und Marktversagen" behandelt. Ihre Analyse verdeutlicht die Notwendigkeit staatlicher Intervention zur Optimierung der Ressourcenallokation und zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Unvollkommene Konkurrenz, vollkommene Konkurrenz, Monopol, Oligopol, monopolistische Konkurrenz, Marktmacht, Marktversagen, Externalitäten, öffentliche Güter, Preisbildung, Wohlfahrtsverlust, Preisdifferenzierung, Interventionsstrategien, Konzentration.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text eignet sich für Studierende der Wirtschaftswissenschaften und alle, die sich umfassend mit der Theorie der unvollkommenen Konkurrenz auseinandersetzen möchten. Das Verständnis der grundlegenden wirtschaftlichen Prinzipien wird vorausgesetzt.
Wo finde ich weitere Informationen?
Für weiterführende Informationen empfiehlt sich die Literaturrecherche zu den genannten Schlüsselbegriffen und Marktformen in wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern und Fachartikeln.
- Citar trabajo
- Phillip Mayer (Autor), 2008, Mikroökonomie - Die Analyse der unvollkommenen Konkurrenz , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171861