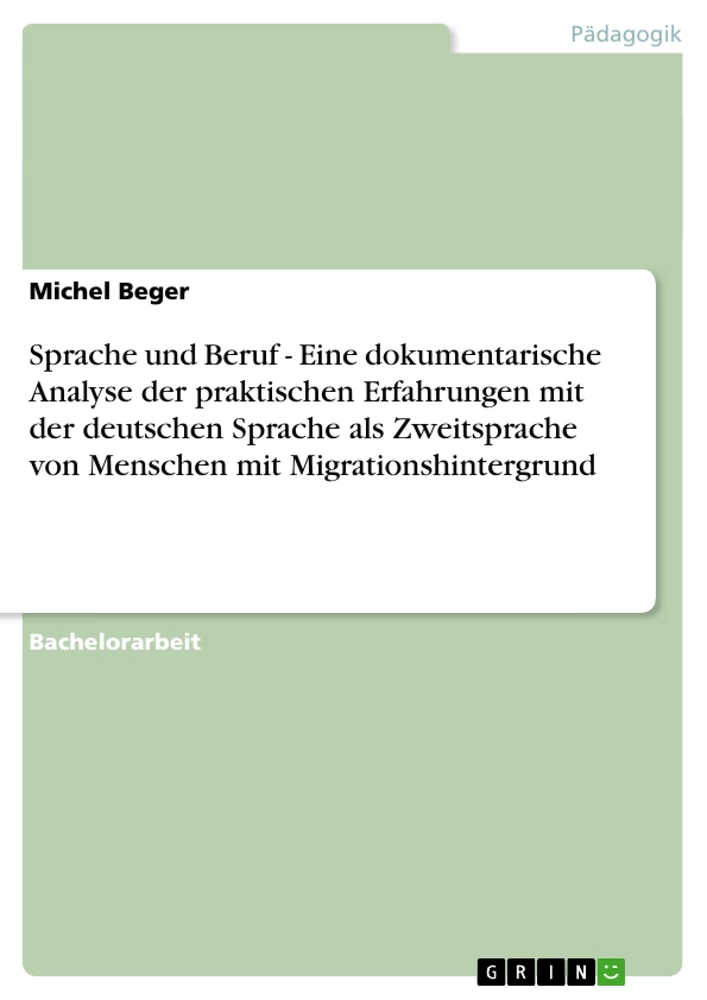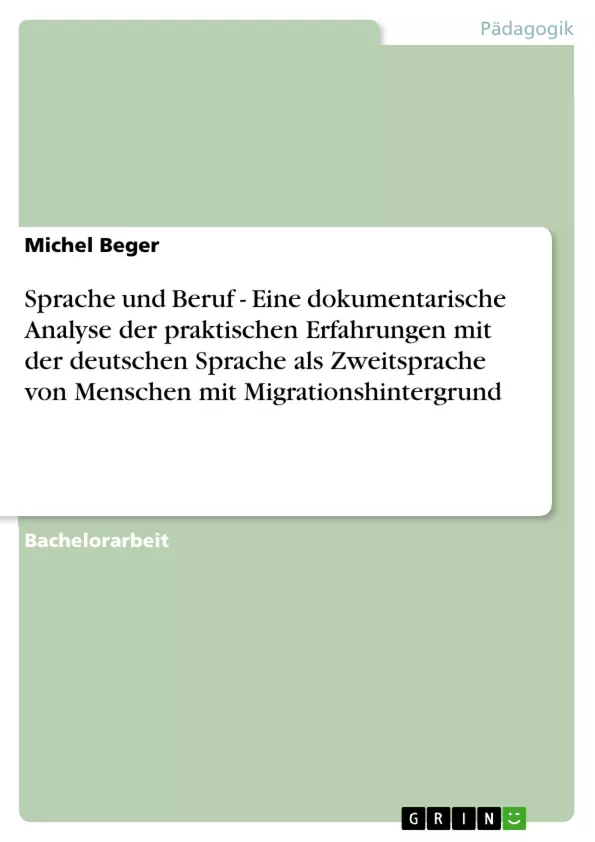[...] Die Sprache als gemeinsames Medium bietet die Chance mit einheimischen Kollegen, Vorgesetzten und Klienten zu kommunizieren und zusammen zu arbeiten. In dieser Studie werde ich genau darauf eingehen. Ich werde dabei verschiedene Erfahrungshorizonte aufzeigen, die MigrantInnen während ihrer beruflichen Zeit wahrgenommen haben.
Es geht mir also darum darzustellen, wie MigrantInnen sprachliche Erfahrungen wahrnehmen und ob und inwieweit Merkmale der Sprache für deren Rolle auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind. Ich werde weiterhin diese Erfahrungen – soweit dies möglich ist – in theoretische Grundlagen und bestehende empirische Forschungen einordnen. Schließlich soll dann die Frage beantwortet werden, inwieweit die deutsche Sprache als Zweitsprache von MigrantInnen den beruflichen Alltag bestimmt oder nur zweitrangig eine Rolle spielt, wobei ich auch auf dabei entstehende Effekte eingehen werde. Diese Arbeit hat dabei nicht die Absicht spezifische Typenbildungen vorzunehmen, welche die untersuchten MigrantInnen repräsentativ darstellen, sondern einzig die Erfahrungen herauszukristallisieren und mit theoretischen Ansätzen und anderen empirischen Studien zu vergleichen. Ich beginne zunächst mit einer allgemeinen Darstellung des Themas „Arbeitsmigration“ und beziehe dieses nach einem anfänglichen historischen Exkurs auf den sprachlichen Aspekt und dessen Zusammenwirken mit dem Arbeitsmarkt (2.). Um diese Studie verorten zu können, werde ich danach eine Skizzierung bestehender Forschungen und Studien vornehmen (3.). Im Anschluss daran stelle ich die hier vorliegende Studie vor und gehe dabei zunächst auf die Biografien der Interviewten ein, um dann das narrativ fundierte Interview und die dokumentarische Methode zu erläutern (4.). Daran anknüpfend stelle ich die Ergebnisse der Interviews anhand fünf markanter Punkte vor: der Einstieg in den Arbeitsmarkt (5.1.); die rechtliche Exklusion bei der Nicht-Anerkennung des ausländischen Bildungstitels (5.2.); der sprachliche Umgang in interkulturellen Arbeitsgesprächen (5.3.); Klassifizierung und Diskriminierung (5.4.) und die Kompensation von sprachlichen Fähigkeiten durch fachliche Kompetenzen (5.5.). In einer abschließenden Zusammenfassung möchte ich Vergleichshorizonte zu anderen Studien herstellen (5.6.) und schließlich in einem Fazit einen Ausblick auf die weitere Forschung geben (6.).
Inhaltsverzeichnis
- ZUR EINFÜHRUNG
- IMMIGRATION UND ARBEITSMARKT IN DEUTSCHLAND UNTER SPRACHTHEORETISCHEN BEDINGUNGEN
- Arbeitsmigration und „Gastarbeiterdeutsch“
- Sprachtheoretische Grundlagen unter individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- STAND DER FORSCHUNG
- FELDFORSCHUNG
- Die interviewten MigrantInnen
- Das narrativ fundierte Interview: theoretische Grundlagen und praktische Herausforderungen im Umgang mit MigrantInnen
- Die dokumentarische Methode
- ERFAHRUNGEN MIT DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF DEM ARBEITSMARKT
- Der Einstieg in den Arbeitsmarkt – oder „Ich hatte mit dem Meister erst mit Handzeichen kommuniziert dan hat er langsam erzählt“
- Rechtliche Exklusion bei der Nicht-Anerkennung des ausländischen Bildungstitels – oder „ohne wenn und aber mindestens Deutsch C2“
- Der sprachliche Umgang in interkulturellen Arbeitsgesprächen – oder „Ich verstehe nicht, können Sie nochmal sagen?“
- Klassifizierung und Diskriminierung – oder „Sie hat mich so richtig zur Schnecke gemacht“
- Die Kompensation von sprachlichen Fähigkeiten durch fachliche Kompetenzen - oder „Manchmal ist es auch nicht nur das Verstehen“
- Abschließende Betrachtung
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den praktischen Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund mit der deutschen Sprache im Berufsleben. Ziel ist es, die Rolle der Sprache als Zweitsprache im Kontext der Arbeitswelt zu untersuchen und aufzuzeigen, wie sie den beruflichen Alltag beeinflusst.
- Die Bedeutung der deutschen Sprache als Schlüsselqualifikation für den Arbeitsmarkt
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der sprachlichen Diversität in der Arbeitswelt ergeben
- Die Auswirkungen von sprachlichen Barrieren auf die berufliche Integration von MigrantInnen
- Die Rolle von interkultureller Kompetenz in der Kommunikation am Arbeitsplatz
- Die Bedeutung von Bildung und Sprachförderung für den Erfolg von MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
- Zur Einführung: Die Einleitung stellt das Thema "Sprache und Beruf" vor und erläutert die Relevanz der deutschen Sprache für die Integration von MigrantInnen in den Arbeitsmarkt. Sie beleuchtet die Bedeutung von Sprachkompetenz für den beruflichen Erfolg und die Herausforderungen, die sich aus der sprachlichen Diversität ergeben.
- Immigration und Arbeitsmarkt in Deutschland unter sprachtheoretischen Bedingungen: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Arbeitsmigration in Deutschland und die Rolle der Sprache im Kontext der "Gastarbeiter"-Thematik. Es beleuchtet die sprachtheoretischen Grundlagen und die Bedeutung von individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die sprachliche Integration.
- Stand der Forschung: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die bestehende Forschung zum Thema Sprache und Arbeitsmarkt in Deutschland. Er beleuchtet verschiedene Studien und Forschungsansätze, die sich mit den Erfahrungen von MigrantInnen im Berufsleben auseinandersetzen.
- Feldforschung: Hier wird die durchgeführte Feldforschung vorgestellt, die auf narrativen Interviews mit MigrantInnen basiert. Es werden die InterviewpartnerInnen vorgestellt und die theoretischen Grundlagen des narrativ fundierten Interviews sowie die dokumentarische Methode erläutert.
- Erfahrungen mit der deutschen Sprache auf dem Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews und analysiert die Erfahrungen von MigrantInnen im Berufsleben. Es beleuchtet verschiedene Aspekte wie den Einstieg in den Arbeitsmarkt, die rechtliche Exklusion durch die Nicht-Anerkennung ausländischer Bildungstitel, den sprachlichen Umgang in interkulturellen Arbeitsgesprächen, Klassifizierung und Diskriminierung sowie die Kompensation von sprachlichen Fähigkeiten durch fachliche Kompetenzen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Sprachkompetenz, Arbeitsmarkt, Integration, Migration, Interkulturelle Kommunikation, Diskriminierung, Bildung, Sprachförderung, und Erfahrungen von MigrantInnen im Berufsleben.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die deutsche Sprache für Migranten im Beruf?
Die deutsche Sprache dient als Schlüsselmedium für die Kommunikation mit Kollegen und Vorgesetzten und beeinflusst maßgeblich die Rolle und Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Was versteht man unter "Gastarbeiterdeutsch"?
Der Begriff bezieht sich auf die historische Arbeitsmigration nach Deutschland und die spezifischen sprachlichen Entwicklungen und Barrieren, die diese Generation prägten.
Wie wirkt sich die Nicht-Anerkennung ausländischer Abschlüsse aus?
Dies führt oft zu rechtlicher Exklusion. Migranten müssen trotz hoher Qualifikation oft Sprachzertifikate auf C2-Niveau vorweisen oder arbeiten unter ihrem eigentlichen Kompetenzniveau.
Können fachliche Kompetenzen mangelnde Sprachkenntnisse ausgleichen?
Ja, die Studie zeigt, dass Migranten fehlende sprachliche Fähigkeiten oft durch herausragende fachliche Kompetenzen kompensieren, um sich im Arbeitsalltag zu behaupten.
Welche Methodik wurde für diese Untersuchung verwendet?
Die Arbeit nutzt narrativ fundierte Interviews und die dokumentarische Methode, um die individuellen Erfahrungshorizonte der Migranten tiefgreifend zu analysieren.
Kommt es im Arbeitsalltag zu Diskriminierung aufgrund der Sprache?
Die Interviews belegen Erfahrungen von Klassifizierung und Diskriminierung, die oft direkt mit dem sprachlichen Ausdrucksvermögen der Migranten verknüpft sind.
- Quote paper
- B.A Bildungs- und Erziehungswissenschaftler Michel Beger (Author), 2011, Sprache und Beruf - Eine dokumentarische Analyse der praktischen Erfahrungen mit der deutschen Sprache als Zweitsprache von Menschen mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171879