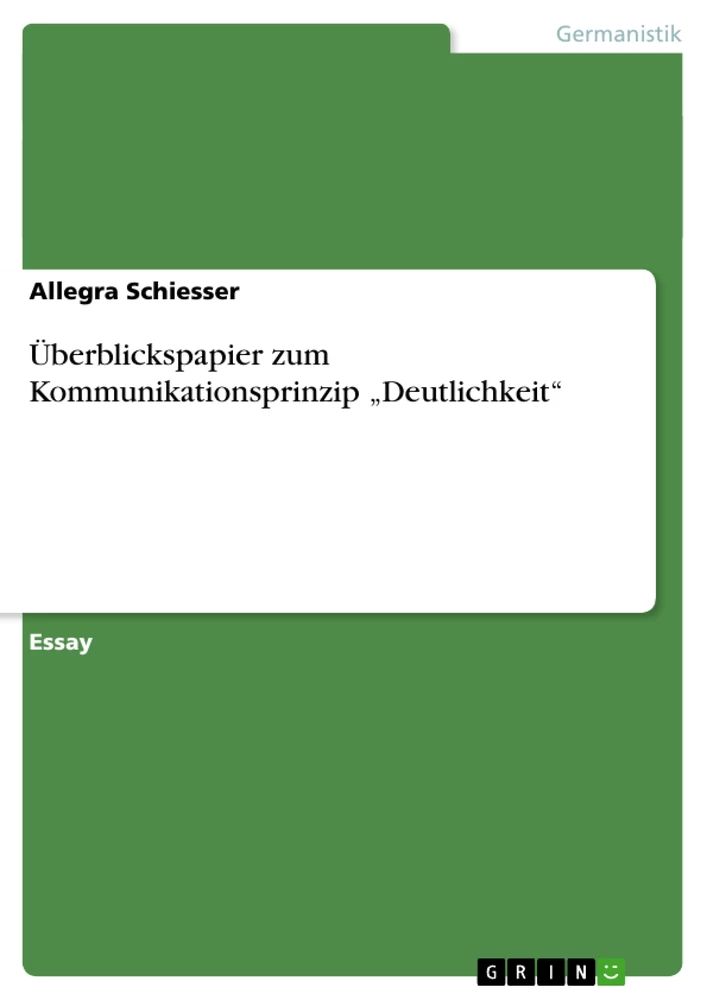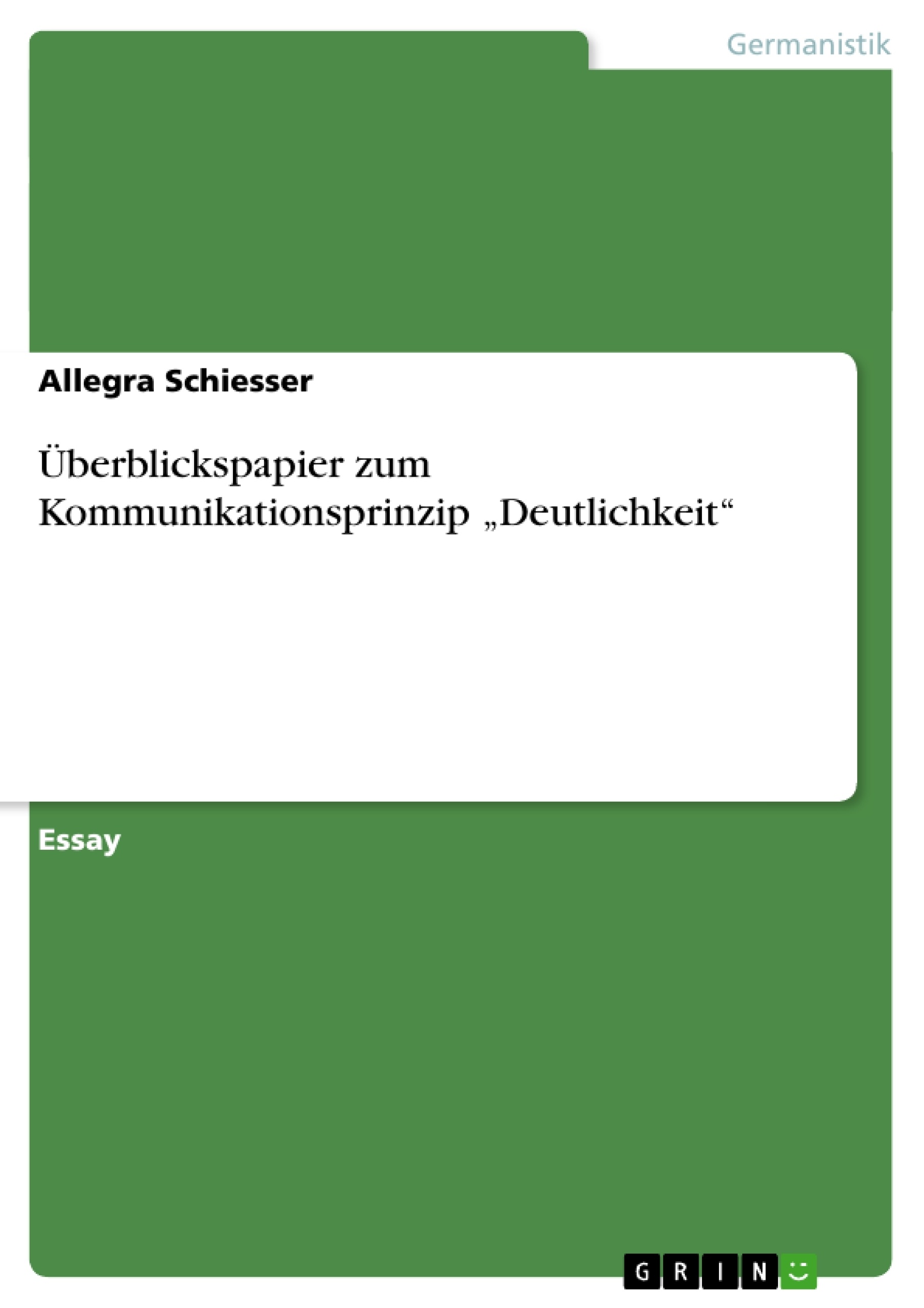Deutlichkeit als Kommunikationsprinzip gibt es schon seit der Antike (Asmuth 2003, S.
814). Was aber genau unter „Deutlichkeit“ verstanden wird, hat sich im Laufe der Geschichte
verändert. Ebenso existieren unterschiedliche Bezeichnungen für das kommunikative
Konzept der Deutlichkeit, und die Geltungsbereiche des Kommunikationsprinzips
verschoben sich über die Jahre.
Das Ziel war es, herauszufinden, was unter dem Kommunikationsprinzip „Deutlichkeit“
verstanden wird und wurde, welche unterschiedlichen Bezeichnungen dafür existier(t)en
und welche Aspekte dadurch jeweils hervorgehoben wurden, und welches die Geltungsbereiche
von Deutlichkeit sind und waren. Dazu wurden Textstellen aus Stilistiken,
Briefstellern, Anstandsbüchern etc. ab dem 18. Jh. bis zur Gegenwart auf Erwähnungen
und Beschreibungen von Deutlichkeit hin untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deutlichkeit als Kommunikationsprinzip
- 3. Entwicklung in der Geschichte
- 3.4 Nähe zu anderen Kommunikationsidealen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Kommunikationsprinzip der „Deutlichkeit“ von der Antike bis zur Gegenwart. Ziel ist es, den Wandel des Verständnisses von Deutlichkeit aufzuzeigen, unterschiedliche Bezeichnungen zu beleuchten und die jeweiligen Geltungsbereiche zu analysieren.
- Entwicklung des Verständnisses von „Deutlichkeit“ im Laufe der Geschichte
- Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Begriffen wie „Deutlichkeit“, „Klarheit“ und „Verständlichkeit“
- Geltungsbereiche des Kommunikationsprinzips „Deutlichkeit“ in verschiedenen historischen Kontexten
- Beziehung der „Deutlichkeit“ zu anderen Kommunikationsidealen (z.B. Kürze, Natürlichkeit)
- Dualität von Inhalts- und Ausdrucksebene bei der „Deutlichkeit“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Erforschung des Kommunikationsprinzips „Deutlichkeit“ über die Jahrhunderte hinweg, inklusive der verschiedenen Bezeichnungen und Geltungsbereiche. Es wird die methodische Vorgehensweise skizziert, die auf der Analyse von Textstellen aus Stilistiken, Briefstellern und Anstandsbüchern basiert.
2. Deutlichkeit als Kommunikationsprinzip: Dieses Kapitel definiert „Deutlichkeit“ als ein grundlegendes Kommunikationsprinzip, das Verständlichkeit sicherstellt. Es wird zwischen inhaltlicher und ausdrucksbezogener Deutlichkeit unterschieden. Kennzeichen der Deutlichkeit werden erläutert, wie Eindeutigkeit, gute Anordnung, Ausführlichkeit, Anschaulichkeit und Verständlichkeit. Die historischen Bezeichnungen wie „saphéneia“ und „Perspicuitas“ werden diskutiert und deren Wandel im Verständnis beleuchtet, mit einem Fokus auf die zunehmende Synonymität mit „Klarheit“ seit der Aufklärung. Die unterschiedlichen Schwerpunkte auf Inhalts- und Ausdrucksseite werden herausgestellt. Schließlich wird der Stellenwert von Deutlichkeit in verschiedenen Kontexten – vom Gerichtswesen bis hin zu Briefen und wissenschaftlichen Texten – erörtert. Die Ausnahme der Dichtung wird ebenfalls hervorgehoben.
3. Entwicklung in der Geschichte: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Verständnisses von „Deutlichkeit“. Es zeigt, wie sich der Fokus von der Antike, in der die sinnliche Gestaltung der Sprache betont wurde, zur Aufklärung hin verlagerte, in der die gedankliche Klarheit in den Vordergrund rückte. Die Entwicklung wird mit Bezug auf Adelung erläutert. Die zunehmende Bedeutung und der breitere Geltungsbereich von „Deutlichkeit“ seit der Aufklärung, sowie der Rückgang der Bedeutung von sprachlichem Schmuck, werden deutlich gemacht.
3.4 Nähe zu anderen Kommunikationsidealen: Dieses Unterkapitel untersucht die Beziehung von „Deutlichkeit“ zu anderen Kommunikationsidealen, insbesondere Kürze, Natürlichkeit, Objektivität, Sachlichkeit, Richtigkeit und Reinheit. Es wird herausgestellt, wie eine zu kurze oder zu lange Sprache die Deutlichkeit beeinträchtigen kann, und wie „Deutlichkeit“ eng mit den Idealen der sachlichen und objektiven Sprache verwandt ist. Die Bedeutung von Richtigkeit und Reinheit der Sprache für die Verständlichkeit und somit für die Deutlichkeit wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Deutlichkeit, Klarheit, Verständlichkeit, Kommunikationsprinzip, Geschichte der Rhetorik, Stilistik, Aufklärung, Saphéneia, Perspicuitas, Inhalts- und Ausdrucksebene, Kürze, Natürlichkeit, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Deutlichkeit als Kommunikationsprinzip"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht das Kommunikationsprinzip der „Deutlichkeit“ von der Antike bis zur Gegenwart. Er analysiert den Wandel des Verständnisses von Deutlichkeit, beleuchtet unterschiedliche Bezeichnungen und analysiert die jeweiligen Geltungsbereiche in verschiedenen historischen Kontexten.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, den Wandel des Verständnisses von Deutlichkeit aufzuzeigen, unterschiedliche Bezeichnungen wie „saphéneia“ und „Perspicuitas“ zu beleuchten und die jeweiligen Geltungsbereiche von Deutlichkeit in verschiedenen historischen Kontexten zu analysieren. Es wird auch die Beziehung zu anderen Kommunikationsidealen untersucht.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entwicklung des Verständnisses von „Deutlichkeit“ im Laufe der Geschichte, die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Begriffen wie „Deutlichkeit“, „Klarheit“ und „Verständlichkeit“, den Stellenwert der Deutlichkeit in verschiedenen historischen Kontexten, die Beziehung der „Deutlichkeit“ zu anderen Kommunikationsidealen (z.B. Kürze, Natürlichkeit) und die Dualität von Inhalts- und Ausdrucksebene bei der „Deutlichkeit“.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von „Deutlichkeit“ als Kommunikationsprinzip, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Verständnisses von Deutlichkeit, ein Unterkapitel zur Nähe zu anderen Kommunikationsidealen (Kürze, Natürlichkeit, Objektivität etc.) und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und Methodik. Kapitel 2 definiert Deutlichkeit und beleuchtet historische Bezeichnungen. Kapitel 3 analysiert die historische Entwicklung, insbesondere den Wandel vom antiken Fokus auf sinnliche Gestaltung zur aufklärerischen Betonung gedanklicher Klarheit. Kapitel 3.4 untersucht die Beziehung zu anderen Kommunikationsidealen. Der genaue Inhalt jedes Kapitels ist in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Methoden werden im Text angewendet?
Die methodische Vorgehensweise basiert auf der Analyse von Textstellen aus Stilistiken, Briefstellern und Anstandsbüchern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Deutlichkeit, Klarheit, Verständlichkeit, Kommunikationsprinzip, Geschichte der Rhetorik, Stilistik, Aufklärung, Saphéneia, Perspicuitas, Inhalts- und Ausdrucksebene, Kürze, Natürlichkeit, Objektivität.
Wie wird „Deutlichkeit“ im Text definiert?
„Deutlichkeit“ wird als ein grundlegendes Kommunikationsprinzip definiert, das Verständlichkeit sicherstellt. Es wird zwischen inhaltlicher und ausdrucksbezogener Deutlichkeit unterschieden. Kennzeichen sind Eindeutigkeit, gute Anordnung, Ausführlichkeit, Anschaulichkeit und Verständlichkeit.
Wie hat sich das Verständnis von „Deutlichkeit“ im Laufe der Geschichte verändert?
Der Fokus verlagerte sich von der Antike, wo die sinnliche Gestaltung der Sprache betont wurde, zur Aufklärung, wo die gedankliche Klarheit in den Vordergrund rückte. Die zunehmende Bedeutung und der breitere Geltungsbereich von „Deutlichkeit“ seit der Aufklärung, sowie der Rückgang der Bedeutung von sprachlichem Schmuck, werden hervorgehoben.
Welche Beziehung besteht zwischen „Deutlichkeit“ und anderen Kommunikationsidealen?
Der Text untersucht die Beziehung von „Deutlichkeit“ zu anderen Idealen wie Kürze, Natürlichkeit, Objektivität, Sachlichkeit, Richtigkeit und Reinheit. Es wird gezeigt, wie z.B. eine zu kurze oder zu lange Sprache die Deutlichkeit beeinträchtigen kann, und wie „Deutlichkeit“ eng mit den Idealen der sachlichen und objektiven Sprache verwandt ist.
- Arbeit zitieren
- Allegra Schiesser (Autor:in), 2008, Überblickspapier zum Kommunikationsprinzip „Deutlichkeit“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171886