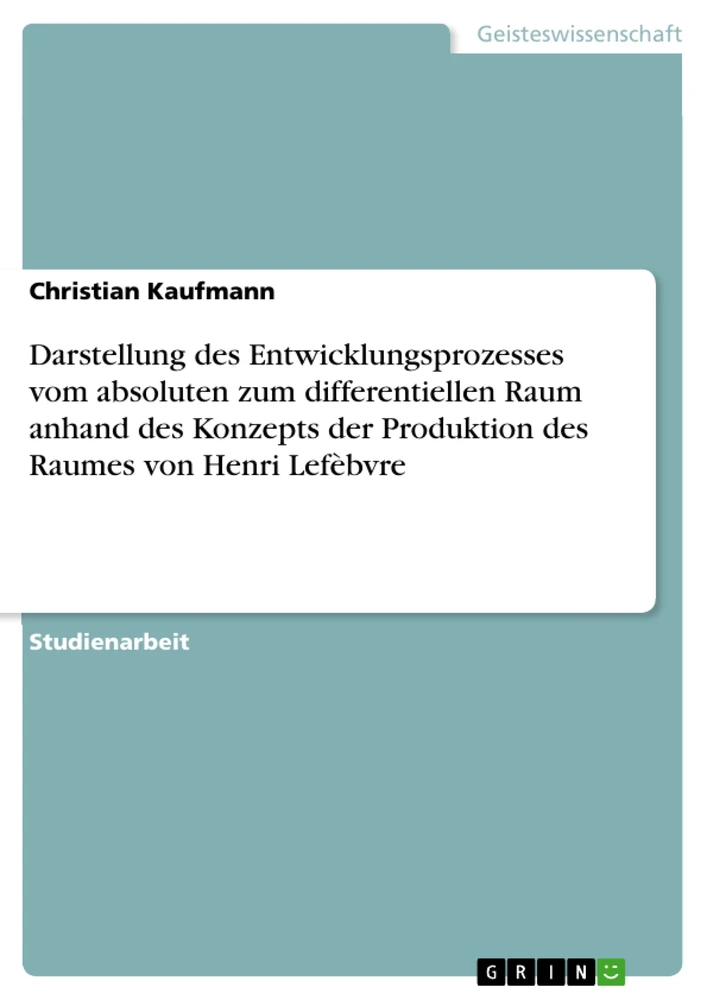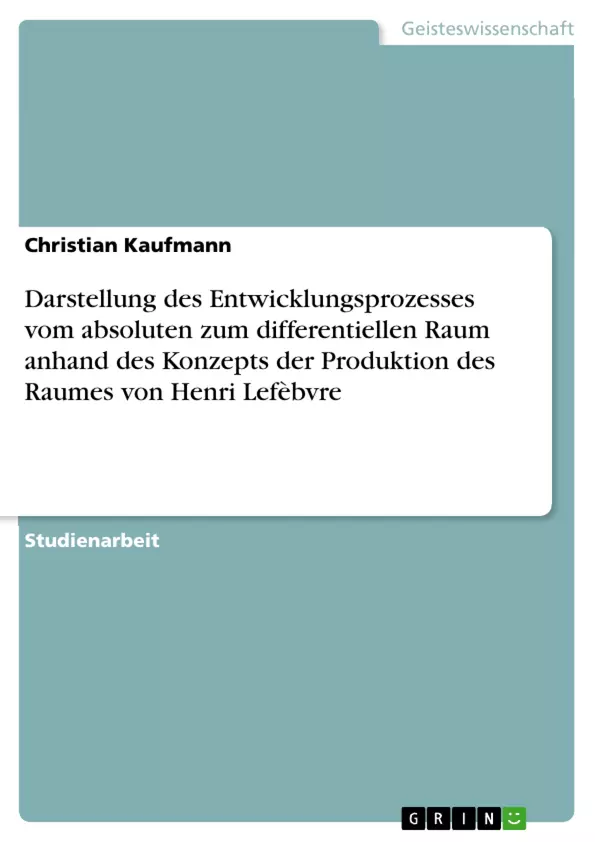Henri Lefèbvre (1901-1991), der 1974 das monumentale Buch „La production de l’espace“ veröffentlicht hat, gilt heutzutage als einer der bedeutendsten Soziologen und der vielleicht größte marxistische Denker seit Karl Marx, so dass sein Leben und Werk keiner langen Einleitung bedürfen (vgl. Schroer 2006).
Es gelang ihm, die Soziologie des Raumes, die bis zu diesem Zeitpunkt in der soziologischen Theorienbildung eine eher untergeordnete Rolle spielte, neu zu beleben und er hat somit grundlegend dazu beigetragen, dass in den 1990er Jahren die sogenannte „topologische Wende“ eingeleitet werden konnte. So entwickelte Lefèbvre analog zur Analyse der Warenproduktion von Karl Marx eine Theorie der Produktion des Raumes, bei der er seine Erkenntnisse aus einer Analyse des fordistisch-kapitalistischen Raumes der Moderne entwickelte. Dadurch wurde Lefèbvre zum wichtigsten Impulsgeber der marxistischen Raumtheorie.
Um eine systematische Abhandlung des Themas zu ermöglichen, wurde die vorliegende Arbeit in drei Abschnitte unterteilt. Das erste Kapitel dient zunächst dazu, alle verwendeten Grundbegriffe im Sinne Lefèbvres zu erläutern. Im anschließenden Kapitel folgt eine Beschreibung seiner grundlegenden Vorstellungen, bevor im dritten Kapitel der Entwicklungsprozess vom „absoluten“ zum „differentiellen Raum“ aufgezeigt wird. Die Entscheidung zugunsten dieses Themas ist dem Umstand geschuldet, dass es über die soziologische Raumtheorie sowie die Denkmodelle von Henri Lefèbvre zwar mittlerweile eine Vielzahl von Artikeln und Diskussionspapieren gibt – dass aber in Bezug auf den Entwicklungsprozess zum „differentiellen Raum“ noch immer nur sehr wenige Texte existieren und somit weiterer Forschungsbedarf besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klärung der Grundbegriffe
- Der Raum
- Der absolute Raum
- Der abstrakte Raum
- Der differentielle Raum
- Die Gesellschaft
- Die Produktion
- Grundlegende Vorstellungen
- Der Raum als soziales Produkt
- Das Konzept der Produktion des Raumes
- Die Ebenen des Raummodells
- Die räumliche Praxis
- Die Repräsentation des Raumes
- Die Räume der Repräsentation
- Wandel in der Produktion des Raumes
- Der Raum als historisches Produkt
- Die erste Natur
- Die zweite Natur
- Die Entwicklung vom absoluten zum abstrakten Raum
- Die Weiterentwicklung zum differentiellen Raum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Raumes vom absoluten zum differentiellen Raum nach der Theorie der Produktion des Raumes von Henri Lefebvre. Ziel ist es, den Prozess dieses Wandels im Kontext der marxistischen Raumtheorie zu verstehen und aufzuzeigen, wie sich Lefebvres Konzeption des Raumes in den drei Ebenen der räumlichen Praxis, der Repräsentation des Raumes und der Räume der Repräsentation manifestiert.
- Die Konzeption des Raumes als gesellschaftliches Produkt
- Die drei Ebenen des Raummodells nach Lefebvre: räumliche Praxis, Repräsentation des Raumes und Räume der Repräsentation
- Der Wandel des Raumes vom absoluten zum abstrakten und schließlich zum differentiellen Raum
- Die Bedeutung der Widersprüche des gegenwärtigen Raumes für die Produktion alternativer Räume
- Die Bedeutung der Körperlichkeit und Sinnlichkeit der Menschen in der Produktion des Raumes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Henri Lefebvre als bedeutenden Soziologen und marxistischen Denker vor und erläutert die Relevanz seiner Raumtheorie. Das erste Kapitel definiert den Raum nach Lefebvre als ein gesellschaftliches Produkt und betrachtet verschiedene Klassifikationen des Raumes: den absoluten Raum, den abstrakten Raum und den differentiellen Raum. Das zweite Kapitel beschreibt Lefebvres grundlegende Vorstellungen vom Raum und erklärt seine Konzeption der Produktion des Raumes. Es werden die drei Ebenen des Raummodells – die räumliche Praxis, die Repräsentation des Raumes und die Räume der Repräsentation – erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Wandel in der Produktion des Raumes. Es wird die Entwicklung des Raumes vom absoluten zum abstrakten Raum und schließlich zum differentiellen Raum aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Produktion des Raumes nach Henri Lefebvre, seine Raumtheorie und den Wandel vom absoluten zum differentiellen Raum. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: absolute Raum, abstrakter Raum, differentieller Raum, räumliche Praxis, Repräsentation des Raumes, Räume der Repräsentation, gesellschaftliches Produkt, Raum als Medium, Widersprüche des gegenwärtigen Raumes, alternative Räume.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Produktion des Raumes“ bei Henri Lefèbvre?
Lefèbvre postuliert, dass Raum kein neutraler Behälter ist, sondern ein gesellschaftliches Produkt, das durch soziale Beziehungen und Handlungen ständig neu erschaffen wird.
Was sind die drei Ebenen des Raummodells?
Das Modell besteht aus der räumlichen Praxis (wahrgenommener Raum), der Repräsentation des Raumes (konzipierter Raum der Planer) und den Räumen der Repräsentation (gelebter Raum der Nutzer).
Was unterscheidet den absoluten vom abstrakten Raum?
Der absolute Raum ist religiös oder politisch geprägt (z.B. Tempel), während der abstrakte Raum der Raum des Kapitalismus und der Bürokratie ist, der alles messbar und handelbar macht.
Was ist der „differentielle Raum“?
Der differentielle Raum ist ein zukünftiger, befreiter Raum, der die Widersprüche des abstrakten Raums überwindet und Raum für Unterschiede, Körperlichkeit und Sinnlichkeit lässt.
Warum gilt Lefèbvre als wichtiger Impulsgeber der marxistischen Raumtheorie?
Er übertrug Marx' Analyse der Warenproduktion auf den Raum und zeigte auf, wie der fordistisch-kapitalistische Raum der Moderne zur Herrschaftssicherung genutzt wird.
- Quote paper
- Master of Arts (M.A.) Christian Kaufmann (Author), 2010, Darstellung des Entwicklungsprozesses vom absoluten zum differentiellen Raum anhand des Konzepts der Produktion des Raumes von Henri Lefèbvre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171977