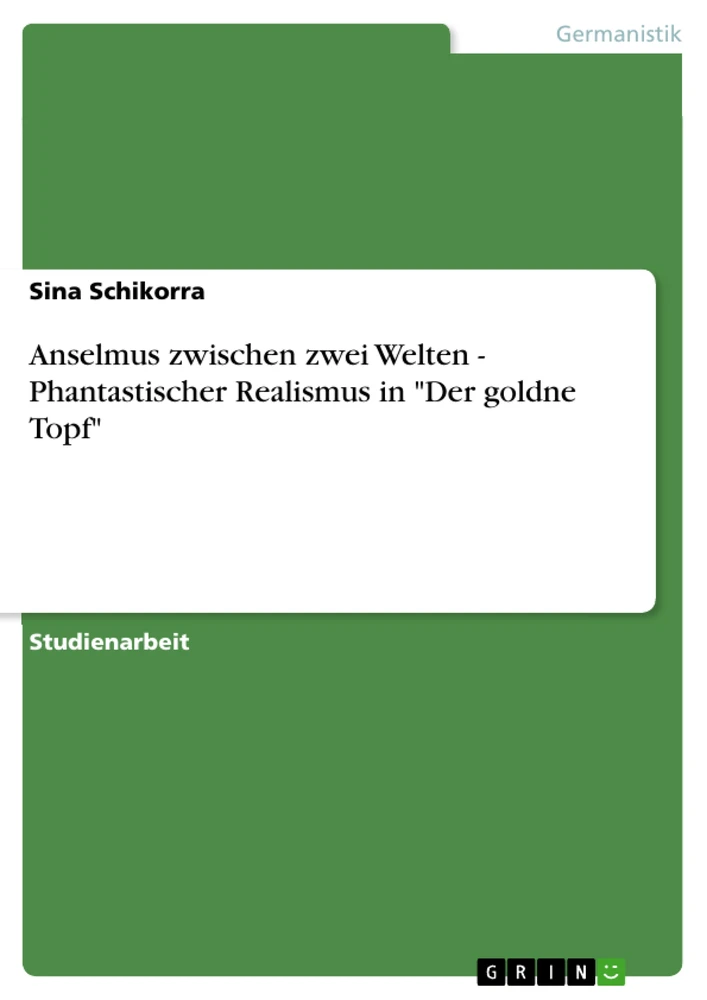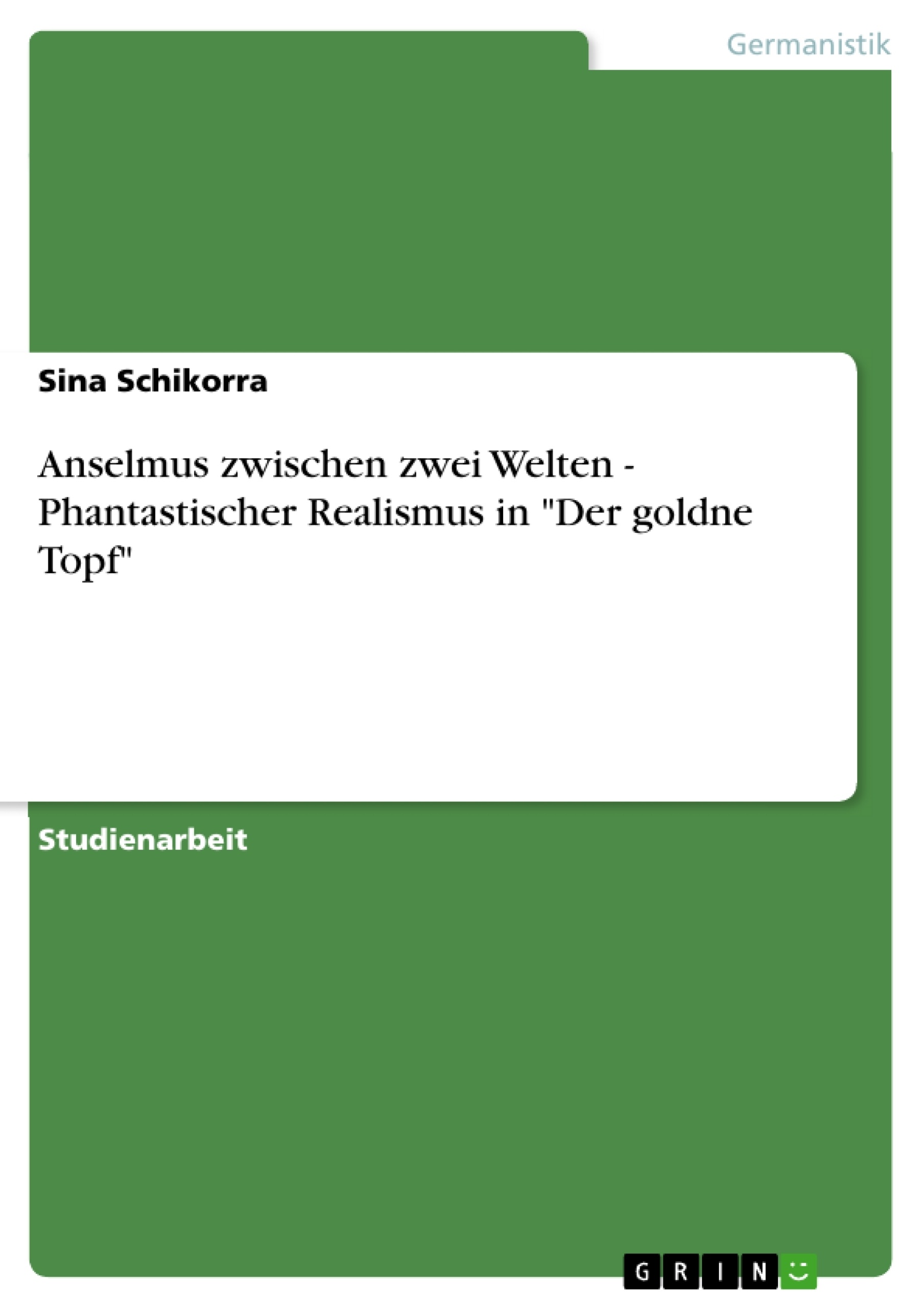„Ein Märchen aus der neuen Zeit“, so der Untertitel des Werks, trifft in diesem
Fall nur halb zu. Märchenhafte Elemente findet man viele: den ewig währenden
Kampf zwischen Gut und Böse, Magie, Liebe, ein Wunderland. Diese
märchenhaften Elemente reihen sich allerdings in eine völlig reale,
nachzuweisende Welt: die Welt des Dresdens um 1800. Wir erfahren genaue
Zeitangaben, den „Himmelfahrtstage“ (einem Tag, an dem sich dem Gläubigen
Unsichtbares offenbart, während andere der irdischen Lust nachgehen), sowie
genaue Ortangaben, wie das „Schwarze Tor“ in Dresden. Es ist eine Integration
des Wunderbaren in die Realität4.
Dieser Machart gibt Hoffmann selbst einen Namen: die Sammlung, in der Der
goldne Topf erscheint, nennt er Fantasiestücke in Callot`s Manier, weil er sich
dabei an den Darstellungen des französischen Kupferstechers Jacques Callot
(1592-1635) orientiert, die auch „das Phantastische, das Skurrile und Exzentrische,
das Außergewöhnliche in das gewöhnliche Leben treten lassen“. Gesehenes wird
so vermischt, dass Mischwesen entstehen, die man weder Realität noch Fantasie
zuordnen kann. Und ebenso gestaltet sich die Geschichte um den goldnen Topf: in
einen realen Handlungsraum mit realen Personen schleichen sich langsam
wundersame Ereignisse um den Studenten Anselmus ein, die sich weiter
verflechten und sich zum Schluss zu einer eigenen, phantastischen Welt neben der
Realen entwickelt und diese sogar teilweise überlagert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Phantastischer Realismus in „Callot's Manier“
- 2. Die Symbolik im Goldnen Topf
- 2.1. Das Kristall – „Ins Kristall bald dein Fall!“
- 2.2. Der Spiegel
- 2.3. Der goldne Topf
- 3. Bürgerliche vs. Wunderbare Welt
- 3.1. Philisterwelt
- 3.2. Gut und Böse
- 3.3. Erzählerfigur
- 4. Schlusswort - Anselmus als Dichter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Erzählung „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann unter dem Aspekt des „Phantastischen Realismus“. Sie untersucht, wie Hoffmann die Welt des Wunderbaren in die Realität des Dresdens um 1800 integriert und so eine neue, einzigartige Erzählform kreiert.
- Die Integration des Wunderbaren in die Realität
- Die Symbolik von Kristall, Spiegel und goldnem Topf
- Die Gegenüberstellung der bürgerlichen und der wunderbaren Welt
- Die Rolle der Erzählerfigur
- Die Transformation von Anselmus zum Dichter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung – Phantastischer Realismus in „Callot's Manier“
Dieses Kapitel führt in das Thema des „Phantastischen Realismus“ in „Der goldne Topf“ ein. Es stellt fest, dass die Geschichte märchenhafte Elemente in eine realistische Welt integriert, die durch konkrete Zeit- und Ortsangaben beleuchtet wird. Hoffmann bezeichnet diese Mischung als „Fantasiestücke in Callot's Manier“ und beschreibt sie als eine Verschmelzung von Realität und Fantasie.
2. Die Symbolik im Goldnen Topf
Dieser Abschnitt untersucht die symbolische Bedeutung verschiedener Elemente in der Erzählung, die die Verbindung zwischen der realen und der mystischen Welt herstellen.
2.1. Das Kristall – „Ins Kristall bald dein Fall!“
Das Kapitel analysiert die Rolle des Kristalls als wichtiges Motiv in der Erzählung. Es zeigt, wie das Kristall sowohl als Instrument der Bestrafung, als auch als Symbol der Läuterung und des Glaubens dient.
2.2. Der Spiegel
Der Spiegel wird als ein Tor oder Fenster zur wahren oder unwahren Welt betrachtet. Das Kapitel erforscht die unterschiedlichen Funktionen des Spiegels in der realen und der mythischen Welt, wobei sowohl die positive Seite des Archivarius, als auch die negative Seite der alten Rauerin beleuchtet werden.
2.3. Der goldne Topf
Das Kapitel behandelt den goldnen Topf als ein visuelles Portal, durch das die „Gestaltungen der jenseitigen Welt“ sichtbar werden.
3. Bürgerliche vs. Wunderbare Welt
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Gegenüberstellung der bürgerlichen und der wunderbaren Welt in der Erzählung.
3.1. Philisterwelt
Das Kapitel analysiert die Philisterwelt, die Anselmus vor seinem Eintritt in die wunderbare Welt repräsentiert.
3.2. Gut und Böse
Der Abschnitt erforscht die Konflikte zwischen Gut und Böse in der Erzählung und zeigt die moralischen Implikationen der verschiedenen Welten auf.
3.3. Erzählerfigur
Das Kapitel untersucht die Rolle der Erzählerfigur in der Erzählung und ihre Beziehung zur Welt des Wunderbaren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Phantastischer Realismus, E.T.A. Hoffmann, Der goldne Topf, Symbolik, Kristall, Spiegel, goldener Topf, bürgerliche Welt, Wunderbare Welt, Philister, Gut und Böse, Erzählerfigur, Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Phantastischer Realismus" bei E.T.A. Hoffmann?
Es beschreibt die Integration von wunderbaren, magischen Elementen in eine völlig reale, zeitgenössische Welt (wie das Dresden um 1800).
Welche Symbolik hat der "goldne Topf"?
Der Topf dient als visuelles Portal, durch das die Gestaltungen der jenseitigen, wunderbaren Welt für den Protagonisten sichtbar werden.
Wer sind die "Philister" in Hoffmanns Erzählung?
Philister stehen für die bürgerliche Welt der Beamten und Bürger, die keinen Sinn für Poesie und das Wunderbare haben und nur im Materiellen verhaftet sind.
Was symbolisiert der Spiegel im Werk?
Der Spiegel fungiert als Fenster zur wahren oder unwahren Welt und kann sowohl Erkenntnis als auch Täuschung durch dunkle Mächte bedeuten.
Was bedeutet der Ausspruch „Ins Kristall bald dein Fall!“?
Das Kristallmotiv steht für eine Gefangenschaft, die gleichzeitig eine Läuterung des Protagonisten Anselmus auf seinem Weg zum Dichter darstellt.
Warum wird Anselmus am Ende zum Dichter?
Seine Transformation zeigt den Sieg der Fantasie über die bürgerliche Enge; nur durch den Glauben an das Wunderbare kann er die Welt der Poesie (Atlantis) erreichen.
- Quote paper
- Sina Schikorra (Author), 2007, Anselmus zwischen zwei Welten - Phantastischer Realismus in "Der goldne Topf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172001