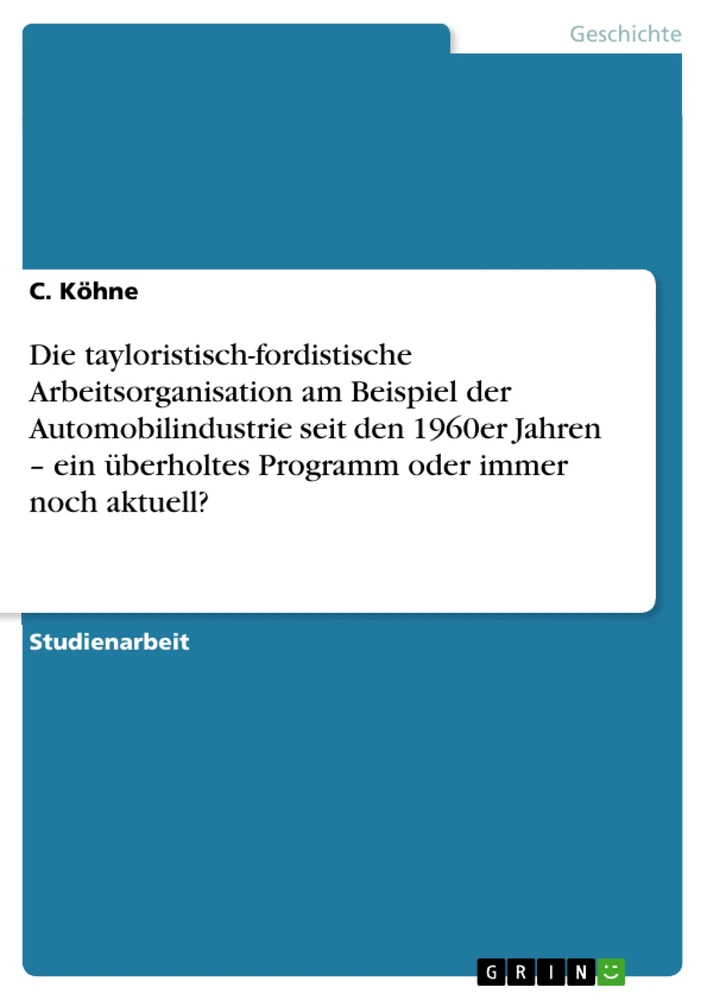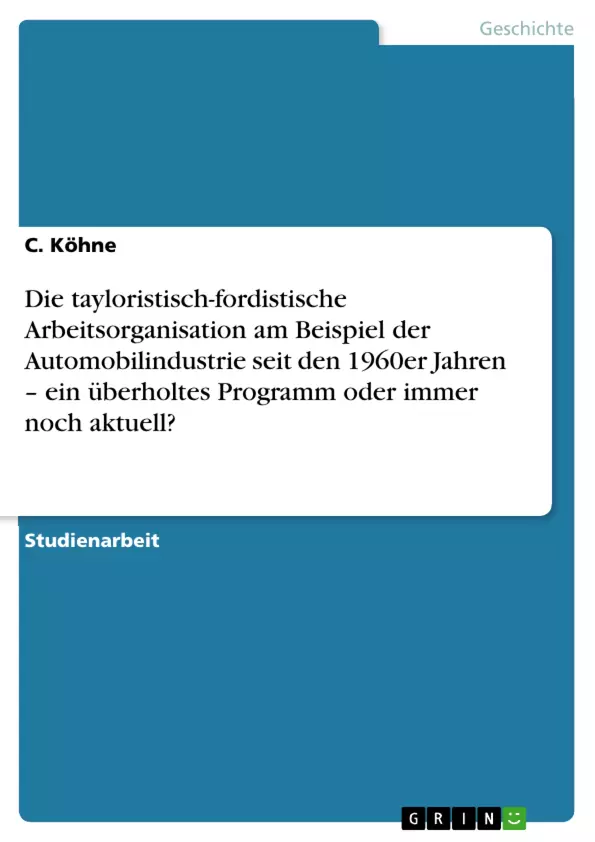Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts veränderte sich das Automobil von einem Luxusartikel, welcher nur für die oberen Schichten der Gesellschaft vorbehalten war, zu einem „Gebrauchsgegenstand“, der nun fast für jedermann erschwinglich wurde. Dies konnte nur aufgrund einer Erhöhung der Automobilproduktion bis hin zu dessen Massenproduktion geschehen. Die Grundlage hierfür bildete das Konzept des Fordismus. „Mit »Fordismus« bezeichnen wir die kapitalistische Formation, die sich in den dreißiger bis fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts im Gefolge von Weltwirtschaftskrise und Weltkrieg zunächst in den USA herausgebildet hat.“ Auf dieser historischen Basis soll diese Hausarbeit aufgebaut werden. Ziel dieser Untersuchung soll es sein, zu analysieren, ob seit der Krise des Fordismus dessen Arbeitskonzepte nicht mehr angewandt wurden, oder ob es zu keiner völligen Abkehr von dieser massenkosumorientierten Arbeitsweise gekommen ist.
Mit diesem Problem hat sich vor allem Roland Springer in seinem Werk Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitsmarktpolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg auseinandergesetzt. Eine gute Basis und Einführung findet man in Christophs Scherrer Monographie Im Bann des Fordismus. Die Auto- und Stahlindustrie der USA im internationalen Konkurrenzkampf.
Diese Hausarbeit soll sich vordergründig mit den Problemen beschäftigen, welche der Fordismus seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit sich brachte. Hierzu wird zunächst ein historischer Überblick über die Entwicklung der Automobilindustrie seit den sechziger Jahren geboten, wobei man direkt in die Krise des Fordismus, welche sich seit Anfang der siebziger Jahre bemerkbar machte, überleiten kann. Hier sollen nun die verschiedenen Ursachen der Krise festgehalten und analysiert werden, bevor es zur Vorstellung der aktuellen Lage des Weltautomobilmarktes kommt. Aufgrund eines Stillstandes, zu dem es am Anfang der neunziger Jahre dort fast gekommen war, mussten die neuen Arbeitsstrategien erneut reformiert werden. Dargestellt wird diese Entwicklung im Konkreten am Beispiel der deutschen Automobilunternehmen. Die wohl am meisten betroffenen Akteure waren stets die am Fließband tätigen Arbeiter. Im historischen Vergleich hat sich deren Situation stark verändert, denn „sowohl dem Fließband wie der Arbeitsteilung wird »ein Ende« prophezeit durch die Anwendung neuer Techniken (Roboter, fahrerlose Transportsysteme) und neuer Arbeitskonzepte (Gruppenarbeit, Aufgabenintegration).“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der fordistisch geprägten Automobilindustrie seit den 1960ern
- Die Krise des Fordismus und ihre Ursachen
- Die Verzeichnung eines derzeitig stagnierenden Weltautomobilmarktes
- Die Entwicklung des „nachfordistischen“ Automobilmarktes am Beispiel des Standortes Deutschland
- Die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der Automobilindustrie
- Ausblick – mögliche Rückkehr zum Fordismus?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Krise des Fordismus und die darauf folgenden Veränderungen der Arbeitskonzepte. Es wird untersucht, ob und inwieweit eine Abkehr vom fordistischen Modell stattgefunden hat oder ob es zu einer Adaption und Weiterentwicklung kam.
- Die Krise des Fordismus und deren Ursachen
- Die Entwicklung des Automobilmarktes seit den 1960er Jahren
- Veränderungen der Arbeitsbedingungen in der Automobilindustrie
- Der Einfluss neuer Technologien auf die Produktion
- Mögliche Rückkehr zu fordistischen Arbeitsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Transformation des Automobils vom Luxusgut zum Massenprodukt im 20. Jahrhundert, basierend auf dem Fordismus. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Auswirkungen der Fordismuskrise auf die Arbeitskonzepte in der Automobilindustrie und die Frage nach einer vollständigen Abkehr oder Anpassung an dieses Modell. Die Arbeit beruft sich auf relevante Literatur, darunter Springer und Scherrer.
Entwicklung der fordistisch geprägten Automobilindustrie seit den 1960ern: Dieses Kapitel erläutert das fordistische Produktionskonzept, basierend auf Fließbandarbeit, Standardisierung und kontinuierlichem Prozess. Es beschreibt den Aufschwung der Automobilindustrie in der Nachkriegszeit und den darauf folgenden Umschwung ab 1966 mit einem Rückgang der Stahlproduktion und einer Verlangsamung des Automobilproduktionswachstums. Das Kapitel legt den Grundstein für die Analyse der nachfolgenden Krise.
Die Krise des Fordismus und ihre Ursachen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Ursachen der Fordismuskrise, insbesondere in den USA, aber auch mit Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland. Er benennt den Anstieg der realen Lohnkosten als wichtigen Faktor. Weitere Ursachen sind die Erschöpfung der Produktivitätsreserven, die körperliche und psychische Überlastung der Arbeitnehmer, die Unattraktivität der monotonen Arbeit, soziale Probleme in den Fabriken (Alkoholismus, Konflikte, Sabotage), der hohe Verbrauch natürlicher Ressourcen und die Umweltzerstörungen. Unterschiedliche Perspektiven auf die Ursachen, wie z.B. die Rolle des Mangels an Kleinwagenproduktion oder die Ölkrisen, werden kurz erwähnt.
Schlüsselwörter
Fordismus, Automobilindustrie, Krise des Fordismus, Massenproduktion, Arbeitskonzepte, Nachfordismus, Lohnkosten, Produktivität, Umweltzerstörung, Arbeitsbedingungen, Technologischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren, insbesondere die Krise des Fordismus und die daraus resultierenden Veränderungen in den Arbeitskonzepten. Es wird untersucht, ob und inwieweit eine Abkehr vom fordistischen Modell stattfand oder ob eine Anpassung und Weiterentwicklung erfolgte. Die Arbeit bezieht sich auf relevante Literatur, darunter Springer und Scherrer.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind die Krise des Fordismus und deren Ursachen, die Entwicklung des Automobilmarktes seit den 1960er Jahren, Veränderungen der Arbeitsbedingungen in der Automobilindustrie, der Einfluss neuer Technologien auf die Produktion und die mögliche Rückkehr zu fordistischen Arbeitsmodellen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung des „nachfordistischen“ Automobilmarktes, am Beispiel Deutschlands.
Welche Aspekte des Fordismus werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das fordistische Produktionskonzept mit seinen Merkmalen wie Fließbandarbeit, Standardisierung und kontinuierlichem Prozess. Sie beleuchtet den Aufstieg und Fall des Fordismus, die Ursachen seiner Krise (z.B. steigende Lohnkosten, Erschöpfung der Produktivitätsreserven, monotone Arbeit, soziale Probleme in den Fabriken, hoher Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung), und diskutiert die Frage nach einer möglichen Rückkehr zu fordistischen Arbeitsmodellen.
Wie wird die Krise des Fordismus beschrieben?
Die Krise des Fordismus wird anhand verschiedener Faktoren erläutert: Anstieg der realen Lohnkosten, Erschöpfung der Produktivitätsreserven, körperliche und psychische Überlastung der Arbeitnehmer, Unattraktivität monotoner Arbeit, soziale Probleme in den Fabriken, hoher Verbrauch natürlicher Ressourcen und Umweltzerstörung. Die Arbeit berücksichtigt dabei auch unterschiedliche Perspektiven auf die Ursachen, wie z.B. den Mangel an Kleinwagenproduktion oder die Ölkrisen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit?
Die konkreten Ergebnisse der Arbeit sind nicht direkt in der Inhaltsangabe enthalten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Transformation der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren zu analysieren und die Auswirkungen der Fordismuskrise auf die Arbeitskonzepte zu beleuchten. Die Schlussfolgerung wird vermutlich die Frage nach einer vollständigen Abkehr oder Anpassung an das fordistische Modell beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fordismus, Automobilindustrie, Krise des Fordismus, Massenproduktion, Arbeitskonzepte, Nachfordismus, Lohnkosten, Produktivität, Umweltzerstörung, Arbeitsbedingungen und Technologischer Wandel.
Welche Kapitelstruktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung der fordistisch geprägten Automobilindustrie seit den 1960er Jahren, ein Kapitel zur Krise des Fordismus und ihren Ursachen, ein Kapitel zu den Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der Automobilindustrie und einen Ausblick auf eine mögliche Rückkehr zum Fordismus. Jedes Kapitel wird in der Inhaltsangabe kurz zusammengefasst.
- Quote paper
- C. Köhne (Author), 2008, Die tayloristisch-fordistische Arbeitsorganisation am Beispiel der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren – ein überholtes Programm oder immer noch aktuell?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172109