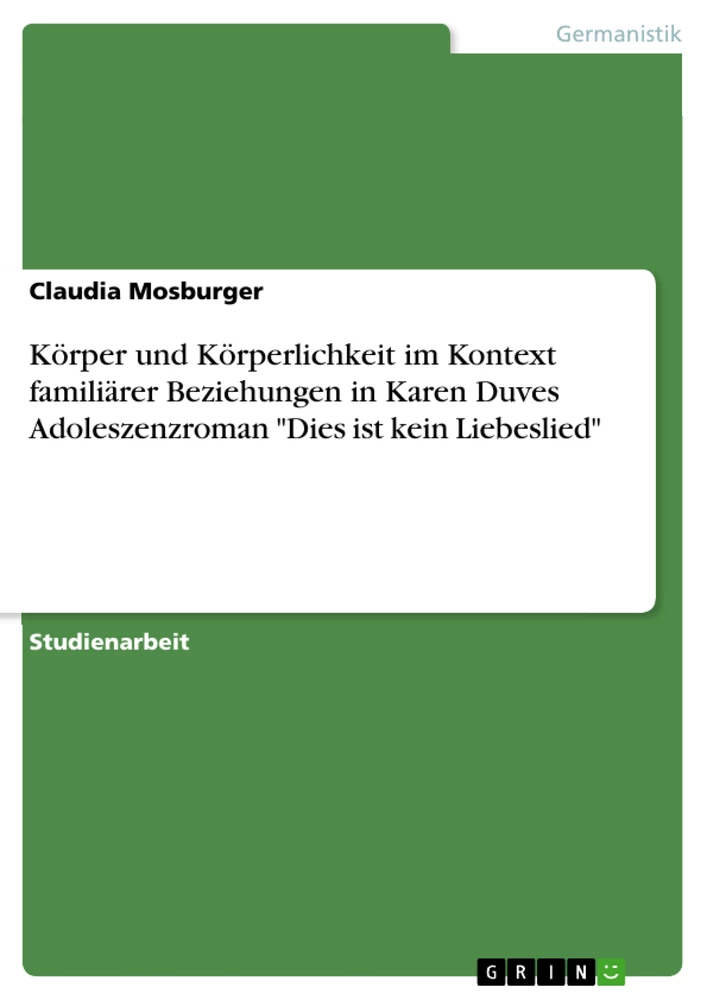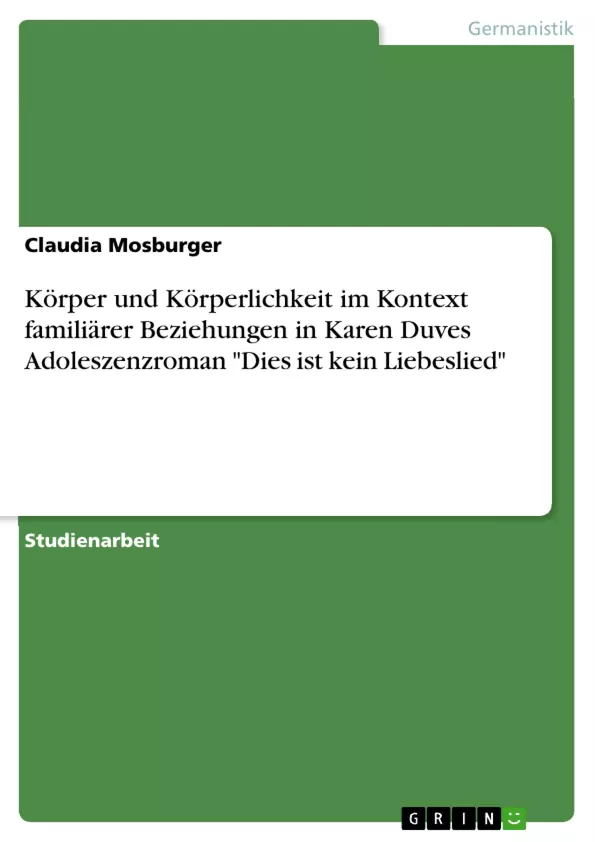Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema des Körpers und der Körperlichkeit im Kontext familiärer Beziehungen in dem Adoleszenzroman „Dies ist kein Liebeslied“ von Karen Duve. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine textnahe Analyse zu einer These des oben genannten Themas sowie der adäquaten Miteinbeziehung von Fachliteratur. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Protagonistin und ihrer Körpermanipulation und impliziert folgende These:
Annes Körpermanipulation entsteht aus dem ständigen Konflikt mit ihrer Körperlichkeit und aus der Enttäuschung heraus, dass ihr Bedürfnis familiärer Zuneigung ständig zurückgewiesen wird.
In der Arbeit geht es vor allem um die verzerrte Selbstwahrnehmung der Protagonistin, die von ihrem familiären Umfeld ungeachtet bleibt. Es wird aufgezeigt, wie das Leben einer jungen Frau verläuft, wenn sie seit dem Kleinkindalter hinter Liebe und Zuneigung hinterherläuft, sich ihren Kopf aber immer nur an Zurückweisung stößt. Es geht um Wünsche, Krankheit, Schönheitsideale, Flucht vor Identität, Konflikte und Beziehungen und mündet in einem ewigen Leidensweg von Hoffnung, dem endlosen Streben nach dem perfekten Körperideal und der Liebe.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG.
- Annes Konflikt mit ihrer Körperlichkeit......
- Die bewusste Modellierung des Körpers
- DER MANIPULIERBARE KÖRPER IN FAMILIÄREN BEZIEHUNGEN....
- Die Beziehung zu den Eltern………………….
- Die Mutter-Tochter Beziehung
- Die Vater-Tochter Beziehung
- Die Beziehung zur Schwester
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Adoleszenzroman „Dies ist kein Liebeslied“ von Karen Duve, indem sie den Fokus auf das Thema des Körpers und der Körperlichkeit im Kontext familiärer Beziehungen legt. Die Analyse soll textnah erfolgen und zugleich relevante Fachliteratur einbeziehen. Die Arbeit beleuchtet die verzerrte Selbstwahrnehmung der Protagonistin Anne, die sich aus dem ständigen Konflikt mit ihrer Körperlichkeit und dem Mangel an familiärer Zuneigung entwickelt.
- Annes Konflikt mit ihrer Körperlichkeit und die Entstehung ihrer Körpermanipulation
- Die Auswirkungen mangelnder familiärer Zuneigung auf Annes Selbstbild
- Die Rolle der Mutter-Tochter Beziehung in der Entwicklung von Annes Selbstbild
- Der Einfluss von Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Erwartungen auf Annes Körperwahrnehmung
- Annes Suche nach Identität und ihre Flucht vor Verantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Anne und ihren Eltern, die als Quelle für ihren Konflikt mit ihrer Körperlichkeit betrachtet wird. Die Arbeit betont, wie Annes Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung ständig zurückgewiesen wird und wie sie ihre Körpermanipulation als Mechanismus zur Bewältigung dieser emotionalen Notlage einsetzt.
Das zweite Kapitel vertieft die Analyse von Annes Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Arbeit untersucht, wie Annes Körper im Roman hauptsächlich im Kontext von Essen und Diäten dargestellt wird. Die Arbeit analysiert, wie Annes Körper von anderen wahrgenommen wird, und wie sie sich selbst in Bezug auf ihr Äußeres erlebt. Die Analyse zeigt, wie Annes Körper zum Objekt von Erwartungen und Manipulationen wird.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Annes Beziehung zu ihrer Schwester und dem Einfluss dieser Beziehung auf ihre Selbstwahrnehmung. Es wird untersucht, wie die Schwester in Annes Augen perfekt erscheint, was Annes Selbstbild zusätzlich belastet. Die Analyse zeigt, wie Annes Körpermanipulation zum Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Körper und Körperlichkeit im Kontext der familiären Beziehungen, Essstörungen, Selbstbild, Identität, Adoleszenz, Schönheitsideale und gesellschaftliche Erwartungen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Dies ist kein Liebeslied"?
Der Roman von Karen Duve thematisiert die Adoleszenz einer jungen Frau, die durch familiäre Zurückweisung eine gestörte Körperwahrnehmung entwickelt.
Warum manipuliert die Protagonistin Anne ihren Körper?
Die Körpermanipulation (Essen/Diäten) ist ein Versuch, mit der Enttäuschung über mangelnde familiäre Zuneigung und ständige Zurückweisung umzugehen.
Welche Rolle spielt die Mutter-Tochter-Beziehung im Roman?
Die Beziehung ist von Kälte und Ablehnung geprägt, was maßgeblich zu Annes verzerrter Selbstwahrnehmung und ihrem geringen Selbstwertgefühl beiträgt.
Wie werden Schönheitsideale im Buch thematisiert?
Anne strebt endlos nach einem perfekten Körperideal in der Hoffnung, dadurch endlich die Liebe und Anerkennung zu erhalten, die ihr fehlt.
Was ist das Resümee der Analyse?
Annes Leidensweg zeigt, wie tiefgreifend familiäre Konflikte die Identitätsfindung und den Umgang mit der eigenen Körperlichkeit in der Pubertät beeinflussen.
- Quote paper
- Claudia Mosburger (Author), 2009, Körper und Körperlichkeit im Kontext familiärer Beziehungen in Karen Duves Adoleszenzroman "Dies ist kein Liebeslied", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172122