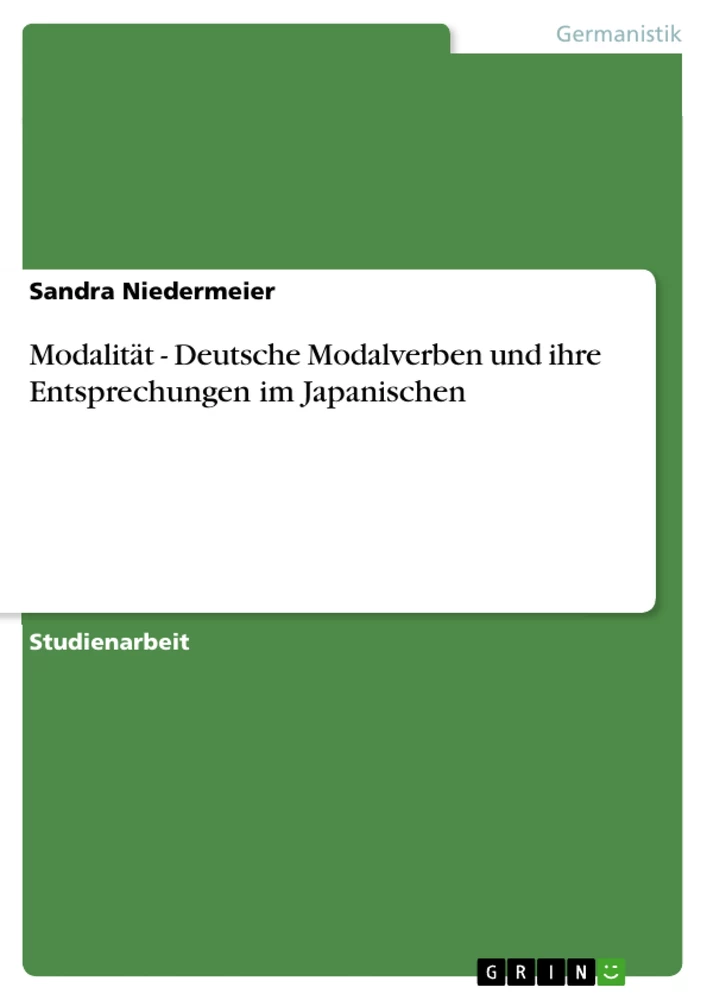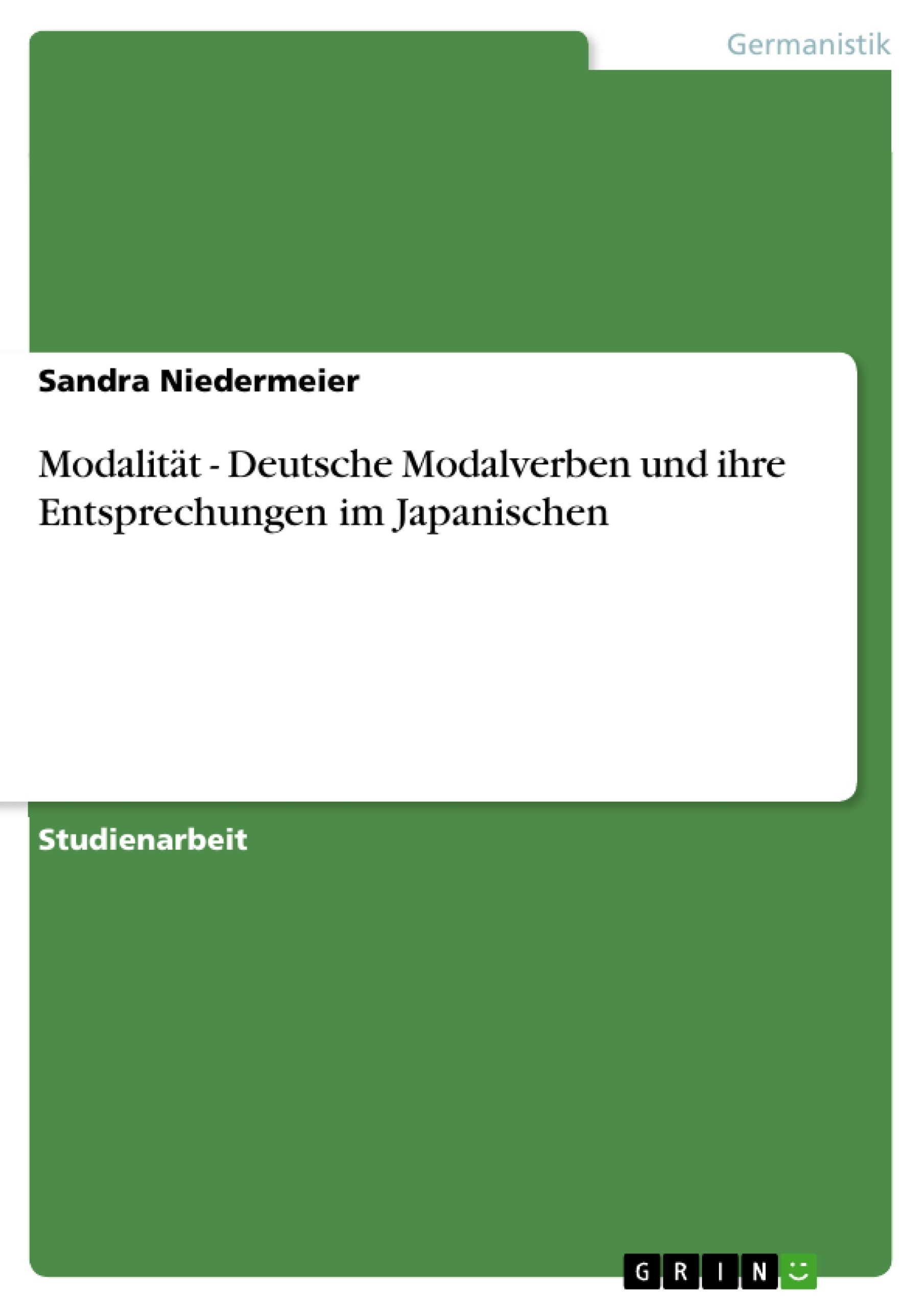Modalverben machen im Grunde genommen eine Aussage darüber, ob eine Handlung gewollt, erlaubt, erwünscht oder möglich ist. Die sechs Verben dürfen, sollen, wollen, können, müssen und mögen gelten im Deutschen als Modalverben. Sie sind vielfältig kombinierbar und stellen für Viele beim Erlernen der deutschen Sprache eine Herausforderung dar, auch deswegen, da im umgangssprachlichen Gebrauch auch andere Verben ihre Funktion einnehmen. Sie können sowohl epistemisch als auch deontisch verwendet werden, und alle sechs Modalverben zeigen ein ähnliches syntaktisches Verhalten.
Das Japanische hingegen kennt keine Modalverben wie im Deutschen. Diese Sprache ist eine agglutinierende Sprache, die ein komplexes System an höflichen Formulierungen besitzt, wofür sie in westlichen Ländern besonders bekannt ist. Das finite Prädikat steht am Ende des Satzes. Durch das Anhängen von Suffixen werden Tempus, Negation etc. zum Ausdruck gebracht. Sätze, die dem Inhalt deutscher Modalverben wie dürfen, können, mögen, müssen, wollen oder sollen entsprechen werden anders formuliert.
In dieser Arbeit sollen die unterschiedlichen Satzkonstruktionen im Japanischen, die beispielsweise eine Erlaubnis, eine Aufforderung oder einen Willen ausdrücken, vorgestellt werden. Des Weiteren werden Zusammenhänge und Ähnlichkeiten mit der deutschen Modalität gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand der Arbeit
- Die Rolle von Modalität in der Sprache allgemein
- Die Syntax des Japanischen
- Modalverben im Deutschen
- Modalität im Japanischen
- Semantik
- Modalität im Vergleich
- Entsprechung deutscher Modalverben im Japanischen
- dürfen
- können
- mögen
- müssen
- sollen
- wollen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutschen Modalverben und ihre Entsprechungen im Japanischen. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ausdruckweise von Modalität in beiden Sprachen aufzuzeigen und die funktionalen Entsprechungen im Japanischen zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die sechs Modalverben des Deutschen (dürfen, sollen, wollen, können, müssen, mögen).
- Vergleich der deutschen Modalverben und ihrer Funktion.
- Analyse der Modalitätsausdrücke im Japanischen.
- Untersuchung der syntaktischen Unterschiede zwischen Deutsch und Japanisch bei der Modalitätsausdruck.
- Aufzeigen von funktionalen Entsprechungen im Japanischen für die deutschen Modalverben.
- Beschreibung der Herausforderungen beim Übersetzen von Modalität zwischen Deutsch und Japanisch.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die sechs deutschen Modalverben (dürfen, sollen, wollen, können, müssen, mögen) vor und hebt deren Vielseitigkeit und die Herausforderungen für Deutschlernende hervor. Sie führt in die Thematik der Modalität ein und kontrastiert den deutschen Modalverbbereich mit dem des Japanischen, das keine direkten Entsprechungen aufweist. Der Fokus der Arbeit wird auf die Darstellung unterschiedlicher Satzkonstruktionen im Japanischen gelegt, die Modalität ausdrücken, sowie auf den Vergleich mit der deutschen Modalität.
2. Gegenstand der Arbeit: Dieses Kapitel definiert den Gegenstand der Arbeit genauer. Es erläutert die häufige Verwendung deutscher Modalverben im Alltag und ihre Funktion, die Handlungsweisen zu modifizieren. Im Gegensatz dazu wird das Fehlen expliziter Modalverben im modernen Japanisch hervorgehoben und die Frage nach der Erfassung von Modalität in dieser Sprache aufgeworfen. Das Kapitel benennt den Schwerpunkt der Arbeit: den Vergleich der deutschen Modalverbkonstruktion mit ihren funktionalen Entsprechungen im heutigen Japanischen, und untersucht die Frage nach Ähnlichkeiten oder grundlegenden Unterschieden in der Bildung der Modalität. Es wird die Vorgehensweise der Arbeit umrissen, die die einzelnen Modalverben separat betrachtet und Beispiele verwendet, welche mithilfe eines digitalen Wörterbuches erstellt wurden.
3. Die Rolle von Modalität in der Sprache allgemein: Dieses Kapitel behandelt die sprachlichen Mittel zur Modalitätsausdruck, fokussiert auf Modalverben und Modalpartikeln im Deutschen. Es beschreibt die Polyfunktionalität deutscher Modalverben (deontische und epistemische Verwendung) am Beispiel des Verbs „müssen“. Der Einfluss von Kontext und Kommunikationssituation auf die Interpretation der Modalität wird betont, wobei der Unterschied zwischen der meist eindeutigen epistemischen und der kontextabhängigen deontischen Verwendung hervorgehoben wird. Abschließend wird der Umgang mit Modalität in anderen Sprachen angesprochen, die oftmals auf andere Mittel wie Intonation oder lexikalische Elemente zurückgreifen.
4. Die Syntax des Japanischen: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Syntax des Japanischen, wobei der Fokus auf der neutral-höflichen Sprachebene liegt. Es werden die Besonderheiten japanischer Sätze erläutert, wie das Fehlen von Numerus, Genus und Artikeln bei Substantiven, sowie die Position des Verbs am Satzende. Anhand von Beispielsätzen (mit Kennzeichnung von Subjekt, Objekt und Verb) wird die Satzstruktur verdeutlicht. Die Verwendung von Kanji, Hiragana und Katakana in den Beispielen wird ebenfalls erwähnt.
5. Modalverben im Deutschen: Dieses Kapitel befasst sich mit den deutschen Modalverben im Detail (obwohl der genaue Inhalt aus dem Auszug nicht rekonstruierbar ist).
6. Modalität im Japanischen: Dieses Kapitel widmet sich der Modalität im Japanischen, unterteilt in Semantik, Vergleich mit anderen Modalitäten und der Entsprechung deutscher Modalverben. Es analysiert die verschiedenen Möglichkeiten, Modalität im Japanischen auszudrücken, und vergleicht diese mit der deutschen Modalität (obwohl der genaue Inhalt aus dem Auszug nicht rekonstruierbar ist). Die Kapitel 6.2.1 bis 6.2.6 behandeln jeweils die Entsprechungen der einzelnen deutschen Modalverben im Japanischen (obwohl der genaue Inhalt aus dem Auszug nicht rekonstruierbar ist).
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Modalität im Deutschen und Japanischen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die deutschen Modalverben und ihre funktionalen Entsprechungen im Japanischen. Sie untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Ausdruckweise von Modalität in beiden Sprachen und konzentriert sich auf die sechs Modalverben des Deutschen (dürfen, sollen, wollen, können, müssen, mögen).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich der deutschen Modalverben und ihrer Funktion, die Analyse der Modalitätsausdrücke im Japanischen, die Untersuchung syntaktischer Unterschiede zwischen Deutsch und Japanisch bei der Modalitätsausdruck, das Aufzeigen funktionaler Entsprechungen im Japanischen für die deutschen Modalverben und die Beschreibung der Herausforderungen beim Übersetzen von Modalität zwischen Deutsch und Japanisch.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Einleitung: Einführung in die Thematik und Vorstellung der deutschen Modalverben. 2. Gegenstand der Arbeit: genaue Definition des Forschungsgegenstandes und der Methodik. 3. Die Rolle von Modalität in der Sprache allgemein: sprachliche Mittel zur Modalitätsausdruck, Polyfunktionalität deutscher Modalverben und der Einfluss des Kontextes. 4. Die Syntax des Japanischen: kurzer Überblick über die japanische Syntax. 5. Modalverben im Deutschen: detaillierte Betrachtung der deutschen Modalverben. 6. Modalität im Japanischen: Analyse der Modalitätsausdrücke im Japanischen, im Vergleich mit dem Deutschen und mit Unterkapiteln zu den einzelnen deutschen Modalverben und ihren Entsprechungen im Japanischen.
Wie wird die Modalität im Japanischen im Vergleich zum Deutschen dargestellt?
Die Arbeit hebt den Unterschied hervor, dass das Japanische keine direkten Entsprechungen zu den deutschen Modalverben besitzt. Sie untersucht daher die verschiedenen japanischen Satzkonstruktionen und lexikalischen Mittel, die Modalität ausdrücken und vergleicht diese mit den deutschen Modalverben. Der Fokus liegt auf funktionalen Entsprechungen anstatt direkter Übersetzungen.
Welche Herausforderungen beim Übersetzen von Modalität werden angesprochen?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Ausdrucksweisen von Modalität in Deutsch und Japanisch ergeben. Dies beinhaltet die unterschiedliche syntaktische Struktur und die kontextabhängige Bedeutung von Modalität in beiden Sprachen.
Welche sprachlichen Mittel werden zur Darstellung der Modalität verwendet?
Die Arbeit untersucht Modalverben und Modalpartikeln im Deutschen. Im Japanischen werden alternative sprachliche Mittel wie Satzkonstruktionen und lexikalische Elemente analysiert, die Modalität ausdrücken. Der Einfluss von Kontext und Kommunikationssituation auf die Interpretation wird berücksichtigt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Verwendung eines digitalen Wörterbuches für die Erstellung von Beispielsätzen.
- Quote paper
- M.A. Sandra Niedermeier (Author), 2009, Modalität - Deutsche Modalverben und ihre Entsprechungen im Japanischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172146