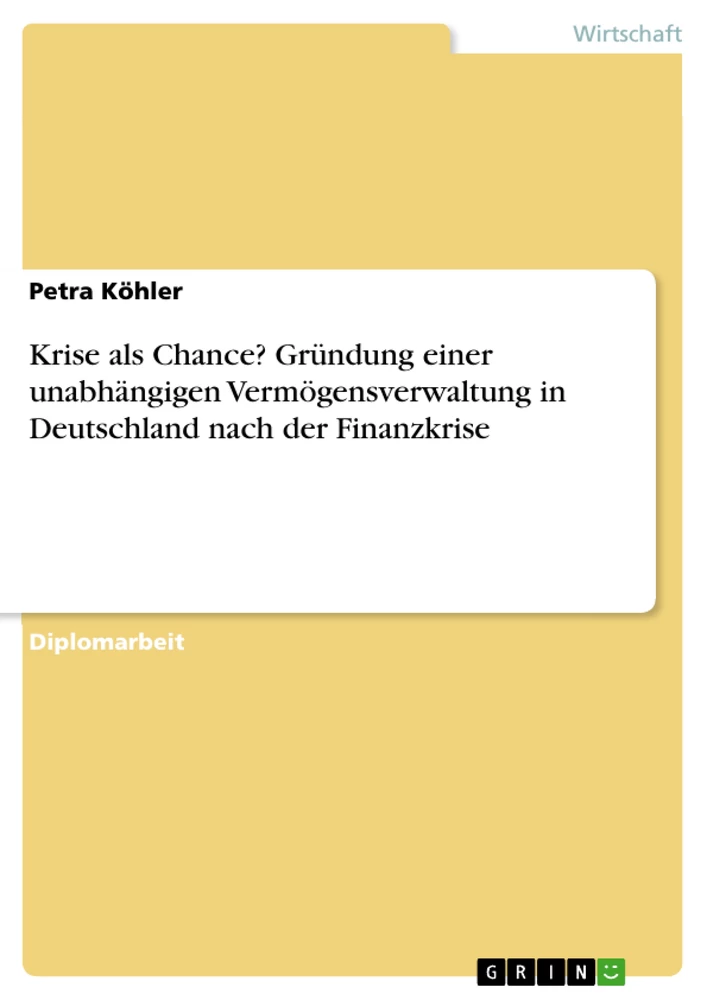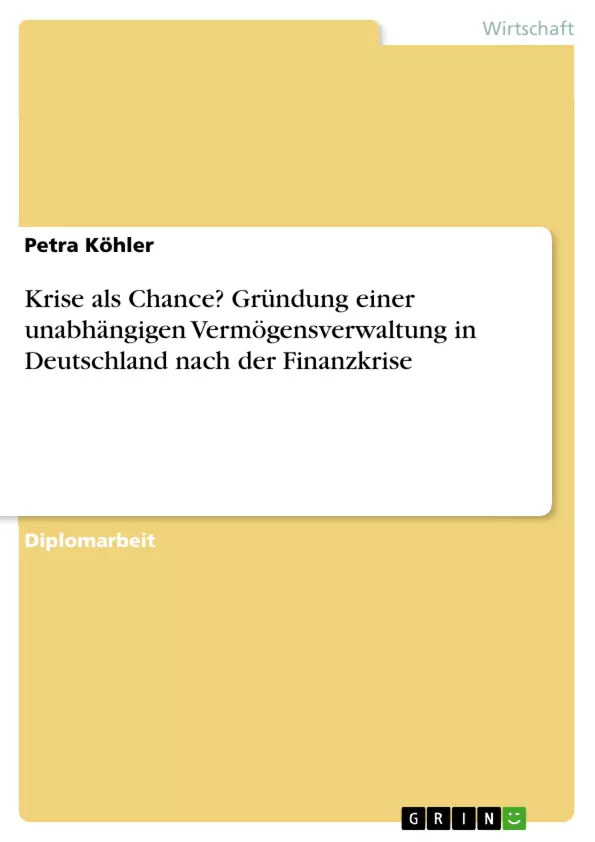Problemstellung und Relevanz der Arbeit:
Die weltweite Finanzkrise, die im Jahr 2007 ausbrach, hat augenscheinlich die Realwirtschaft global in Mitleidenschaft gezogen. Doch die Krise hat mehr verursacht als einbrechende Börsenkurse, den Kollaps einst renommierter Banken und drohende Staatsbankrotte ganzer Volkswirtschaften. Sie hat sich zur weltumspannenden Vertrauens- und Reputationskrise des Wirtschaftssystems ausgeweitet. Die bisher vorherrschende Unternehmenskultur, insbesondere im Finanzsektor, die stark auf kurzfristiges Denken ausgerichtet, und sich an rein finanziellen Erfolgsgrößen zu orientieren scheint, führte zu Gier und Missbrauch von Vertrauen. Im Zuge der Finanzkrise sind Banken und Vermögensverwalter noch mehr in Verruf geraten. Es wird ihnen vorgeworfen, sie seien Produktverkäufer und nur auf den eigenen Profit bedacht. Gerade die Beratung von vermögenden Kunden ist als hochwissensintensive Dienstleistung aber auf Vertrauen angewiesen. Zunächst scheint das Verhältnis zwischen Kunde und Berater nach der Finanzkrise zerrüttet oder zumindest stark angeschlagen. Es scheint, als gehöre das Bild des reputierlichen Private Bankers der Vergangenheit an.
Im Zentrum dieser Untersuchung steht die untersuchungsleitende Forschungsfrage, in wie weit die Finanzkrise, die auch als Vertrauenskrise bezeichnet wird, eine Chance zur Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland darstellt? Dazu wird anhand eines dreigeteilten Hauptteils die Forschungsfrage eingehend beleuchtet. Im ersten Teil wird sich dem Konstrukt Vertrauen angenähert. Was genau ist Vertrauen, wie entsteht es und wie wird es nach einem Vertrauensbruch im organisationalen Kontext wieder aufgebaut? Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen wird im darauffolgenden Teil erläutert, wie es zur Finanzkrise kam und welche Etappen sie zur globalen Vertrauenskrise machten.
Diese beiden Teile bilden die Ausgangsbasis, um in einem dritten Schritt die Dienstleistung Vermögensverwaltung unter vertrauensspezifischen Aspekten und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Finanzkrise zu beleuchten. Auf Basis dieser drei Teile soll eine Antwort auf die untersuchungsleitende Fragestellung gefunden werden. Zusätzlich soll in dieser Arbeit ein Unternehmenskonzept entwickelt werden, auf dessen Grundlage langfristig eine vertrauensvolle Berater – Kunden Beziehung entstehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Hinführung zum Thema
- I. Problemstellung und Relevanz der Arbeit
- II. Methodisches Vorgehen
- B. Vertrauen
- I. Annäherung an das Konstrukt Vertrauen
- II. Zentrale Komponenten von Vertrauen
- 1. Wann entstehen Vertrauenssituationen?
- 2. Von der Vertrauensentscheidung bis zur Vertrauenshandlung
- III. Vertrauen in komplexen sozialen Systemen
- IV. Vertrauensgenese und –wiederaufbau im organisationalen Kontext
- 1. Organisationsvertrauen (Mitarbeiter - Vorgesetzen - Beziehung)
- 2. Interorganisationales Vertrauen (Stakeholder Vertrauen)
- 3. Organisationales Vertrauen (Kundenvertrauen)
- 4. Ansatzpunkte zur Wiederherstellung von erodiertem Vertrauen
- C. Beleuchtung der Finanzkrise und systemischer Vertrauensverlust
- I. Entstehung, Verlauf und Gründe der Finanzkrise ab 2007
- II. Ablauf der Vertrauensdemontage während der Finanzkrise
- III. Auswertung des systemischen Vertrauensverlustes in der EU
- D. Erkenntnisse für einen Gründer einer unabhängigen Vermögensverwaltung
- I. Die Dienstleistung unabhängige Vermögensverwaltung
- 1. Ein umfassender Vermögensberatungsansatz
- 2. Eine transparente Kostenstruktur
- 3. Ein System aus Checks und Balances
- II. Die Gründerperson
- III. Stakeholder
- IV. Ausblick
- V. Chancen einer Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland nach der Finanzkrise. Sie untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Verlust von Vertrauen in die Finanzmärkte ergeben, und analysiert, wie ein Gründer diese Situation für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens nutzen kann.
- Der Einfluss der Finanzkrise auf das Vertrauen in die Finanzmärkte
- Die Bedeutung von Vertrauen für die Vermögensverwaltung
- Die Rolle der unabhängigen Vermögensverwaltung in der Finanzbranche
- Die Herausforderungen und Chancen für Gründer von unabhängigen Vermögensverwaltungen
- Der Aufbau von Vertrauen zwischen Vermögensverwalter und Kunden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Anschließend werden die methodischen Vorgehensweisen beschrieben, die für die Analyse und Bewertung der Fragestellung angewendet werden. Kapitel B befasst sich ausführlich mit dem Konstrukt Vertrauen. Es analysiert zentrale Komponenten von Vertrauen, die Entstehung von Vertrauenssituationen und die Prozesse der Vertrauensentscheidung und Vertrauenshandlung. Weiterhin wird die Bedeutung von Vertrauen in komplexen sozialen Systemen und die Herausforderungen des Vertrauensaufbaus im organisationalen Kontext beleuchtet. Kapitel C untersucht die Entstehung, den Verlauf und die Gründe der Finanzkrise ab 2007 und analysiert den damit verbundenen systemischen Vertrauensverlust. Es beschreibt den Ablauf der Vertrauensdemontage während der Krise und bewertet die Auswirkungen auf die EU. Kapitel D wendet die gewonnenen Erkenntnisse auf die Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung an. Es analysiert die Dienstleistungen, die eine unabhängige Vermögensverwaltung anbieten kann, sowie die Anforderungen an die Gründerperson und die relevanten Stakeholder. Abschließend werden die Chancen und Herausforderungen einer Gründung in der aktuellen Finanzmarktsituation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Finanzkrise, Vertrauensverlust, unabhängige Vermögensverwaltung, Kundenvertrauen, Finanzdienstleistungen, Gründerpersönlichkeit, Stakeholder, Chancen und Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Finanzkrise von 2007 auch als Vertrauenskris?
Die Krise führte zum Kollaps renommierter Banken und legte eine Unternehmenskultur offen, die auf kurzfristige Gewinne und Gier fixiert war. Dies erschütterte das Vertrauen der Kunden in das gesamte Finanzsystem nachhaltig.
Bietet die Finanzkrise Chancen für unabhängige Vermögensverwalter?
Ja, da das Vertrauen in klassische Bankberater oft zerrüttet ist, suchen Kunden vermehrt nach unabhängigen Beratern, die transparente Kostenstrukturen und einen objektiven Beratungsansatz ohne Verkaufsdruck bieten.
Wie entsteht Vertrauen in der Kunden-Berater-Beziehung?
Vertrauen basiert auf Kompetenz, Integrität und Wohlwollen. In der Vermögensverwaltung ist es ein Prozess, der durch Transparenz und langfristige Orientierung an Kundeninteressen aufgebaut wird.
Was zeichnet ein vertrauensvolles Unternehmenskonzept in der Vermögensverwaltung aus?
Ein solches Konzept umfasst einen umfassenden Beratungsansatz, eine transparente Gebührenstruktur (statt versteckter Provisionen) und ein System aus Kontrollen ("Checks and Balances").
Was sind die zentralen Komponenten von Vertrauen laut der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Vertrauenssituationen, die Vertrauensentscheidung und die anschließende Vertrauenshandlung sowie den Wiederaufbau nach einem Vertrauensbruch.
- Quote paper
- Petra Köhler (Author), 2011, Krise als Chance? Gründung einer unabhängigen Vermögensverwaltung in Deutschland nach der Finanzkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172159