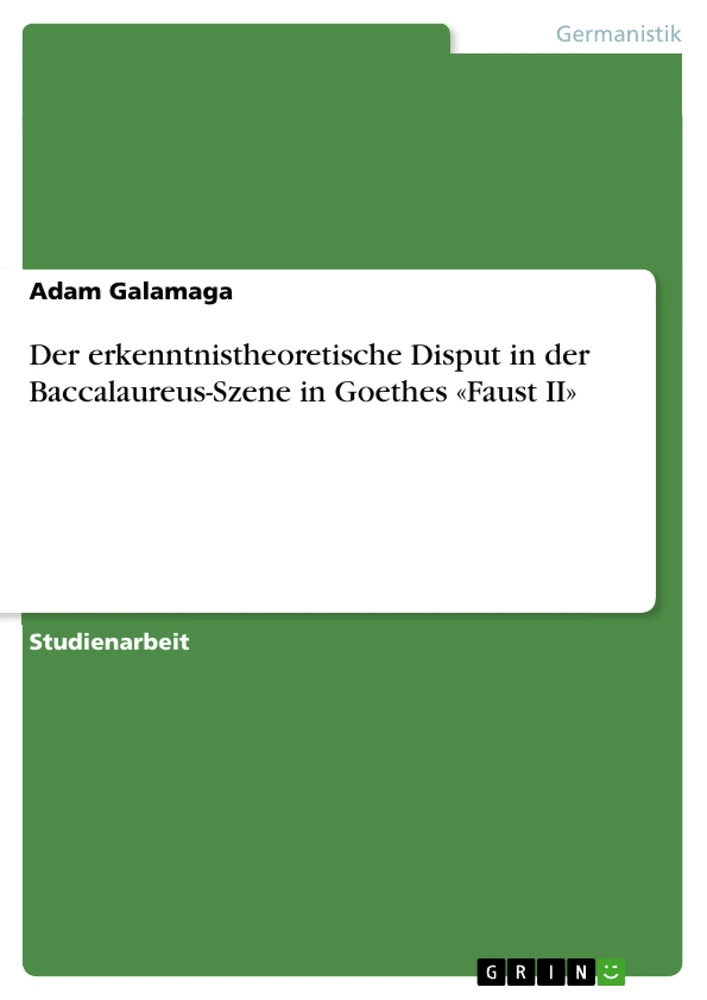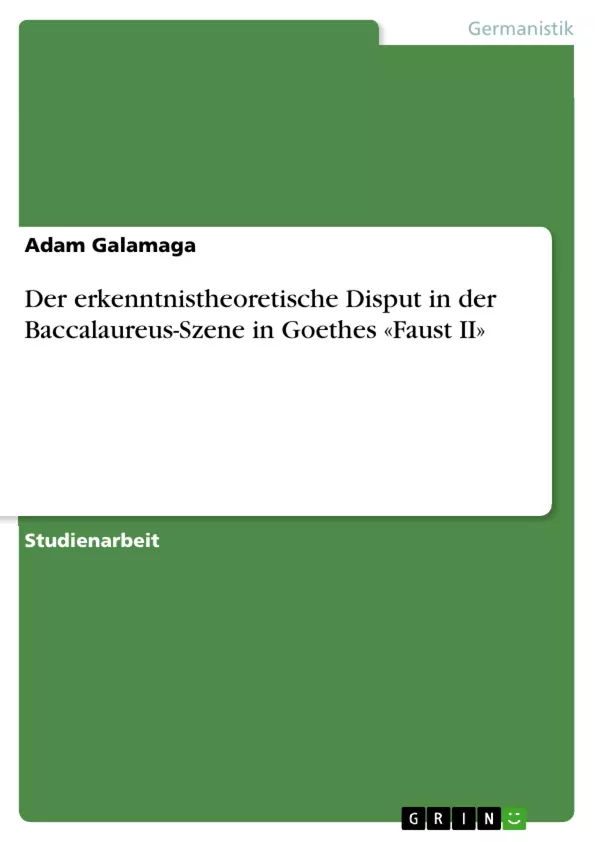Dass die Tragödie um Faust einer philosophischen Auslegung unterzogen werden und dabei Einiges über die Weltanschauung von deren Autor verraten mag, wurde bereits von Friedrich Schiller bemerkt, der in seinem Brief an Goethe vom 22. Juni 1797 feststellte, dass die Anforderungen an den «Faust» sowohl philosophisch, als auch poetisch seien, und dass die Natur des Gegenstandes eine philosophische Betrachtung geradezu erforderlich mache.
Inhaltlich lassen sich in Goethes Werk zahlreiche Verweise und Anspielungen auf philosophische Fragestellungen finden, dies betrifft sowohl den ersten, als auch den zweiten Teil des Dramas. Die Gelehrtentragödie betrifft im Allgemeinen das Problem der Erkenntnisfähigkeit des Menschen sowie die Frage nach der Möglichkeit, dem menschlichen Leben einen höheren und festen Sinn im kosmischen Spiel zwischen dem Guten und dem Bösen zu verleihen. Einzelne Episoden des «Faust» betreffen aber auch ganz spezielle philosophische Probleme. In «Faust II» beziehen sich diese Probleme hauptsächlich auf die Erschaffung der Welt – die ‚Genesis’ ist dessen thematischer Schwerpunkt. In genuin philosophischer Hinsicht ist der zweite Akt von besonderem Interesse, denn darin wird nach dem Ursprung der Welt im menschlichen Geist gesucht, und zwar am Beispiel eines Jünglings, der sich zum Zentrum der Welt erklärt, sowie am Beispiel der Erschaffung künstlicher Intelligenz, des Homunkulus. Die Baccalaureus-Szene, in der ein junger Student einen erkenntnistheoretischen Disput mit Mephisto führt und dabei die Bedeutung des Subjekts für die Erkenntnis stark hervorhebt, ist nicht nur für das Gesamtkonzept des Dramas von Bedeutung, sondern wirft auch zahlreiche textexterne Fragen auf. Als besonders brisant erscheint die Frage, inwiefern Goethe eine bestimmte erkenntnistheoretische Position kritisieren wollte. Diesen Problemstellungen wird in dieser Arbeit nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Goethes «Faust» als philosophisches Werk...
- II. Die Baccalaureus-Szene...
- II.I. Die Figurenkonstellation in der Baccalaureus-Szene.....
- II.II. Die Rolle des Mephisto
- II.III. Die Figur des Baccalaureus…..\li>
- III. Der erkenntnistheoretische Disput zwischen Baccalaureus und Mephisto...
- III.I. Fichte oder Schopenhauer?..\li>
- IV. Goethe als Kritiker des Deutschen Idealismus..
- IV.I. Philosophische Ansichten Goethes......
- V. Bibliographie...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Baccalaureus-Szene in Goethes «Faust II» und untersucht den darin stattfindenden erkenntnistheoretischen Disput zwischen Baccalaureus und Mephisto. Ziel ist es, Goethes Position im Kontext des Deutschen Idealismus zu beleuchten und zu erforschen, inwiefern er bestimmte erkenntnistheoretische Strömungen kritisiert oder affirmiert.
- Goethes Philosophie im Kontext von «Faust»
- Die erkenntnistheoretische Rolle des Subjekts in der Baccalaureus-Szene
- Mephistos Rolle im erkenntnistheoretischen Disput
- Goethes Verhältnis zum Deutschen Idealismus
- Die Bedeutung der Baccalaureus-Szene für die Gesamthandlung des Dramas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die philosophische Dimension von Goethes «Faust» und stellt den Zusammenhang zwischen Poesie und Philosophie im Werk Goethes dar. Dabei wird Goethes Ablehnung einer „trockenen“ Erkenntnistheorie und seine Präferenz für eine lebensnahe Epistemologie hervorgehoben.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Baccalaureus-Szene, analysiert die Figurenkonstellation und erörtert die Rolle von Mephisto und Baccalaureus. Es werden die Gemeinsamkeiten zwischen dem Schüler aus dem ersten Teil des Dramas und dem Baccalaureus herausgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert den erkenntnistheoretischen Disput zwischen Baccalaureus und Mephisto und untersucht, inwiefern dieser Disput auf Fichte oder Schopenhauer verweist.
Schlüsselwörter
Goethes «Faust», Erkenntnistheorie, Deutscher Idealismus, Baccalaureus-Szene, Mephisto, Philosophie, Subjekt, Kunst, Poesie, Epistemologie, Weltanschauung.
- Quote paper
- Adam Galamaga (Author), 2010, Der erkenntnistheoretische Disput in der Baccalaureus-Szene in Goethes «Faust II», Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172215