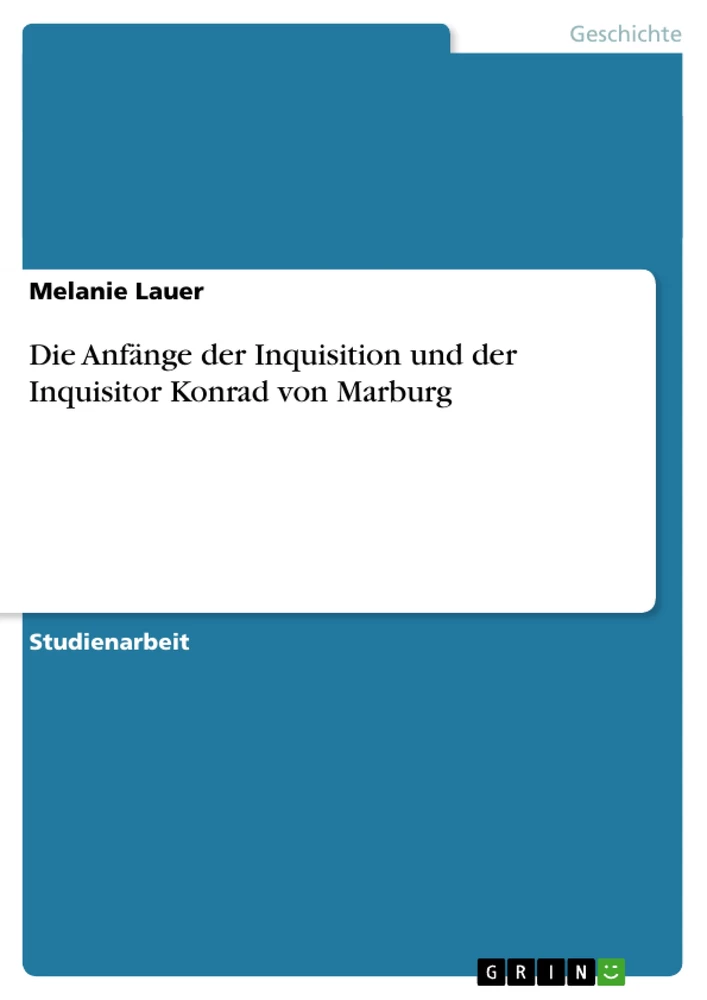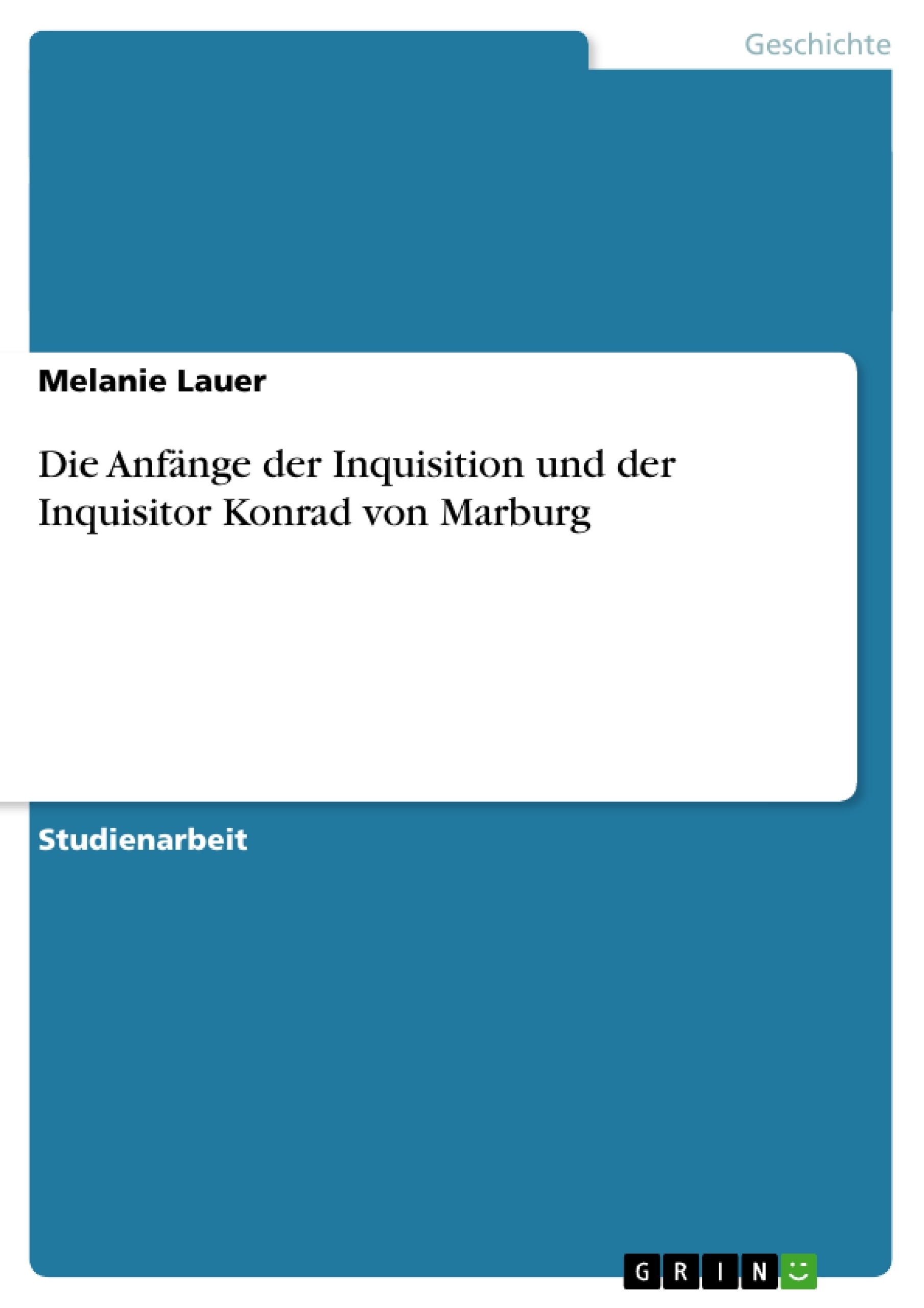Ketzerei ist „eine besondere Art des Unglaubens, sich beziehend auf diejenigen, die den Glauben an Christus zwar bekennen, aber des- sen Lehrsätze verderben“ 1 .
So beschreibt Thomas von Aquin die Gemeinschaften, deren Verfol- gung im Laufe des 12. und 13. Jahrhundert herausgebildet und per- fektioniert wurde – die Inquisition.
In dieser Seminararbeit geht es darum, die Anfänge und die Entwick- lung der Inquisition darzustellen. Die beiden Päpste Innozenz III. und Gregor IX. sind dabei von besonderer Bedeutung. Auch die Voll- zugsorgane der Inquisition werden in dieser Arbeit Beachtung finden. Dabei handelt es sich zum einen um den Orden der Dominikaner und zum anderen um den Inquisitor Konrad von Marburg, der als einzel- ne Persönlichkeit vorgestellt wird.
An dieser Stelle werde ich nicht nur seine Biographie und die Tätig- keit als Inquisitor berücksichtigen, sondern auch auf seine äußerst interessante Persönlichkeit eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der Inquisition
- Die Anfänge der Ketzerverfolgung
- Das Gerichtsverfahren am Anfang der Ketzerverfolgung
- Die Entwicklung unter Innozenz III.
- Die Ketzerbekämpfung unter Gregor IX.
- Die Ketzerbekämpfung durch die Dominikaner
- Konrad von Marburg
- Das Leben des Konrad von Marburg / kurze Biographie
- Konrads Wirken in Thüringen als Seelenführer Elisabeths
- Konrads Tätigkeit als Inquisitor
- Konrads Nachwirken
- Fazit und Zusammenfassung
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anfänge und die Entwicklung der Inquisition im 12. und 13. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der institutionellen Entwicklung der Inquisition, der Rolle bedeutender Päpste wie Innozenz III. und Gregor IX., sowie der beteiligten Akteure, insbesondere des Dominikanerordens und des Inquisitors Konrad von Marburg. Die Arbeit beleuchtet Konrads Wirken und Persönlichkeit im Kontext der Inquisition.
- Die Entstehung und Entwicklung der Inquisition
- Die Rolle der Päpste Innozenz III. und Gregor IX. in der Ketzerbekämpfung
- Die Organisation und Methoden der Inquisition
- Das Wirken des Inquisitors Konrad von Marburg
- Die verschiedenen Gerichtsverfahren der frühen Inquisition
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert Ketzerei nach Thomas von Aquin und beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Anfänge und Entwicklung der Inquisition, die Rolle von Innozenz III. und Gregor IX., sowie die Bedeutung der Dominikaner und Konrad von Marburg als zentrale Akteure der Ketzerverfolgung. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der sowohl institutionelle Aspekte als auch die Biographie und Persönlichkeit Konrads von Marburg umfasst.
2. Die Entwicklung der Inquisition: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Inquisition als Reaktion auf das zunehmende Aufkommen häretischer Gruppen im 11. und 12. Jahrhundert. Es beleuchtet die frühen, noch unorganisierten Methoden der Ketzerverfolgung und die allmähliche Entwicklung eines geregelten Vorgehens, beginnend mit dem 3. Laterankonzil (1179) und dem Edikt von Verona (1184). Das Kapitel beschreibt die drei verschiedenen Gerichtsverfahren (Akkusationsprozess, Denunziationsprozess, Inquisitionsprozess) und ihren Wandel im Laufe der Zeit, wobei sich der Inquisitionsprozess als vorherrschende Form etablierte. Die zunehmende Institutionalisierung und die Herausbildung präziserer Verfahren zur Ketzerbekämpfung stehen im Mittelpunkt dieser Darstellung.
3. Konrad von Marburg: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Biographie und das Wirken des Inquisitors Konrad von Marburg. Es behandelt sein Leben, seine Rolle als Seelenführer Elisabeths von Thüringen, seine Tätigkeit als Inquisitor und die Nachwirkungen seines Wirkens. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner Persönlichkeit und seiner Bedeutung im Kontext der Inquisition, wobei seine Methoden und sein Einfluss auf die Ketzerverfolgung detailliert untersucht werden. Die Verbindung seines persönlichen Lebens und seiner Rolle als Inquisitor wird herausgestellt.
Schlüsselwörter
Inquisition, Ketzerverfolgung, Innozenz III., Gregor IX., Konrad von Marburg, Dominikaner, Gerichtsverfahren, Häresie, Mittelalter, Ketzer, kirchliche Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Inquisition und Konrad von Marburg
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Anfänge und Entwicklung der Inquisition im 12. und 13. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der institutionellen Entwicklung, der Rolle bedeutender Päpste (Innozenz III. und Gregor IX.), des Dominikanerordens und insbesondere des Inquisitors Konrad von Marburg. Die Arbeit beleuchtet sowohl institutionelle Aspekte als auch Konrads Wirken und Persönlichkeit im Kontext der Inquisition.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Inquisition, die Rolle der Päpste Innozenz III. und Gregor IX. in der Ketzerbekämpfung, die Organisation und Methoden der Inquisition, das Wirken des Inquisitors Konrad von Marburg und die verschiedenen Gerichtsverfahren der frühen Inquisition.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung der Inquisition, ein Kapitel über Konrad von Marburg, ein Fazit/Zusammenfassung und eine Literaturangabe. Das Kapitel zur Entwicklung der Inquisition beschreibt die Entstehung und die allmähliche Institutionalisierung der Ketzerverfolgung, inklusive der verschiedenen Gerichtsverfahren (Akkusationsprozess, Denunziationsprozess, Inquisitionsprozess). Das Kapitel zu Konrad von Marburg konzentriert sich auf seine Biographie, seine Rolle als Seelenführer Elisabeths von Thüringen und seine Tätigkeit als Inquisitor.
Welche Rolle spielen Innozenz III. und Gregor IX. in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Papst Innozenz III. und Gregor IX. als wichtige Akteure in der Entwicklung und Institutionalisierung der Inquisition und ihrer Methoden der Ketzerbekämpfung.
Welche Bedeutung hat Konrad von Marburg für die Seminararbeit?
Konrad von Marburg steht als zentrale Figur im Mittelpunkt der Arbeit. Es wird seine Biographie, seine Rolle als Seelenführer Elisabeths von Thüringen, seine Tätigkeit als Inquisitor und die Nachwirkungen seines Wirkens detailliert untersucht. Die Verbindung seines persönlichen Lebens und seiner Rolle als Inquisitor wird besonders hervorgehoben.
Welche Arten von Gerichtsverfahren werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt drei verschiedene Gerichtsverfahren der frühen Inquisition: den Akkusationsprozess, den Denunziationsprozess und den Inquisitionsprozess, und ihren Wandel im Laufe der Zeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inquisition, Ketzerverfolgung, Innozenz III., Gregor IX., Konrad von Marburg, Dominikaner, Gerichtsverfahren, Häresie, Mittelalter, Ketzer, kirchliche Rechtsprechung.
Wie wird Ketzerei in der Einleitung definiert?
Die Einleitung definiert Ketzerei anhand der Definition von Thomas von Aquin (obwohl die genaue Definition nicht im gegebenen Text steht, wird dies implizit erwähnt).
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die Kernaussagen und den Fokus jedes Kapitels detailliert beschreibt.
- Quote paper
- Melanie Lauer (Author), 2003, Die Anfänge der Inquisition und der Inquisitor Konrad von Marburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17229