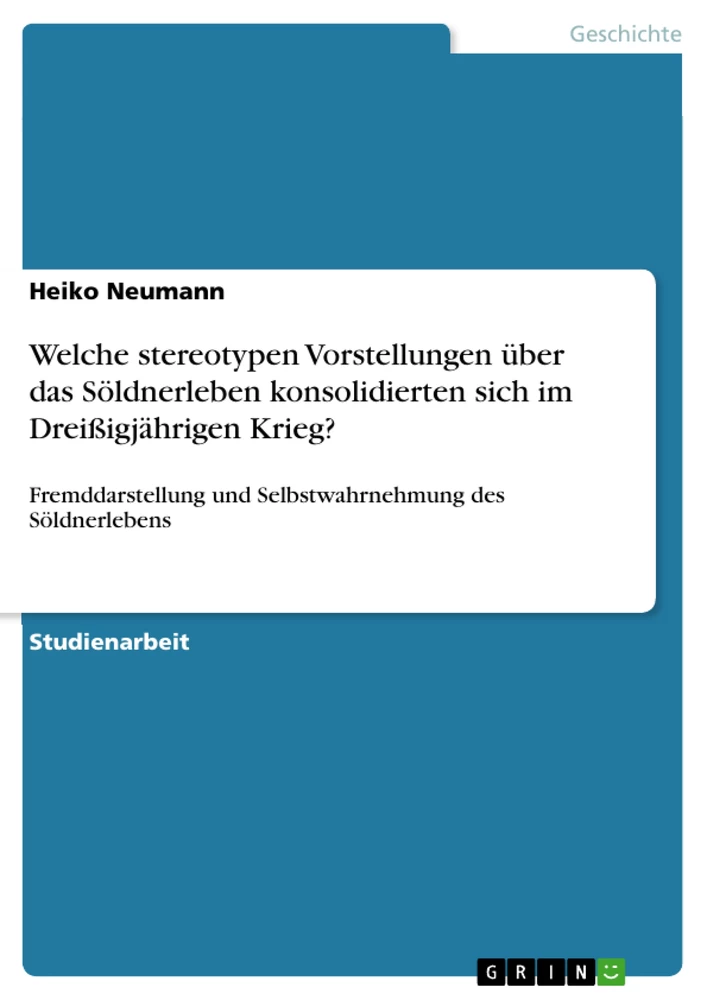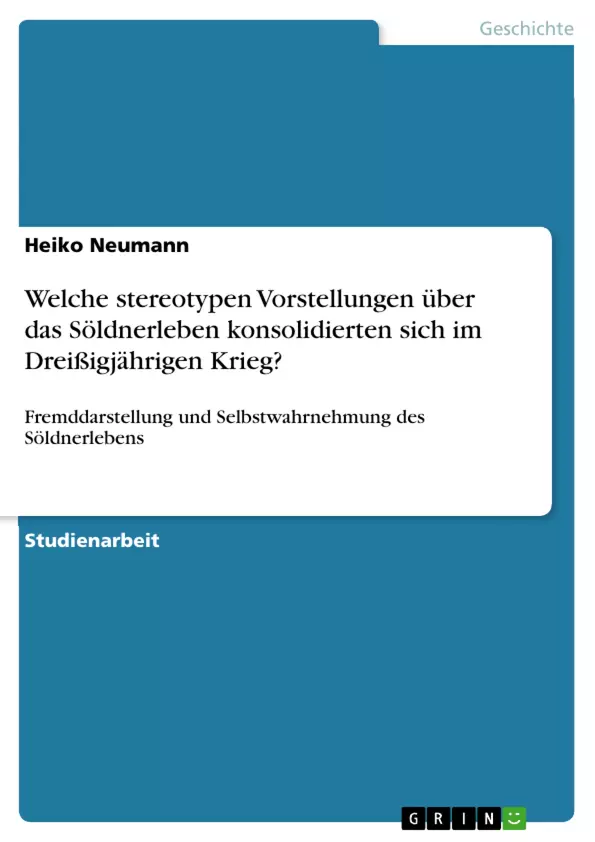Wenn in deutschen Schulbüchern der Versuch unternommen wird, den Krieg in seiner erbarmungslosen
Charakteristik darzustellen, bedient man sich Jacques Callots Radierungen. Les Misères et
les Malheurs de la Guerre stellen entsetzliche Szenen der Gewalt dar. Die Darstellung des
Krieges als Ganzes, setzt sich jedoch aus seinen tragenden Teilen zusammen, den Söldnern.
Sie sind die Träger der Gewalt und erst ihre Handlungen erzeugen Reaktionen, welche die
Gewaltspirale immer neu ablaufen lassen. Das Bild des Krieges, wird durch die Kontur der
Söldner gezeichnet.
Welche stereotypen Erscheinungen, Motive, Handlungen und Eigenschaften werden den
Waffenträgern dabei von den Zeitzeugen zugeschrieben? Lassen sich darüber hinaus die
Deutungen der Außenperspektive, in der Innenperspektive, der Selbstwahrnehmung der
Söldner wiederfinden?
Im Rahmen dieser Seminararbeit soll im ersten Kapitel die Erarbeitung der Außenperspektive
durch Callots Werke erfolgen. Die Radierungen sind von besonderem Interesse für diese
Fragestellung, da diese nicht den kommerziellen Absatzbedingungen der Flugblätter
unterlagen. Vielmehr wurden die Kriegsereignisse und ihre Träger als Ganzes dargestellt,
wohingegen Flugblatt-Illustrationen oftmals versuchten, vom Individuum auf das Söldner-
Kollektiv zu schließen. Durch diesen methodischen Zugang ist zu erwarten, dass nicht das
vollständige Konglomerat stereotyper Vorstellungen der Gesellschaft wiedergegeben werden
kann, wie dies etwa in der Dissertation Huntebrinkers geschehen ist. Jedoch erlaubt die
Gesamtdarstellung der Söldner als soziale Gruppe, einen differenzierteren Blick auf den nach außen hin geschlossenen Personenverband. So illustrierte Callot das Abfallen marodierender
Söldner vom disziplinierten Großverband.
Im zweiten Kapitel wird die Innenperspektive der Söldner untersucht. Stellvertretend für eine
ganze soziale Gruppe, werden die Tagebuchaufzeichnungen eines einfachen Söldners helfen,
das Spektrum der Untersuchung zu erweitern. Der besondere Reiz dieser Untersuchung findet
seine Begründung in der Auseinandersetzung mit schriftlichen Quellen unterer sozialer
Schichten, jenseits der Arbeit mit den Quellen der „großen Männer“.
Somit folgt die Arbeit dem Trend, vermehrt Selbstzeugnisse für die Rekonstruktion
vergangener Lebenssituationen hinzuzuziehen.
Abschließend werden beide Wahrnehmungen in das Kritikfeld der Multiperspektivität überführt, um so ein differenziertes Bild vorherrschender Stereotypen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Kapitel - die Außenperspektive:
Les Misères et les Malheurs de la Guerre – Jacques Callots Radierungen- 1.1. Ereignisgeschichtliche Einordnung
- 1.2. Quellenkritik
- 1.3. Darstellungen des Söldnerlebens in der Außenperspektive
- 2. Kapitel - die Innenperspektive:
Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg – editiert von Jan Peters- 2.1. Ereignisgeschichtliche Einordnung
- 2.2. Quellenkritik
- 2.3. Selbstwahrnehmung eines Söldners
- 3. Kapitel – Schlussbetrachtung und Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die stereotypen Vorstellungen über das Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Sie befasst sich mit der Außenperspektive, dargestellt in den Radierungen von Jacques Callot, und der Innenperspektive, die durch die Tagebuchaufzeichnungen eines Söldners beleuchtet wird.
- Stereotypisierung des Söldnerlebens im Dreißigjährigen Krieg
- Analyse der Außenperspektive durch Jacques Callots Radierungen "Les Misères et les Malheurs de la Guerre"
- Rekonstruktion der Innenperspektive durch die Tagebuchaufzeichnungen eines Söldners
- Vergleich der Außen- und Innenperspektive hinsichtlich der stereotypen Vorstellungen
- Einordnung des Söldnerlebens in den Kontext des Dreißigjährigen Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kapitel - die Außenperspektive: Les Misères et les Malheurs de la Guerre – Jacques Callots Radierungen
Das Kapitel untersucht Jacques Callots Radierungen "Les Misères et les Malheurs de la Guerre" als Quelle zur Darstellung des Söldnerlebens im Dreißigjährigen Krieg. Dabei wird die Serie der Radierungen in den historischen Kontext des Lothringischen Krieges (1632-1633) eingebettet und die Quellenkritik im ikonographisch-ikonologischen Ansatz von Panofsky diskutiert.
2. Kapitel - die Innenperspektive: Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg – editiert von Jan Peters
Dieses Kapitel befasst sich mit der Innenperspektive des Söldnerlebens im Dreißigjährigen Krieg anhand der Tagebuchaufzeichnungen eines einfachen Söldners. Die Arbeit untersucht die Quellenkritik und die Bedeutung von Selbstzeugnissen für die Rekonstruktion vergangener Lebensumstände.
Schlüsselwörter
Söldnerleben, Dreißigjähriger Krieg, Stereotype, Außenperspektive, Innenperspektive, Jacques Callot, "Les Misères et les Malheurs de la Guerre", Tagebuchaufzeichnungen, Quellenkritik, Selbstwahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Stereotypen über Söldner entstanden im Dreißigjährigen Krieg?
Die Arbeit untersucht Motive wie Gewaltbereitschaft, Marodieren und die soziale Abkoppelung vom disziplinierten Heer als gängige Klischees der Zeit.
Was zeigen Jacques Callots Radierungen über den Krieg?
Seine Serie „Les Misères et les Malheurs de la Guerre“ stellt die Grausamkeit des Krieges und das Verhalten der Söldner aus einer kritischen Außenperspektive dar.
Wie sahen sich die Söldner selbst?
Anhand von Tagebuchaufzeichnungen eines einfachen Söldners wird die Innenperspektive und Selbstwahrnehmung jenseits der offiziellen Geschichtsschreibung rekonstruiert.
Warum sind Callots Werke methodisch so wichtig?
Im Gegensatz zu kommerziellen Flugblättern erlauben sie einen differenzierteren Blick auf die Söldner als soziale Gruppe und deren Zerfallsprozesse.
Was bedeutet Multiperspektivität in dieser Arbeit?
Sie bezeichnet den Vergleich von Fremdbild (Callot) und Selbstbild (Tagebuch), um ein umfassendes Bild der damaligen Realität zu erhalten.
- Quote paper
- Heiko Neumann (Author), 2011, Welche stereotypen Vorstellungen über das Söldnerleben konsolidierten sich im Dreißigjährigen Krieg?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172322