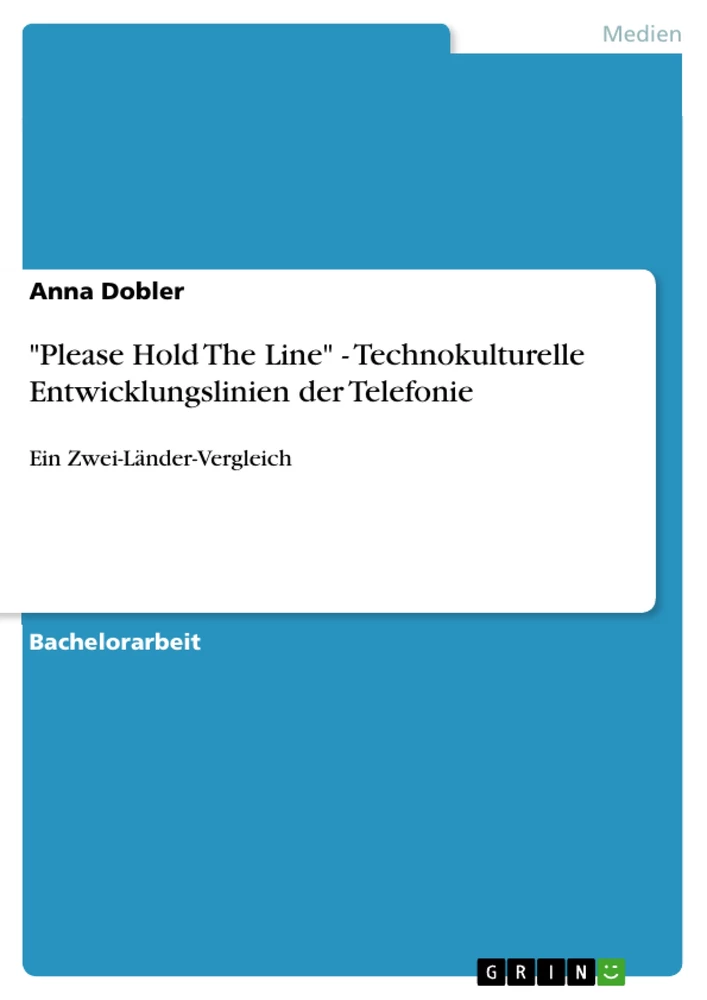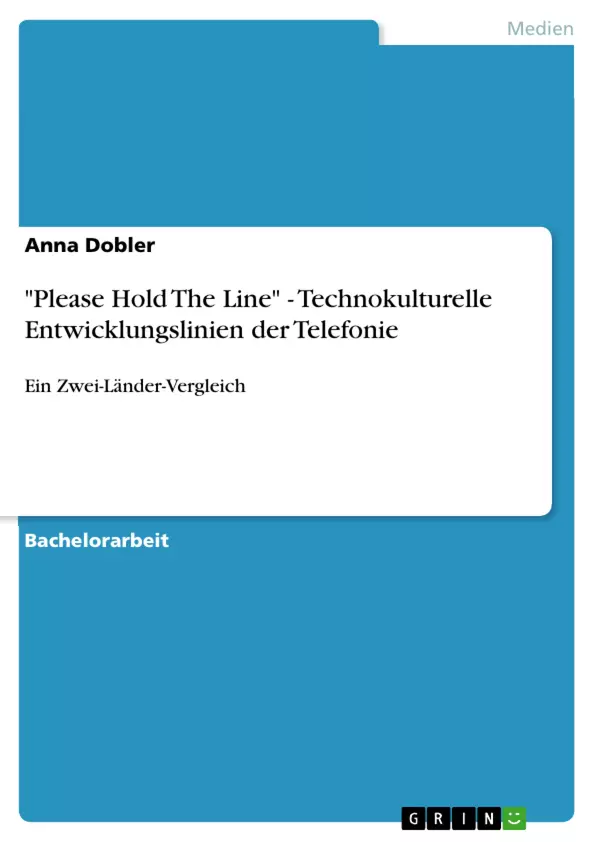„Das Pferd frißt keinen Gurkensalat.“- Dieser groteske Satz markierte den Auftakt einer globalen Kommunikationsrevolution. Ausgesprochen hat ihn 1861 der deutsche Lehrer Philipp Reis (vgl. Maschke 1989: 97), als es ihm zum ersten Mal gelang, Stimme mit Hilfe elektronischen Stroms zu übermitteln. Damit legte er den Grundstein des Siegeszug der Telefonie als neue interaktive Kommunikationsinfrastruktur, die sich im Laufe ihrer internationalen Entwicklung häufig gegen Widerstände verschiedenster Art behaupten musste, bis sie schließlich Einzug fand in die Privaträume und Arbeitsstellen vieler Millionen Menschen. Heute ist das Telefon fest in unseren kommunikativen Alltag integriert und ist aus unserer modernen Welt auch nicht mehr wegdenkbar.
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit möchte über das reine Rezitieren wissenschaftlicher Daten hinausgehen und sowohl techno-, als auch soziokulturelle Aspekte der Telefonie von seiner Erfindung bis in die Gegenwart in den Vordergrund rücken. Um dies zu ermöglichen, wurde die Entwicklung der Telefonie als interaktive Kommunikationsstruktur in zwei exemplarisch ausgewählten Ländern gegenübergestellt: Deutschland und Amerika. Beide zeigen spezifische Charakteristika in diesem Forschungsbereich auf, die sich für einen Vergleich hervorragend eignen.
Zu Beginn soll jedoch kurz auf die Geschichte des Telefons eingegangen werden, die Ausgangssituation und den legendären Erfinderwettstreit. Anschließend widmet sich die Arbeit der komplexen Thematik differenzierender kultureller Konzepte von Telefonie und zeigt auf, welches sich letztendlich durchgesetzt hat. Weiterführend soll mit Hilfe eines Ländervergleichs Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der jeweiligen Ausgangssituation, der technischen Entwicklung und der Diffusionsgeschwindigkeit, den forcierenden und hemmenden Faktoren und den frühen Nutzungsformen und Nutzungsgruppen der Telefonie herausgearbeitet werden.
Die zu Beginn formulierten Forschungsfragen sollen abschließend mittels der Ergebnisse des Vergleichs beantwortet werden. Die wissenschaftliche Grundlage bildet eine umfassende Berücksichtigung einschlägiger Fachliteratur aus verschiedenen Kulturkreisen und Epochen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Forschungsfragen
- 3. Kurze Geschichte der Telefonie
- 3.1. Ausgangspunkt: Die Zeit vor 1876
- 3.2. Eine Idee - viele Erfinder
- 3.2.1 Philipp Reis
- 3.2.2. Alexander Graham Bell
- 3.2.3. Schlussfolgerung: Zwei Forscher - differente Motive
- 4. Drei kulturelle Konzepte von Telefonie
- 4.1. Das Transportkonzept
- 4.2. Das Radiokonzept
- 4.3. Das Verständigungskonzept
- 5. Der globale Siegeszug der Telefonie: Ein Zwei-Länder-Vergleich
- 5.1. Die Ausgangssituation
- 5.1.1. In Deutschland
- 5.1.2. In Amerika
- 5.2. Die technische Entwicklung
- 5.2.1. In Deutschland
- 5.2.2. In Amerika
- 5.3. Forcierende und hemmende Faktoren
- 5.3.1. Hemmende Faktoren in Deutschland
- 5.3.2. Forcierende Faktoren in Deutschland
- 5.3.3. Hemmende Faktoren in Amerika
- 5.3.3. Forcierende Faktoren in Amerika
- 5.4. Erste Nutzungsformen und -gruppen
- 5.4.1. In Deutschland
- 5.4.2. In Amerika
- 5.1. Die Ausgangssituation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die techno- und soziokulturellen Aspekte der Telefonieentwicklung, indem sie einen Zwei-Länder-Vergleich (Deutschland und Amerika) vornimmt. Ziel ist es, über die reine technische Entwicklungsgeschichte hinauszugehen und den kulturellen und gesellschaftlichen Einfluss auf die Verbreitung und Akzeptanz des Telefons zu beleuchten.
- Technische Entwicklung der Telefonie in Deutschland und Amerika
- Kulturelle Konzepte von Telefonie und deren Durchsetzung
- Forcierende und hemmende Faktoren der Telefoniediffusion
- Frühe Nutzungsformen und -gruppen des Telefons
- Vergleich der Entwicklung in Deutschland und Amerika
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung zitiert Christian Kämmerling, um die revolutionäre und zugleich vereinfachende Wirkung des Telefons zu betonen. Sie verweist auf die frühen Formen der Telekommunikation und hebt die Bedeutung des Telefons als erstes interaktives Kommunikationsinstrument hervor. Die Arbeit fokussiert auf die soziokulturellen und ökonomischen Kontexte der Telefonieentwicklung und kündigt einen Zwei-Länder-Vergleich (Deutschland und Amerika) an, um die komplexen Aspekte der Technologieentwicklung zu untersuchen.
3. Kurze Geschichte der Telefonie: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der Telefonie vor 1876, den Erfinderwettstreit zwischen Philipp Reis und Alexander Graham Bell, deren unterschiedliche Motive und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Entwicklung der Technologie. Es stellt den historischen Kontext dar und bereitet den Weg für die spätere Analyse der kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse.
4. Drei kulturelle Konzepte von Telefonie: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert drei verschiedene kulturelle Konzepte der Telefonie: das Transport-, das Radio- und das Verständigungskonzept. Es untersucht, wie diese Konzepte die Wahrnehmung und Nutzung des Telefons beeinflusst haben und welches Konzept sich letztendlich durchgesetzt hat. Die Analyse dieser Konzepte bildet eine wichtige Grundlage für das Verständnis der unterschiedlichen Entwicklungspfade in Deutschland und Amerika.
5. Der globale Siegeszug der Telefonie: Ein Zwei-Länder-Vergleich: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und vergleicht die Entwicklung der Telefonie in Deutschland und Amerika. Es untersucht die Ausgangssituation in beiden Ländern, die technischen Entwicklungen, forcierende und hemmende Faktoren sowie die ersten Nutzungsformen und -gruppen. Der Vergleich soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen und die Forschungsfragen der Arbeit beantworten.
Schlüsselwörter
Telefonie, Medialisierung, Mediatisierung, Kommunikationsgeschichte, Technikgeschichte, Deutschland, Amerika, Zwei-Länder-Vergleich, kulturelle Konzepte, soziokulturelle Faktoren, technische Entwicklung, Diffusionsprozesse, Nutzungsformen, Kommunikationsinfrastruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Eine Analyse der Telefonieentwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die techno- und soziokulturellen Aspekte der Telefonieentwicklung im Vergleich zwischen Deutschland und Amerika. Sie geht über die reine technische Entwicklungsgeschichte hinaus und beleuchtet den kulturellen und gesellschaftlichen Einfluss auf die Verbreitung und Akzeptanz des Telefons.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die technische Entwicklung der Telefonie in Deutschland und Amerika, kulturelle Konzepte von Telefonie und deren Durchsetzung, forcierende und hemmende Faktoren der Telefoniediffusion, frühe Nutzungsformen und -gruppen des Telefons sowie einen Vergleich der Entwicklung in beiden Ländern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Forschungsfragen, eine kurze Geschichte der Telefonie, drei kulturelle Konzepte der Telefonie und ein Zwei-Länder-Vergleich (Deutschland/Amerika) zum globalen Siegeszug der Telefonie. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Wie wird die Geschichte der Telefonie dargestellt?
Die kurze Geschichte der Telefonie beleuchtet die Anfänge vor 1876, den Wettstreit zwischen Philipp Reis und Alexander Graham Bell und deren unterschiedliche Motive. Es wird der historische Kontext dargestellt, um die spätere Analyse der kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse zu ermöglichen.
Welche kulturellen Konzepte der Telefonie werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei kulturelle Konzepte: das Transportkonzept, das Radiokonzept und das Verständigungskonzept. Es wird untersucht, wie diese Konzepte die Wahrnehmung und Nutzung des Telefons beeinflusst haben und welches sich durchgesetzt hat. Diese Analyse bildet die Grundlage für den Ländervergleich.
Wie gestaltet sich der Zwei-Länder-Vergleich (Deutschland/Amerika)?
Der Kern der Arbeit ist der Vergleich der Telefonieentwicklung in Deutschland und Amerika. Es werden die Ausgangssituation, die technischen Entwicklungen, forcierende und hemmende Faktoren sowie die ersten Nutzungsformen und -gruppen untersucht, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die Forschungsfragen zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Telefonie, Medialisierung, Mediatisierung, Kommunikationsgeschichte, Technikgeschichte, Deutschland, Amerika, Zwei-Länder-Vergleich, kulturelle Konzepte, soziokulturelle Faktoren, technische Entwicklung, Diffusionsprozesse, Nutzungsformen und Kommunikationsinfrastruktur.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit bietet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die jeweils die wichtigsten Punkte und Ergebnisse des jeweiligen Kapitels zusammenfasst. Diese Zusammenfassungen erleichtern das Verständnis des Inhalts.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser, die sich für die Geschichte der Telefonie, soziokulturelle Aspekte von Technologieentwicklung und vergleichende Analysen interessieren.
Welche Zitate werden verwendet?
Die Einleitung zitiert Christian Kämmerling, um die revolutionäre und vereinfachende Wirkung des Telefons zu betonen.
- Quote paper
- Anna Dobler (Author), 2010, "Please Hold The Line" - Technokulturelle Entwicklungslinien der Telefonie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172402