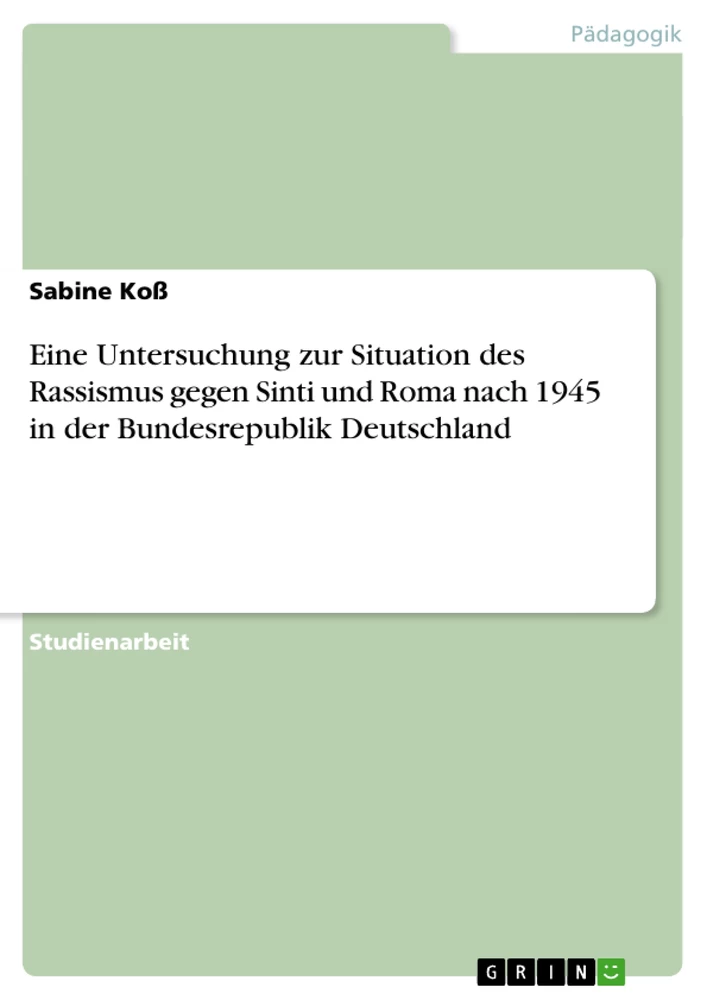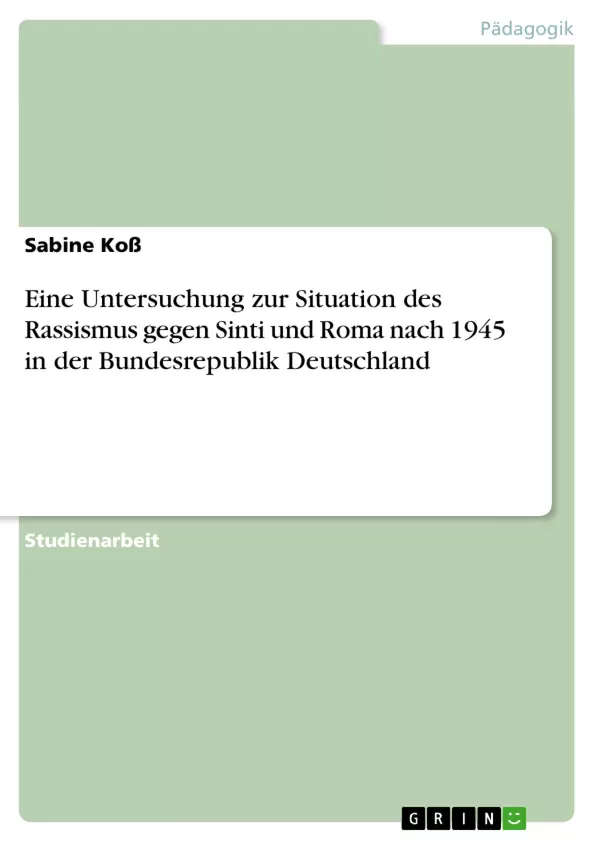In der Vorstellungswelt der meisten Deutschen verkörpern „Zigeuner“ wohl Gefahr und Idylle zugleich (Mihok, Widmann 2001, S. 42). Obwohl die wenigsten Menschen in Deutschland persönliche Erfahrungen mit der ethnischen Minderheit der Sinti und Roma haben, werden sie doch zumeist abgelehnt. Nach einer Studie des Emnid-Instituts von 1994 lehnen 68% der Deutschen „Zigeuner“ als Nachbarn ab (Mihok, Widmann 2001, S. 43). Die Vorstellung, wie „Zigeuner“ sind, hat jedoch nichts mit der Realität der Sinti und Roma zu tun und spiegelt nicht ihre Lebensverhältnisse wieder, sondern stellt eine Wiederspiegelung von Ängsten, Vorurteilen und Wünschen der Mehrheitsbevölkerung dar (vgl. Kalkuhl 2002, S. 42; Solms 1998, S. 50). Die Weitergabe dieser „Zigeunerbilder“ und das vermeintliche Wissen um das Leben der Sinti und Roma erfolgt nicht durch eigene Erfahrung, sondern durch Alltagsgespräche, Romane, Opern und Operetten, Filme, Presseberichte usw. (Mihok, Widmann 2001, S. 43).
Ich möchte in dieser Arbeit untersuchen, wie stark der Rassismus gegen Sinti und Roma auch nach Beendigung des 2. Weltkrieges in der Bundesrepublik Deutschland ausgeprägt ist, wobei ich mich nicht auf spektakuläre Vorfälle wie den Wohnheimbrand in Rostock konzentriere, sondern mehr auf den stillen Rassismus, wie er sich auch in der Handlungsweise von Behörden und Politik zeigt. Außerdem möchte ich aufzeigen, wie die Presse Sinti und Roma darstellt und welche Bilder dadurch bei der Mehrheitsbevölkerung erzeugt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Vorurteile
- Rassismus
- Antiziganismus
- Überblick über die Geschichte der Sinti und Roma und des Antiziganismus
- Bis 1933
- 1933 - 1945
- Ab 1945
- Hintergründe zur Entstehung des Antiziganismus
- Religiöse Hintergründe
- Politische Hintergründe
- Wirtschaftliche Hintergründe
- Diskriminierung durch Behörden und Politik nach 1945
- „Zigeunerbilder“ in der Presse (1990 - 2003)
- Kriminalität und Bettelei
- Primitivität und Hygiene
- Nichtsesshaftigkeit
- Musikalität und Romantik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Situation des Rassismus gegen Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Sie fokussiert sich dabei auf die stillen Formen des Rassismus, die in der Handlungsweise von Behörden und Politik zum Ausdruck kommen. Zusätzlich wird beleuchtet, wie die Presse Sinti und Roma darstellt und welche Bilder dadurch in der Mehrheitsgesellschaft entstehen.
- Auswirkungen des Antiziganismus auf Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 2. Weltkrieg
- Diskriminierungserfahrungen von Sinti und Roma im Kontext von Behörden und Politik
- Analyse von "Zigeunerbildern" in der Presse und deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Sinti und Roma in der Gesellschaft
- Verbreitung von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber Sinti und Roma in der deutschen Gesellschaft
- Untersuchung der Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Sinti und Roma und ihrer tatsächlichen Lebensrealität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext und die Relevanz des Themas dar, indem sie auf die verbreiteten Vorurteile und die Ablehnung von Sinti und Roma in der deutschen Gesellschaft hinweist. Des Weiteren erläutert sie die internationale Selbstbezeichnung Roma und die unterschiedlichen Bezeichnungen Sinti und Roma in Deutschland. Die Arbeit selbst fokussiert sich auf die Untersuchung des Rassismus gegen Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, ohne sich auf spektakuläre Einzelfälle zu konzentrieren, sondern den stillen Rassismus in der Handlungsweise von Behörden und Politik zu beleuchten.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Vorurteil, Rassismus und Antiziganismus geklärt. Hierbei wird deutlich, dass Rassismus als eine Form der Diskriminierung anzusehen ist, die auf der falschen Behauptung von unterschiedlichen menschlichen Rassen beruht. Antiziganismus hingegen bezieht sich spezifisch auf die rassistische Ablehnung von Sinti und Roma, die sowohl in Diskriminierung als auch Romantisierung zum Ausdruck kommt.
Das dritte Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Geschichte der Sinti und Roma und des Antiziganismus. Die Kapitel 3.1 bis 3.3 beleuchten die Entwicklungen vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Hintergründe zur Entstehung des Antiziganismus betrachtet. Hierbei werden religiöse, politische und wirtschaftliche Faktoren analysiert, die zur Entstehung von Vorurteilen und Diskriminierung beigetragen haben. Kapitel 4.1 beleuchtet die Rolle religiöser Vorstellungen, 4.2 die politischen Hintergründe und 4.3 die wirtschaftlichen Faktoren.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Diskriminierung von Sinti und Roma durch Behörden und Politik nach 1945. Dieses Kapitel analysiert, wie der Antiziganismus sich in der Praxis durchgesetzt hat und welche Auswirkungen er auf die Lebensbedingungen von Sinti und Roma hatte.
Das sechste Kapitel untersucht die Darstellung von Sinti und Roma in der deutschen Presse zwischen 1990 und 2003. Es analysiert verschiedene "Zigeunerbilder" und zeigt, wie die Medien den Rassismus gegenüber Sinti und Roma reproduziert und verstärkt haben. In den Unterkapiteln 6.1 bis 6.4 werden verschiedene Stereotypen und Vorurteile, die in der Presse verbreitet wurden, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Antiziganismus, Rassismus, Sinti, Roma, Vorurteile, Stereotype, Diskriminierung, Behörden, Politik, Presse, "Zigeunerbilder", Mehrheitsgesellschaft, Bundesrepublik Deutschland, 2. Weltkrieg, Geschichte, Integration, Identität, Lebensbedingungen, Kultur, Sprache, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Untersuchung zu Sinti und Roma?
Die Arbeit untersucht die Situation des Rassismus gegen Sinti und Roma in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, mit einem Fokus auf den "stillen Rassismus" in Behörden und Presse.
Was bedeutet der Begriff „Antiziganismus“?
Antiziganismus bezeichnet die spezifische rassistische Ablehnung von Sinti und Roma, die sich sowohl in Diskriminierung als auch in klischeehafter Romantisierung äußern kann.
Wie werden Sinti und Roma oft in der deutschen Presse dargestellt?
Die Arbeit analysiert gängige Stereotype wie Kriminalität, Bettelei, angebliche Primitivität oder klischeehafte Vorstellungen von Musikalität und Nichtsesshaftigkeit.
Welche Rolle spielten Behörden nach 1945?
Es wird aufgezeigt, dass Diskriminierung durch Behörden und Politik auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortbestand, was oft zu erschwerten Lebensbedingungen für die Minderheit führte.
Gibt es einen Unterschied zwischen Vorurteilen und der Realität?
Ja, die Arbeit betont, dass die verbreiteten „Zigeunerbilder“ eine Widerspiegelung von Ängsten und Wünschen der Mehrheitsgesellschaft sind und kaum etwas mit der tatsächlichen Lebensrealität der Sinti und Roma zu tun haben.
Welche historischen Zeiträume werden betrachtet?
Die Untersuchung gibt einen Überblick über die Geschichte vor 1933, die Verfolgung während der NS-Zeit (1933-1945) und die Entwicklungen ab 1945.
- Quote paper
- Sabine Koß (Author), 2003, Eine Untersuchung zur Situation des Rassismus gegen Sinti und Roma nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17248