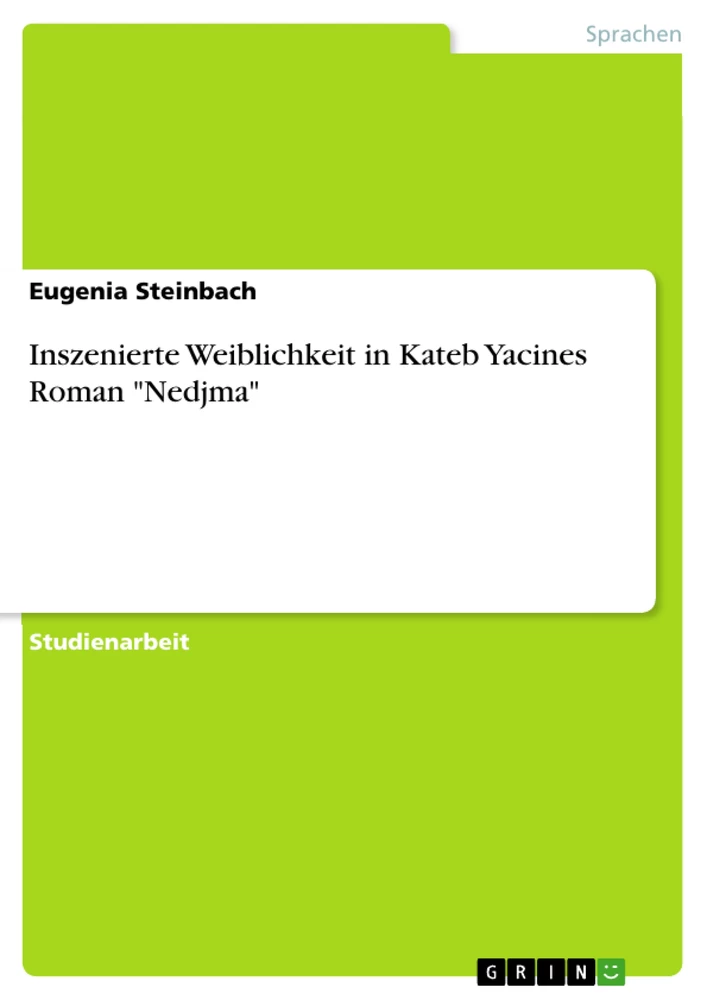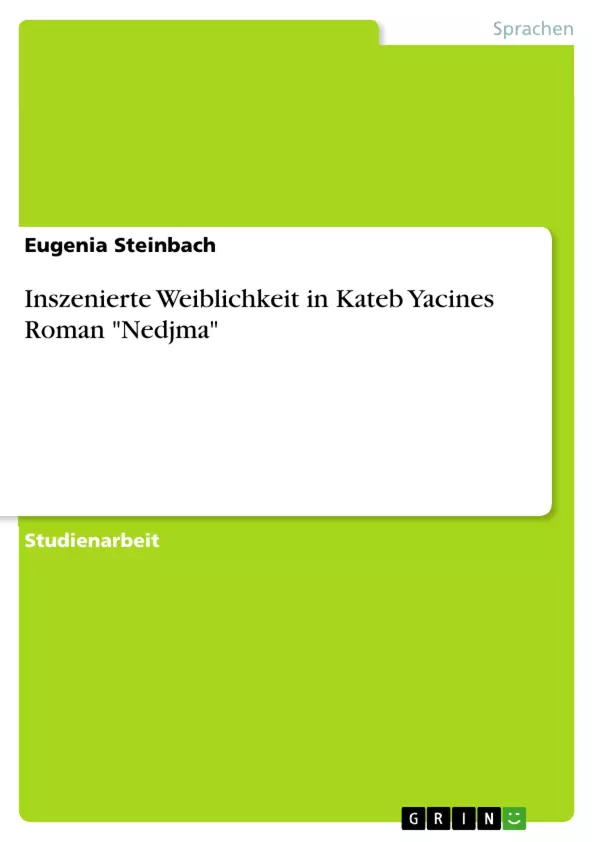Kateb Yacines revolutionärer Roman Nedjma von 1956, ursprünglich ein Gedicht, gilt bei nicht wenigen Lesern als der Klassiker schlechthin in der jüngsten Geschichte der algerischen Literatur in französischer Sprache. Revolutionär war er in vielerlei Hinsicht: So stellt sowohl die komplexe zyklische Romanstruktur mit den mehreren, ineinander verwobenen und gleichzeitig laufenden Erzählsträngen, die sich einer Chronologie widersetzenden Zeitsprünge innerhalb des Textes und „die glänzende aber auch verschlüsselte Sprache als auch der Gebrauch von Symbolen und Traumbildern“2 für die damalige maghrebinische Literatur ein Novum dar, eine neue Art des literarischen Verarbeitens der Zeit vor dem algerischen Befreiungskrieg.
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die inszenierte Weiblichkeit als literarisches Konstrukt in Nedjma zu untersuchen. Dabei ist festzuhalten, dass „der Roman […] zwischen stärker realistischen und symbolisch-metaphorischen Passagen [oszilliert] und […] dadurch Geschichte und Mythos neuartige Dimensionen [bei]legt“3. Sprich: Die Vergangenheit wird aus der Sicht der einzelnen Figuren erlebt, gedeutet, verarbeitet, aus dem Gedächtnis hervorgeholt und erzählt und so kann sie dementsprechend nicht auf eine faktische Wirklichkeit detailgetreu übertragen werden. Zunächst gebe ich einen groben Überblick über die allgemeine Situation der Frauen in Algerien bzw. über das Frauenbild während und vor der Entstehungszeit des Werkes, unter dem Aspekt der Kolonialisierung und ihren Auswirkungen. Den Weg für die eigentliche Analyse ebnet im Anschluss der Versuch, das "Wie" der Thematisierung und Inszenierung von Weiblichkeit algerischer Frauen in der Geschichte darzustellen, von den traditionellen Volkserzählungen bis hin zu Kateb Yacine. Hierbei werde ich nicht allein auf die Literatur, sondern auch auf eine weitere Gattung der Kunst, der Malerei, zurückgreifen.
Im Analyseteil als Kern dieser Arbeit geht es zum einen um die vergleichende Gegenüberstellung von der europäischen bzw. französischen Frau und der muslimischen Frau: Wie werden diese zwei Frauengruppen mit jeweils unterschiedlichem kulturellen Hintergrund (de)konstruiert, inwiefern werden sie den zeitgenössischen Frauenbildern gerecht und auf welche Frauenkonzepte bzw. -rollen wird im Roman zurückgegriffen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Frau in Algerien bis 1956
- Über die Darstellung der algerischen Frau in der Literatur und Kunst bis 1956
- Die Darstellung der europäischen Frau in Nedjma
- Allgemeines
- Suzy
- Madame Clément
- Mademoiselle Dubac
- Nedjmas Mutter
- Die Darstellung der algerischen Frau in Nedjma
- Allgemeines
- Die Dienerin von Monsieur Ricard
- Zohra
- Weitere Figuren und ihre Konstruktion
- Prostituierte
- Nedjma
- Constantine und Bône
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der inszenierten Weiblichkeit als literarisches Konstrukt in Kateb Yacines Roman Nedjma. Die Arbeit analysiert, wie das Werk verschiedene Frauenfiguren mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen konstruiert und welche Rollen ihnen im Roman zukommen. Darüber hinaus wird die zentrale und symbolträchtige Figur Nedjma sowie die Städte Constantine und Bône im Kontext der inszenierten Weiblichkeit untersucht.
- Inszenierte Weiblichkeit als literarisches Konstrukt in Nedjma
- Vergleichende Darstellung europäischer und muslimischer Frauen im Roman
- Analyse der zentralen Figur Nedjma
- Bedeutung der Städte Constantine und Bône
- Einfluss der Kolonialisierung auf die Darstellung von Frauen im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Einblick in die komplexe Romanstruktur von Nedjma und beleuchtet die Bedeutung des Romans für die algerische Literatur. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und gibt einen Überblick über die Themenschwerpunkte.
Kapitel 2 untersucht die Rolle der Frau im Algerien vor der Kolonialisierung und während der Kolonialzeit. Es werden wichtige Aspekte des islamischen Gesetzes und die rechtliche Stellung der Frauen in diesem Kontext behandelt. Die Auswirkungen der Kolonialisierung auf die Stellung der Frau werden beleuchtet.
Kapitel 3 beleuchtet die Darstellung der algerischen Frau in Literatur und Kunst vor 1956. Es werden traditionelle Volkserzählungen sowie künstlerische Werke berücksichtigt, die Einblicke in die Konstruktionen von Weiblichkeit in dieser Zeit liefern.
Kapitel 4 fokussiert auf die Darstellung der europäischen Frau in Nedjma. Es werden verschiedene Figuren wie Suzy, Madame Clément und Mademoiselle Dubac analysiert und in Bezug auf die zeitgenössischen Frauenbilder gesetzt.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Darstellung der algerischen Frau in Nedjma. Es werden Figuren wie die Dienerin von Monsieur Ricard und Zohra untersucht und ihre Rollen innerhalb des Romans beleuchtet.
Kapitel 6 behandelt das Thema der Prostituierten im Roman. Es werden ihre Bedeutung und ihre Rolle im Kontext der Inszenierung von Weiblichkeit untersucht.
Kapitel 7 konzentriert sich auf die Figur Nedjma und ihre symbolische Bedeutung im Roman. Es werden die verschiedenen Interpretationen und Bedeutungsebenen, die mit Nedjma verbunden sind, beleuchtet.
Kapitel 8 beschäftigt sich mit den Städten Constantine und Bône, die im Roman eine wichtige Rolle spielen. Es werden die Städte als Orte der Inszenierung von Weiblichkeit untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen: Nedjma, Kateb Yacine, Inszenierte Weiblichkeit, Kolonialisierung, Algerien, Frauenbilder, Literatur, Kunst, Tradition, Moderne, europäische Frau, algerische Frau, Symbolismus, Kultur, Gesellschaft, Geschichte, Constantine, Bône.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kateb Yacines Roman "Nedjma"?
Der Roman von 1956 thematisiert die Zeit vor dem algerischen Befreiungskrieg und nutzt komplexe Symbole und Mythen zur Darstellung der algerischen Identität.
Was symbolisiert die Figur Nedjma?
Nedjma wird oft als Symbol für Algerien selbst interpretiert – eine unerreichbare, begehrte und von verschiedenen Einflüssen geprägte Identität.
Wie wird Weiblichkeit im Roman inszeniert?
Die Arbeit analysiert Weiblichkeit als literarisches Konstrukt, das zwischen traditionellen muslimischen Rollen und europäischen Einflüssen oszilliert.
Welche Rolle spielen die Städte Constantine und Bône?
Diese Städte dienen im Roman als Schauplätze der Handlung und als Orte, an denen die kulturelle und geschlechtliche Identität der Figuren verhandelt wird.
Warum gilt der Roman als revolutionär?
Wegen seiner zyklischen Struktur, der verschlüsselten Sprache und der Abkehr von einer chronologischen Erzählweise, was ein Novum in der maghrebinischen Literatur darstellte.
- Citar trabajo
- Eugenia Steinbach (Autor), 2011, Inszenierte Weiblichkeit in Kateb Yacines Roman "Nedjma", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172518