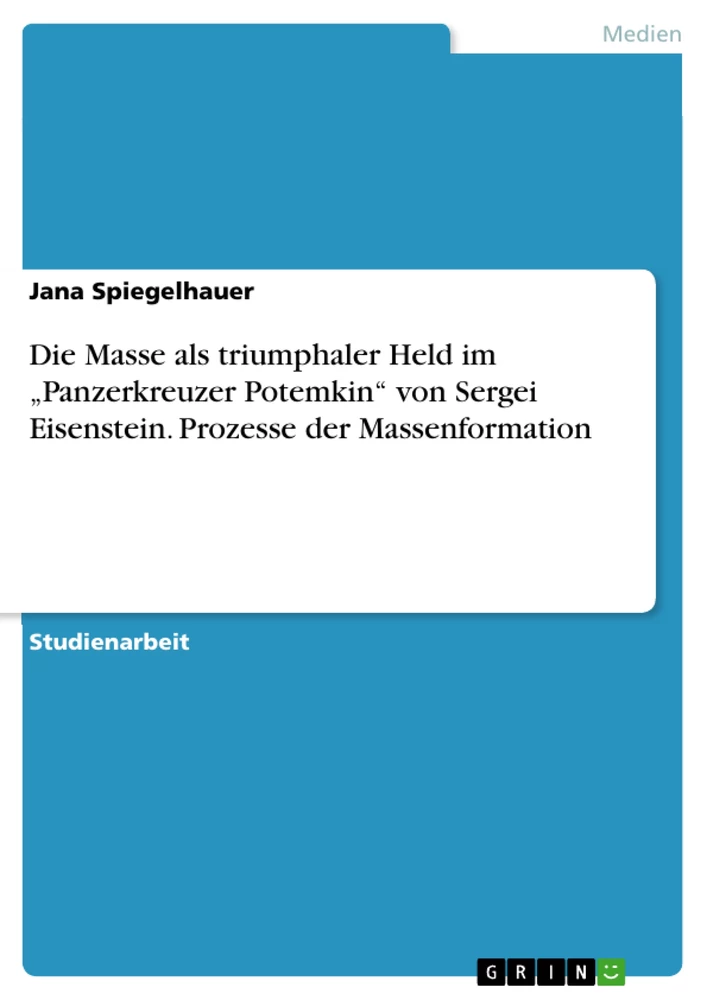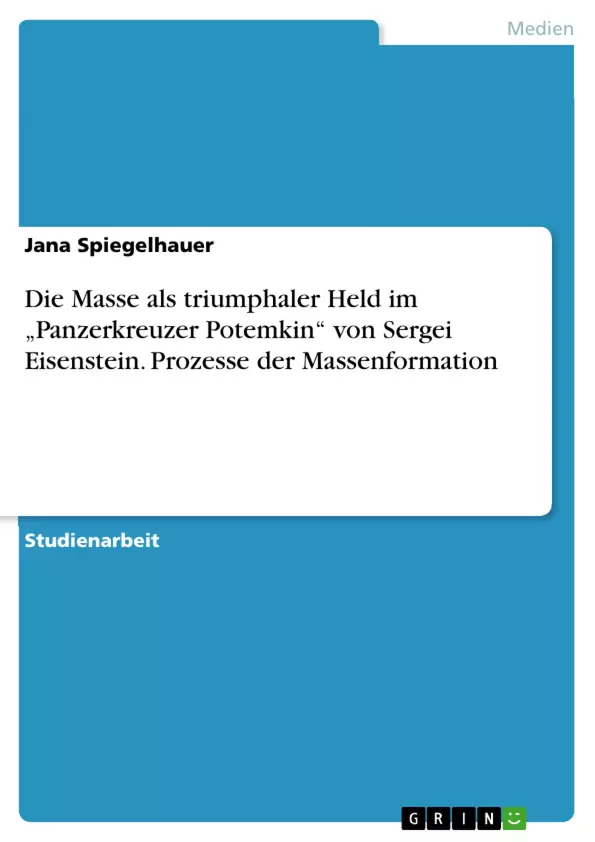„Der Geist des Aufruhrs schwebte über dem russischen Lande. Irgend ein [sic!] gewaltiger und geheimnisvoller Prozess vollzog sich in zahllosen Herzen; es lösten sich die Bande der Furcht, die Individualität, die eben erst sich selbst erkannt hatte, ging in der Masse und die Masse in dem großen Elan auf“.
Der sowjetische Filmregisseur und Filmtheoretiker Sergei Michailowitsch Eisenstein (1898- 1948) erhielt 1925 von der sowjetischen Regierung den Auftrag, zum 20-jährigen Andenken an die Ereignisse der revolutionären Aufstände am 14. 06. 1905 einen Film zu drehen. Dafür schreibt Nina Agadschanowa-Schutko unter Mitarbeit Eisensteins das Drehbuch für „Das Jahr 1905“. Leitmotiv dieses Drehbuches war „das dynamische Bild der Epoche, ihren Rhythmus und die innere Beziehung zwischen den verschiedenartigsten Ereignissen festzuhalten und zu verstehen“. Laut Eisenstein umfassten die Geschehnisse auf dem Panzerkreuzer Potemkin nur eineinhalb Seiten und erst nach und nach verwandelten sich die Zeilen des Drehbuchs in Szenen.
Aus diesem Grund ist es dem Regisseur und seinem Team möglich, „nach Herzenslust unsere persönlichen Absichten“ zu verwirklichen, aber auch Zufälliges und Unvorhergesehenes organisch in den Film einzubauen. Das Kriegsschiff „Knjas Potjomkin Tawritscheski", welches im Dienst der russischen Schwarzmeerflotte stand, sollte vor der Küste Odessas Zielübungen vollziehen. Doch die Besatzung forderte bessere Lebensbedingungen auf dem Potemkin wie auch Teile der Bevölkerung Russlands, die sich in Arbeiteraufständen organisiert hatten.
Durch den Russisch-Japanischen Krieg in den Jahren 1904/05 hatte Russland einen großen Teil seiner Flotte verloren und wurde niedergeschlagen. Es folgte eine Wirtschaftskrise, die es so vorher in Russland noch nie gegeben hatte. Als der Zar am 9. Januar 1905, dem sogenannten „Blutsonntag“, auf Demonstranten schießen lässt, wird das gesamte Land von einer großen Streikbewegung erfasst: „Der Blutsonntag von Petersburg wirkte wie ein Fanal“. Eisenstein behauptete, dass jemand nur zur Revolution finden kann, der sich auf dem Weg vom „ich“ zum „wir“ befindet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Das Jahr 1905 – Entstehung und Inhalt des Films „Panzerkreuzer Potemkin“
- 2. Massenformationen im Panzerkreuzer Potemkin
- 2.1. Analyse der fünf Akte nach den Prozessen der Massenformation
- 2.2. Szenenprotokoll aus dem vierten Akt „Die Treppe von Odessa”
- 2.3. Zur Massentheorie Gustav Le Bons von 1895
- 3. Massenformationen nach Le Bon, heute überhaupt noch möglich?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Seminararbeit untersucht die Darstellung der Masse im Film „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergei Eisenstein im Kontext der Revolutionären Bewegung von 1905. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, wie der Film die Prozesse der Massenformation und die Rolle der Masse im revolutionären Geschehen darstellt.
- Die Bedeutung der Masse im Kontext der russischen Revolution von 1905
- Analyse der Prozesse der Massenformation im Film „Panzerkreuzer Potemkin”
- Vergleich der im Film dargestellten Massen mit der Massentheorie von Gustav Le Bon
- Die ästhetische Gestaltung der Masse im Film und ihre politische Funktion
- Relevanz der Filmhandlung für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Im ersten Kapitel wird die Entstehung des Films „Panzerkreuzer Potemkin“ im historischen Kontext des Jahres 1905 und seine Bedeutung für die russische Revolution dargestellt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der fünf Akte des Films und ihrer Darstellung von Massenformationen. Dabei wird die Massentypologie von Elias Canetti herangezogen und die Rolle der Masse im revolutionären Prozess analysiert. Im dritten Kapitel wird die Massentheorie von Gustav Le Bon in den Kontext der Filmhandlung gestellt und die Frage nach der Relevanz von Massenformationen in der heutigen Zeit diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Massenformation, Revolution, Film, Panzerkreuzer Potemkin, Sergei Eisenstein, Gustav Le Bon, Elias Canetti, Arbeiterklasse, Offiziere, Propaganda, ästhetische Gestaltung, politisch-agitatorische Funktion.
- Quote paper
- Jana Spiegelhauer (Author), 2010, Die Masse als triumphaler Held im „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergei Eisenstein. Prozesse der Massenformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172642