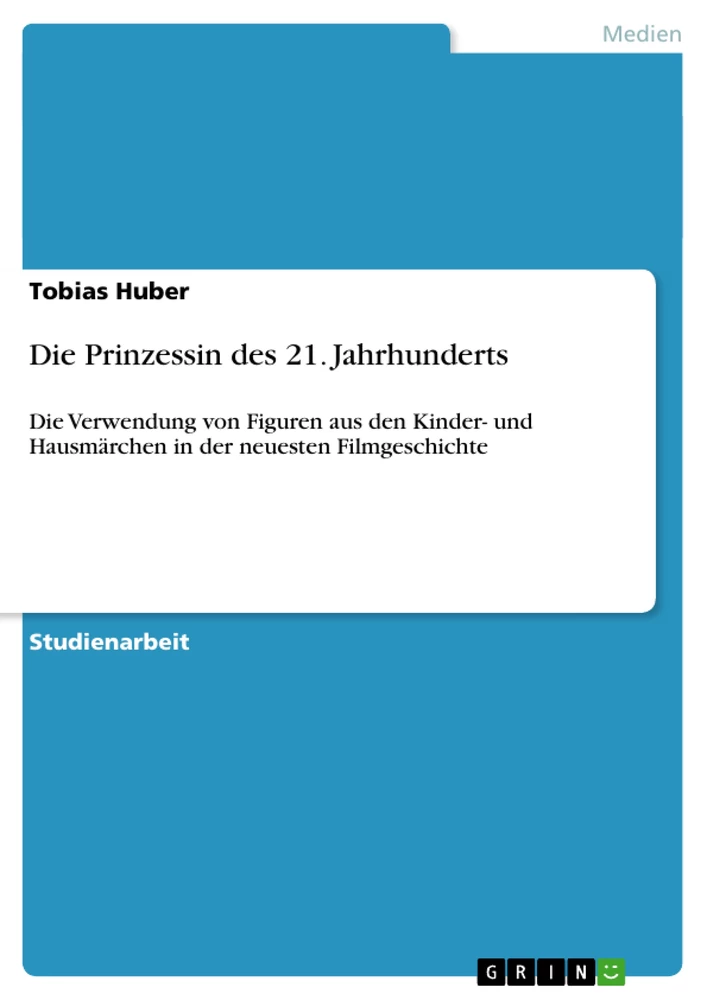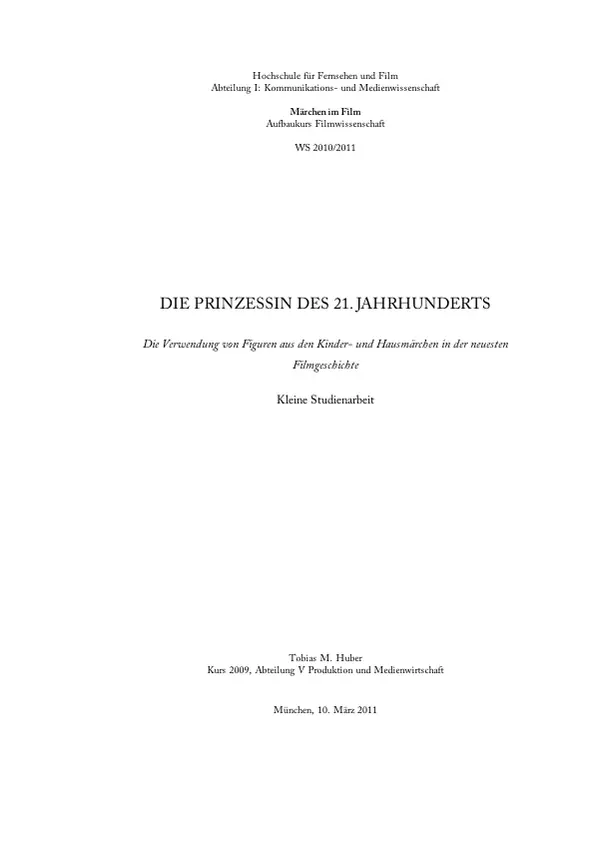Kaum ein Name wird in Deutschland so sehr mit Märchen assoziiert wie der der Brüder
Grimm. 3852 Treffer nennt allein das Online-Versandhaus Amazon auf eine
entsprechende Suchanfrage. Doch darunter befinden sich keineswegs nur diverse
Sammlungen der populären Kinder- und Hausmärchen, die seit ihrem Erscheinen im
19. Jahrhundert einen festen Platz in der Weltliteratur behaupten, sondern auch
zahlreiche Werke ihrer einflussreichen Arbeit im Bereich der Germanistik. Bis heute
kann man ihre Spuren in Literatur, Fernsehen und Film lesen. Gerade letztere haben im
20. Jahrhundert signifikant an Bedeutung gewonnen – aus einer Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach geht hervor, dass Kinder bereits 1976 ihr Märchenwissen primär
aus dem Fernsehen beziehen, was wiederum den Schluss provoziert, dass die Urversionen
vieler Märchen heute kaum noch bekannt sind. Dem entgegen steht, dass im Jahr 2003
83% der Bevölkerung der Meinung war, es wäre wichtig, seinen Kindern Märchen
vorzulesen.
In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, ob es traditionelle Märchenfiguren in der
neuesten Filmgeschichte gibt, die sich von ihrem Ursprung abgekoppelt und
verselbstständigt haben. Die Entscheidung, für diese Thesis die KHM und nicht etwa
die Hauffsche oder Perraultsche Sammlung heranzuziehen, begründet sich hauptsächlich
in deren Popularität. Zu Beginn wird kurz dargestellt, wie Max Lüthi das Märchen
definiert. Im Anschluss wird nach einem kurzen Überblick über die Grimmsche
Märchenwelt ausgeführt, welche Rolle ihre Figuren in Filmen der letzten zehn Jahre
spielen. Am Beispiel der Prinzessin folgt eine Darstellung, wie vier aktuelle Film-, bzw.
Fernsehbeispiele mit dieser Figur umgehen.
INHALT
1. Bedeutung des Grimmschen Schaffens
2. Einfluss der Kinder und Hausmärchen auf Film und Fernsehen
2.1. Das europäische Märchen: Eine kurze Definition nach Max Lüthi
2.2. Die Grimmschen Märchenfiguren: Ein Überblick
2.3. Verwendung von Märchenfiguren in aktuellen Filmen
3. Die Figur der Prinzessin in aktuellen Film- und Fernsehproduktionen
3.1. Die Prinzessin am Beispiel von Sechs auf einen Streich: Der Froschkönig
3.2. Die Prinzessin am Beispiel von Küss den Frosch
3.3. Die Prinzessin am Beispiel von Shrek - Der tollkühne Held
3.4. Die Prinzessin am Beispiel von Verwünscht
4. Die Emanzipation der Prinzessinnen-Figur
5. Quellenverzeichnis
5.1. Bibliographie
5.2. Filmographie
5.3. Internetquellen
6. Anhang
1. Bedeutung des Grimmschen Schaffens
Kaum ein Name wird in Deutschland so sehr mit Märchen assoziiert wie der der Brüder Grimm. 3852 Treffer nennt allein das Online-Versandhaus Amazon auf eine entsprechende Suchanfrage1. Doch darunter befinden sich keineswegs nur diverse Sammlungen der populären Kinder- und Hausmärchen2, die seit ihrem Erscheinen im 19. Jahrhundert einen festen Platz in der Weltliteratur behaupten, sondern auch zahlreiche Werke ihrer einflussreichen Arbeit im Bereich der Germanistik. Bis heute kann man ihre Spuren in Literatur, Fernsehen und Film lesen. Gerade letztere haben im 20. Jahrhundert signifikant an Bedeutung gewonnen - aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach geht hervor, dass Kinder bereits 1976 ihr Märchenwissen primär aus dem Fernsehen beziehen3, was wiederum den Schluss provoziert, dass die Urversionen vieler Märchen heute kaum noch bekannt sind. Dem entgegen steht, dass im Jahr 2003 83% der Bevölkerung der Meinung war, es wäre wichtig, seinen Kindern Märchen vorzulesen4.
In dieser Arbeit wird die Frage behandelt, ob es traditionelle Märchenfiguren in der neuesten Filmgeschichte gibt, die sich von ihrem Ursprung abgekoppelt und verselbstständigt haben. Die Entscheidung, für diese Thesis die KHM5 und nicht etwa die Hauffsche oder Perraultsche Sammlung heranzuziehen, begründet sich hauptsächlich in deren Popularität6. Zu Beginn wird kurz dargestellt, wie Max Lüthi das Märchen definiert. Im Anschluss wird nach einem kurzen Überblick über die Grimmsche Märchenwelt ausgeführt, welche Rolle ihre Figuren in Filmen der letzten zehn Jahre spielen. Am Beispiel der Prinzessin folgt eine Darstellung, wie vier aktuelle Film-, bzw. Fernsehbeispiele mit dieser Figur umgehen.
2. Einfluss der Kinder- und Hausmärchen auf Film und Fernsehen
2.1. Das europäische Märchen: Eine kurze Definition nach Max Lüthi
Nach Max Lüthi zeichnet sich das Märchen besonders in Europa durch eine ausgeprägte Handlungsfreude aus7, d.h. das Märchen hält sich nicht lange mit der Beschreibung des Innenlebens seiner Figuren oder deren Umwelt auf, sondern lässt die Handlung der Geschichte zügig verlaufen. Letztere wird häufig nicht durch die Gefühle der agierenden Personen, sondern durch äußere Umstände determiniert. So muss sich der Protagonist mit ungewöhnlichen Situationen auseinandersetzen und sie bewältigen. Dies geschieht meist in episodischen Abschnitten mit Hilfe von formelhaften Handlungen, die ihrerseits auf spezifische Eigenschaften des jeweiligen Charakters schließen lassen. Dabei herrscht anstelle des in vielen Erzählformen verbreiteten „Ineinander und Miteinander“ das „Nebeneinander und Nacheinander“8 von Aktionen und Reaktionen, was zu einer Flächenhaftigkeit führt, die Lüthi mit dem Begriff „Eindimensionalität“ beschreibt und als typisches Merkmal des Märchens definiert.9
Die Integration übernatürlicher Dinge in die Handlung teilt das Märchen mit einer Reihe benachbarter Gattungen, wie der Sage oder der Fabel. Das wichtigste Abgrenzungskriterium ist hierbei nach Lüthi die „Selbstverständlichkeit, mit der der Märchenerzähler das Ungewöhnliche, Wunderbare berichtet und die Märchenfigur ihm begegnet“10. Es handelt sich keineswegs um Geschichten mit Wahrheitsanspruch und, wie Wilhelm Grimm selbst meint, auch nicht ursprünglich um „Lehrstücke für die Gegenwart“.11 Dennoch wurden Märchen bis in die heutige Zeit oft als solche interpretiert, wodurch sich das überraschend positive Ergebnis der Umfrage, ob es wichtig wäre, seinen Kindern Märchen vorzulesen, erklären lässt.12
Letztlich ist eine exakte Definition und Abgrenzung des Märchens gegenüber anderen Gattungen wissenschaftlich umstritten. Dennoch sollen Lüthis Erkenntnisse als Grundlage für die folgende Arbeit fungieren.
2.2. Die Grimmschen Märchenfiguren: Ein Überblick
Um eine fundierte Betrachtung einer einzelnen Figur durchzuführen, ist zunächst ein Überblick über die Welt der KHM notwendig. Für die Entwicklung einer Bedeutungshierarchie wurde eine quantitative Analyse durchgeführt, deren Ergebnis in Tabelle A dargestellt ist. Zu beachten ist dabei, dass Dopplungen auftreten können13, verschiedene Figuren synonym gebraucht werden14 und bestimmte Figuren, mangels geschlechterspezifischer Eigenschaften, als identisch klassifiziert wurden15. Darüber hinaus wurden nur solche Figuren gezählt, die die Erzählung aktiv beeinflussen16.
A (Auszug): QUANTITATIVE ANALYSE DER KHM 1 - 21017
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Leicht erkennbar ist, dass die Welt der Märchen eine überschaubare Anzahl an Menschen beinhaltet, die ausnahmslos greifbare, gut darstellbare Arbeiten verrichten. „Könige und Königskinder, treue Diener und ehrliche Handwerker, [...] Fischer, Müller, Köhler und Hirten, die der Natur am nächsten bleiben, erscheinen darin.“18 Berufe wie Notar oder Verwaltungsangestellter tauchen genauso wenig auf, wie komplexe Charaktere, die einen moralischen Konflikt beim Leser provozieren könnten. Nicht näher charakterisierte, namenlose Mädchen (B 3.) und Jungen (B 10.) sowie deren Mütter (B 5.) bzw. Väter (B 6.) spielen hingegen eine signifikante Rolle. Sie bieten Identifikationspotential für jede Leserin und jeden Leser und zugleich Spielraum für eine große Bandbreite an Situationen, in die sie geraten können. Dabei treffen diese Figuren oft kindliche bzw.
menschliche, also situationsbedingt nachvollziehbare Entscheidungen, während die Hexe (B 9.) oder der Wolf beinahe ausschließlich durch ihre negative Intentionen geleitet werden. Bauer (B 7.), Jäger (B 12.), Soldat (B 13.) und Schneider (B 15.) erhalten durch ihre jeweiligen Berufe eine zusätzliche Ebene, die ihre Fähigkeiten und Handlungsspielräume erweitert. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist die mondäne Popularität einzelner Figuren jedoch nicht unbedingt deckungsgleich mit der Häufigkeit ihres Auftretens.
B: HITPARADE DER MÄRCHEN 200319
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Der hohe Bekanntheitsgrad des Rotkäppchen- bzw. Sieben Geißlein-Märchens legt z.B. den Schluss nahe, dass die darin auftauchende Figur des Wolfs charakteristisch für die Grimmschen Märchen ist. Tatsächlich kommt dieser aber nur in neun der 210 KHM (abs. 4,3%) vor. Der Fuchs (B 11.) hingegen, der in immerhin 15 Geschichten (abs. 7,1%) eine Rolle spielt, ist in der Hitparade gar nicht vertreten. Der Diener (B 14.) ist niemals Protagonist eines Märchens, sondern tritt immer in Verbindung mit einem Mitglied einer Monarchenfamilie auf. Selten auftauchende aber dennoch populäre Figuren sind z.B. der Zwerg (in fünf Geschichten), der Drache (in drei Geschichten) oder das Einhorn, das nur in einer einzigen Geschichte vorkommt. Einzig die Mitglieder idealisierter Herrscherhäuser sind omnipräsent. Insbesondere König (B 1.) und Prinzessin (B 2.) tauchen in etwa jeder vierten Erzählung auf und sind mit Schneewittchen (C 1.), Aschenputtel (C 4.) und Dornröschen (C 5.) auch in den oberen Rängen der Hitparade vertreten. Sie können daher als charakteristisch für die Grimmsche Märchenwelt bezeichnet werden.
Letztlich werden zwei Kriterien, für die Relevanz einer Grimmschen Märchenfigur herangezogen: Die Bekanntheit der Geschichte, in der sie vorkommt und die Häufigkeit ihres Vorkommens in der Märchensammlung. Insbesondere die Figuren König, Prinz und Prinzessin erfüllen diese Voraussetzung. Letztere soll in dieser Thesis als Untersuchungsobjekt dienen.
2.3 Verwendung von Märchenfiguren in aktuellen Filmen
Unterzieht man das westliche Film- und Fernsehspektrum der letzten zehn Jahre einer näheren Betrachtung, so fällt auf, dass die Figuren aus der Grimmschen Märchensammlung erstaunlich präsent sind - wenn auch meist nur noch lose mit ihrem ursprünglichen Kontext verknüpft oder absichtlich verfremdet.
[...]
1 http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%D1&url=searchalias%?__mk_de_DE%C3%91 &url=searchalias%3Dstripbooks&fieldkeywords=br%der+grimm&rh=n%36%2Ck%3Abr%der+grimm, Zugriff mit dem Suchwort „Brüder Grimm“ am 28.02.2011.
2 Erstausgabe 1812/15, Ausgabe letzter Hand 1857.
3 Schmitt, Adaptionen klassischer Märchen im Kinder- und Familienfernsehen, S. 8.
4 Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 3620, April/Mai 2003.
5 KHM steht für Kinder- und Hausmärchen. Im weiteren Verlauf der Thesis wird lediglich diese Abkürzung verwendet.
6 Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 7042, April/Mai 2003.
7 Vgl. Lüthi, Märchen, S. 29.
8 Vgl. ebd. S. 30.
9 Vgl. ebd. S. 17.
10 Ebd. S. 7.
11 Vgl. W. Grimm, Deutsche Volksmärchen, S.10.
12 Vgl. Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 3620 und 7042.
13 Bei „Brüdern“ (8.) kann es sich beispielsweise auch um „Prinzen“ (4.) handeln.
14 „Jude“ und „Kaufmann“ beispielsweise sind in beinahe allen Fällen identisch.
15 Beispielsweise „Koch“ und „Köchin“.
16 Der „Fisch“ kommt beispielsweise sowohl aktiv als auch passiv vor.
17 Eine vollständige Auflistung Aller Figuren mit n>2 findet sich im Anhang S. 24f.
18 W. Grimm, Deutsche Volksmärchen, S.9.
19 Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 7042, April/Mai 2003.
20 KHM 53.
21 KHM 15.
22 KHM 26.
23 KHM 21.
24 KHM 50.
25 KHM 24.
26 KHM 5.
27 KHM 55.
28 KHM 83.
29 KHM 33a.
30 KHM 161.
31 KHM 1.
32 KHM 27.
33 KHM 20.
34 KHM 153.
35 The Princess and the Frog, John Musker, Ron Clements, USA 2004.
36 KHM 1.
37 Tangled, Nathan Greno, Byron Howard, USA 2010.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit behandelt die Frage, ob es traditionelle Märchenfiguren in der neuesten Filmgeschichte gibt, die sich von ihrem Ursprung abgekoppelt und verselbstständigt haben. Der Fokus liegt auf den Kinder- und Hausmärchen (KHM) der Brüder Grimm.
Warum wurden die Grimmschen Märchen und nicht andere Märchensammlungen ausgewählt?
Die Entscheidung für die KHM begründet sich hauptsächlich in ihrer Popularität.
Wie definiert Max Lüthi das europäische Märchen?
Nach Max Lüthi zeichnet sich das Märchen in Europa besonders durch eine ausgeprägte Handlungsfreude aus. Es hält sich nicht lange mit der Beschreibung des Innenlebens seiner Figuren oder deren Umwelt auf, sondern lässt die Handlung der Geschichte zügig verlaufen.
Welche Rolle spielen übernatürliche Elemente im Märchen nach Lüthi?
Die Integration übernatürlicher Dinge in die Handlung teilt das Märchen mit anderen Gattungen. Das wichtigste Abgrenzungskriterium ist die Selbstverständlichkeit, mit der der Märchenerzähler das Ungewöhnliche, Wunderbare berichtet und die Märchenfigur ihm begegnet.
Welche Märchenfiguren sind in den Grimmschen Märchen besonders präsent?
Eine quantitative Analyse zeigt, dass "Könige und Königskinder, treue Diener und ehrliche Handwerker, [...] Fischer, Müller, Köhler und Hirten" häufig vorkommen. Insbesondere König und Prinzessin tauchen in etwa jeder vierten Erzählung auf.
Welche Kriterien werden für die Relevanz einer Grimmschen Märchenfigur herangezogen?
Die Bekanntheit der Geschichte, in der die Figur vorkommt, und die Häufigkeit ihres Vorkommens in der Märchensammlung.
Welche Figur wird in dieser Thesis als Untersuchungsobjekt dienen?
Die Prinzessin.
Wie werden Märchenfiguren in aktuellen Filmen verwendet?
Die Figuren aus der Grimmschen Märchensammlung sind im westlichen Film- und Fernsehspektrum der letzten zehn Jahre erstaunlich präsent, wenn auch meist nur noch lose mit ihrem ursprünglichen Kontext verknüpft oder absichtlich verfremdet.
- Quote paper
- Tobias Huber (Author), 2011, Die Prinzessin des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172679