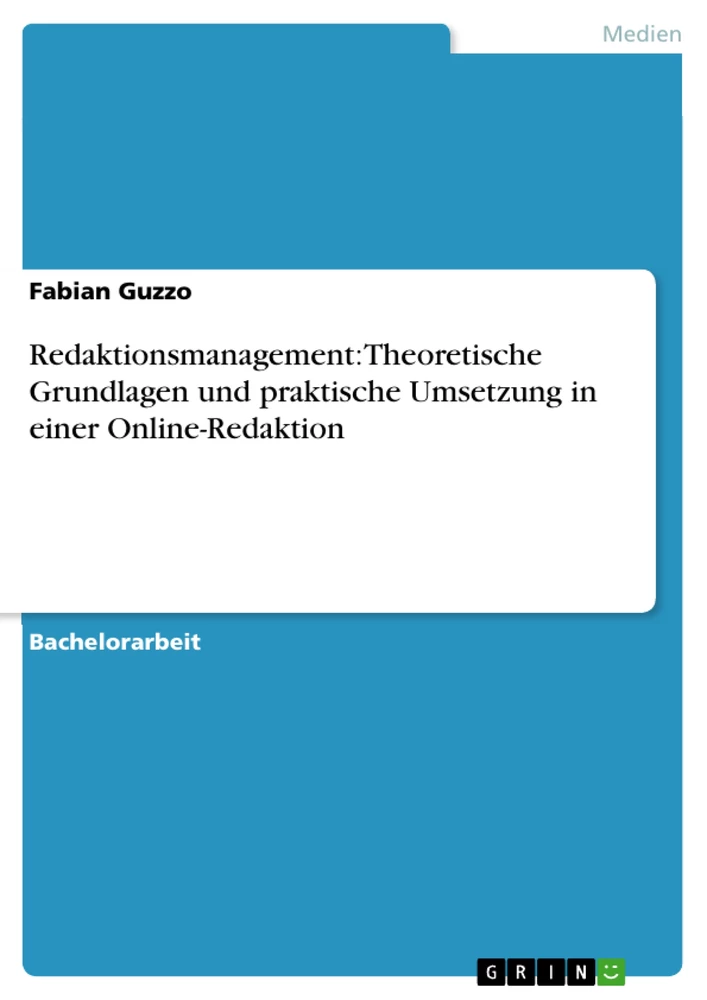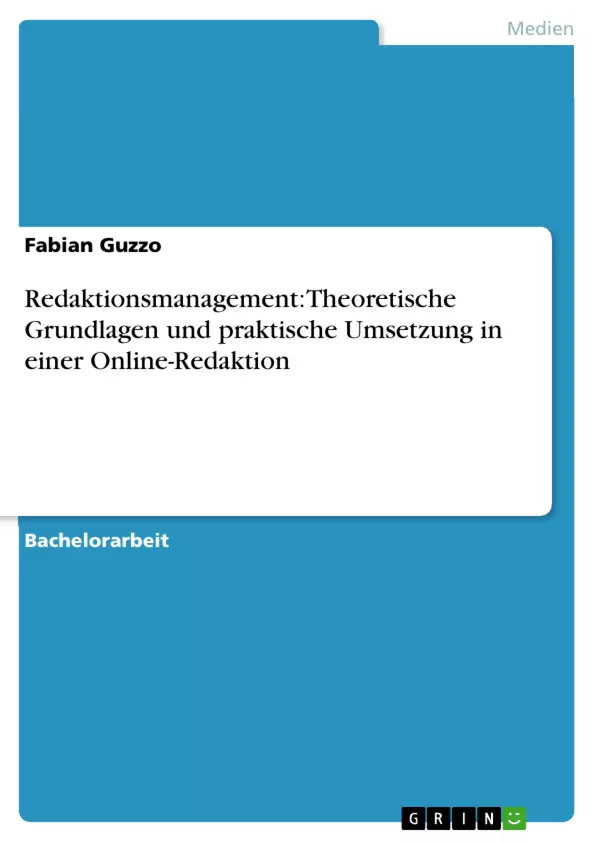„Umbruch der Medienwelt“, „Wozu noch Journalismus?“, „DuMont fordert Staatshilfen“, die Überschriften dieser Artikel zeigen einen eindeutigen Trend: Die Medien befinden sich in einer Krise.
Im ersten Quartal des Jahres 2010 wurden fast 640.000 Tageszeitungsexemplare weniger verkauft als im gleichen Quartal des vorigen Jahres. Das entspricht einem Rückgang von circa 2,7 Prozent. Zum Beispiel verzeichnet die Bild-Zeitung in den letzten beiden Jahren einen Absatzrückgang von fast 300.000 Exemplaren, was einem relativen Wert von zehn Prozent entspricht. Die ausgewiesene Qualitätszeitung Süddeutsche Zeitung verkauft heute 10.000 Exemplare weniger als vor zwei Jahren, was ungefähr einem Rückgang von zwei Prozent entspricht. Die Werbeumsätze der Tageszeitungen sind im Vergleich zum letzten Jahr um 13 Prozent gesunken und im Online-Bereich um circa fünf Prozent gefallen. Außerdem setzt sich der Trend fort, dass Tageszeitungen zunehmend Leser an Online-Medien verlieren, weil sie aktueller und kostenfrei sind.
GÖTZ HAMANN fasst die Lage treffend zusammen: „Die alte Welt ist aus den Fugen. Süddeutsche Zeitung und Financial Times Deutschland, Zeitschriften wie Stern und Capital – überall wird gespart, gekürzt, gekündigt.“ Die Medienkrise ist nicht bloß eine Folge der Finanzkrise, sondern eben diese hat die Notlage nur vorgezogen. Seit langem ist den Verlagen bewusst, dass sich die Medienlandschaft im Umbruch befindet, aber da die Krise nicht allgegenwärtig war, haben sie sich nicht mit ihr befasst.
Der Grund für die Medienkrise ist das wachsende Desinteresse der Gesellschaft für öffentliche Angelegenheiten. Außerdem wachsen junge Rezipienten mit dem Internet als kostenfreiem Informationsmedium auf, was zu einem fehlenden Interesse an der Tageszeitung führt. Im Online-Sektor nutzen User zunehmend Werbeblock-Software, was sogar das Internet zu einer unattraktiven Werbeplattform werden lässt.
Die Konsequenzen der Medienkrise sind der Verlust der publizistischen Vielfalt, vor allem im regionalen Bereich sowie der Qualitätsverlust der medialen Inhalte, was für sämtliche Medienkanäle gilt.
Ein grundsätzliches Konzept gegen die Medienkrise existiert nicht, aber die Grundlage für Erfolg im Online- und Tageszeitungsbereich ist ein professionelles und umfassendes Redaktionsmanagement. Doch obwohl den großen deutschen Verlagen dieser Umstand bewusst ist, wird dem Redaktionsmanagement nicht die nötige Relevanz zugeordnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema.
- Besonderer Bedarf des Redaktionsmanagements in der Medienkrise
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen Redaktionsmanagement
- Definition relevanter Begriffe
- Redaktion
- Management
- Redaktionsmanagement
- Aufgaben des Redaktionsmanagements
- Komponenten des Redaktionsmanagements
- Qualitätsmanagement
- Grundlagen des Qualitätsmanagements
- Prinzip des Total Quality Management (TQM) als optimale Lösung
- Praktische Anwendung des Total Quality Management in der Redaktion
- Kostenmanagement
- Problematik des Kostenmanagement
- Redaktionsmanager als Ideallösung
- Praktische Möglichkeiten der Kostensenkung in der Redaktion
- Personalmanagement
- Ziele des Personalmanagements
- Personalplanung als Grundlage für effizientes Personalmanagement
- Mitarbeiterführung und Pflege
- Redaktionsorganisation
- Funktion der Redaktionsorganisationsstruktur
- Traditionelle Organisationkonzepte
- Newsdesk als optimale Lösung?
- Redaktionelles Marketing
- Eingrenzung und Funktion des redaktionellen Marketings
- Methoden der Zielgruppenanalyse
- Redaktionelle Strategien des Beziehungsmarketings
- Praktische Betrachtung des Redaktionsmanagements beim Online-Kinomagazin moviepilot und Empfehlungen zur Verbesserung
- Daten und Fakten zu moviepilot
- Qualitätsmanagement – Fehlendes Redaktionsprofil
- Effizientes Kostenmanagement
- Personalmanagement mit Stärken und Schwächen
- Das gelungene Newsdesk-Prinzip
- Redaktionelles Marketing – Vorbildliche Nutzerorientierung
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Redaktionsmanagements
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Redaktionsmanagements als Grundlage für den erfolgreichen Betrieb einer Redaktion. Der Fokus liegt dabei auf der Übertragung theoretischer Grundlagen aus dem Print-Bereich auf die spezifischen Gegebenheiten einer Online-Redaktion.
- Definition und Funktion des Redaktionsmanagements
- Disziplinen des Redaktionsmanagements (z.B. Qualitätsmanagement, Kostenmanagement, Personalmanagement, Redaktionsorganisation, Redaktionelles Marketing)
- Praktische Umsetzung der theoretischen Modelle am Beispiel eines Online-Kinomagazins
- Verbesserungsvorschläge für das redaktionelle Management des Online-Kinomagazins
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Redaktionsmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den besonderen Bedarf des Redaktionsmanagements in der Medienkrise. Es werden die Herausforderungen für die Medienbranche im digitalen Zeitalter und die Auswirkungen auf den Journalismus dargestellt.
Kapitel 2 definiert den Begriff des Redaktionsmanagements und erläutert seine Funktionen. Es werden die einzelnen Disziplinen des Redaktionsmanagements vorgestellt, wie z.B. Qualitätsmanagement, Kostenmanagement und Personalmanagement.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Qualitätsmanagement und präsentiert das Prinzip des Total Quality Management (TQM) als optimale Lösung für Redaktionen. Es wird auf die praktische Anwendung des TQM in der Redaktion eingegangen.
Kapitel 4 behandelt das Kostenmanagement. Die Problematik des Kostenmanagements in Redaktionen wird erörtert und der Redaktionsmanager als Ideallösung vorgestellt. Es werden praktische Möglichkeiten der Kostensenkung in der Redaktion vorgestellt.
Kapitel 5 befasst sich mit dem Personalmanagement. Die Ziele des Personalmanagements werden erläutert, sowie die Rolle der Personalplanung als Grundlage für effizientes Personalmanagement. Darüber hinaus wird die Mitarbeiterführung und -pflege behandelt.
Kapitel 6 behandelt die Redaktionsorganisation. Es wird die Funktion der Redaktionsorganisationsstruktur erklärt und traditionelle Organisationkonzepte werden vorgestellt. Abschließend wird die Frage gestellt, ob der Newsdesk eine optimale Lösung für Redaktionen darstellt.
Kapitel 7 widmet sich dem redaktionellen Marketing. Es werden die Funktion und die Eingrenzung des redaktionellen Marketings erläutert. Außerdem werden Methoden der Zielgruppenanalyse und redaktionelle Strategien des Beziehungsmarketings vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Redaktionsmanagement, Medienkrise, Qualitätsmanagement, Kostenmanagement, Personalmanagement, Redaktionsorganisation, Redaktionelles Marketing, Online-Medien, Print-Medien, Journalismus, Total Quality Management (TQM), Newsdesk, Zielgruppenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist professionelles Redaktionsmanagement heute so wichtig?
Angesichts sinkender Auflagen und Werbeumsätze (Medienkrise) hilft ein effizientes Management, Qualität zu sichern und Kosten in Redaktionen zu optimieren.
Was ist das Newsdesk-Prinzip?
Ein Newsdesk ist eine zentrale Steuerungseinheit in einer Redaktion, die Themen bündelt und die Inhalte effizient über verschiedene Kanäle (Print, Online, Social Media) verteilt.
Was bedeutet Total Quality Management (TQM) in einer Redaktion?
TQM ist ein umfassender Ansatz zur Qualitätssicherung, der alle Mitarbeiter einbezieht, um die publizistische Qualität und die Nutzerzufriedenheit kontinuierlich zu verbessern.
Wie unterscheidet sich das Online- vom Print-Redaktionsmanagement?
Online-Redaktionen erfordern eine höhere Aktualität, eine stärkere Nutzerinteraktion (Beziehungsmarketing) und den Umgang mit anderen Kostenstrukturen und Werbeformaten.
Welche Rolle spielt das Personalmanagement?
Es umfasst die strategische Personalplanung, die Mitarbeiterführung und die gezielte Weiterentwicklung von Journalisten, um in einem schwierigen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Citation du texte
- Fabian Guzzo (Auteur), 2010, Redaktionsmanagement: Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung in einer Online-Redaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172680