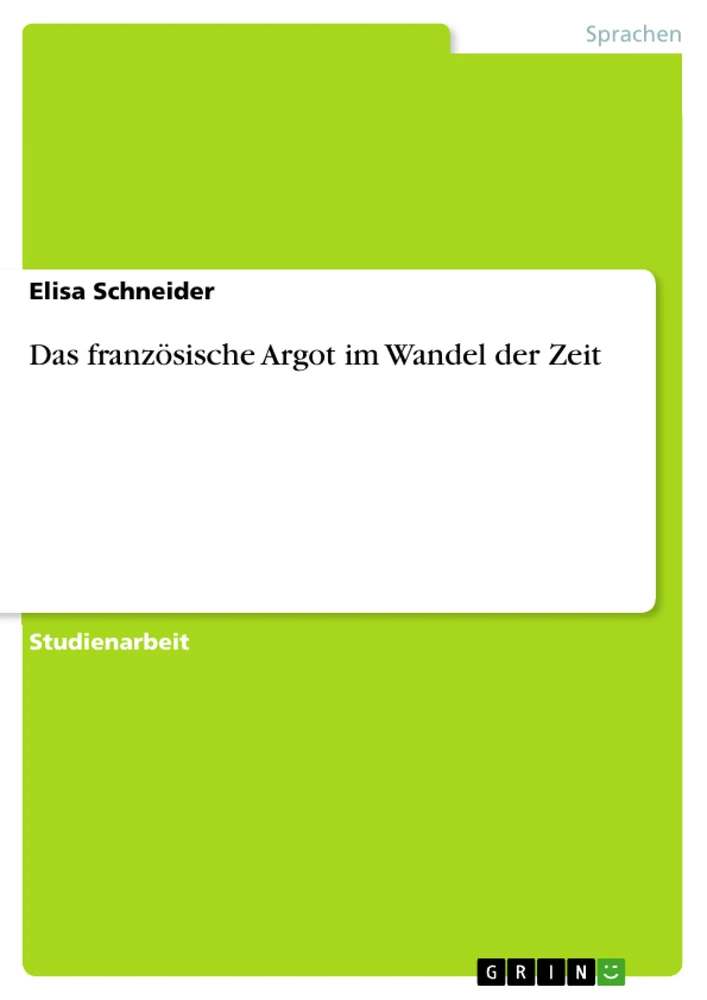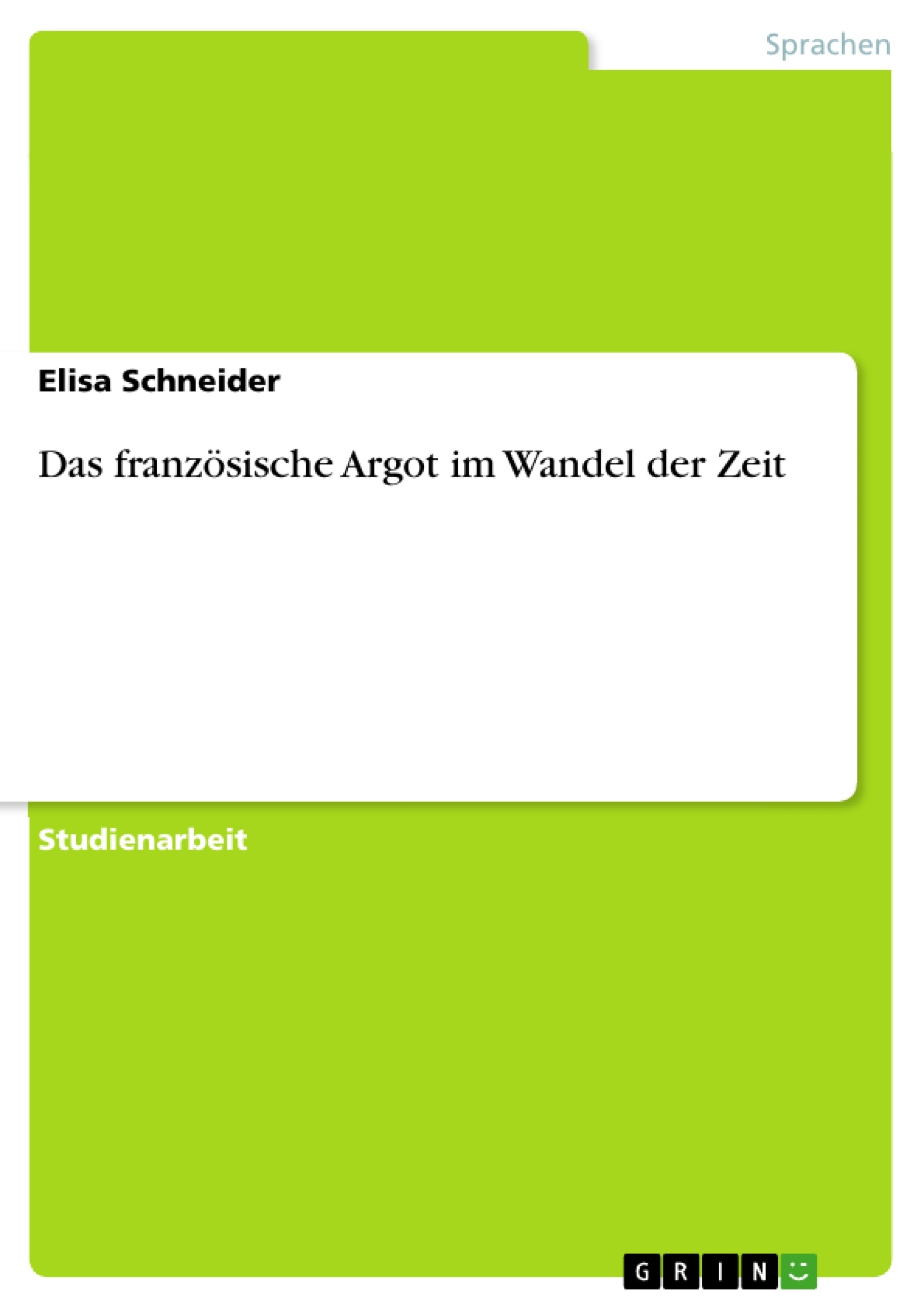«Une langue vivante est toujours en mouvement.»1
«D’ailleurs, pourquoi le cacher, l’argot n’existe plus guère de nos jours, du moins si l’on s’en tient à une définition pure et dure du phénomène: langage secret des truands et du milieu.»2
Diese beiden auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Aussagen über das linguistische Phänomen Argot möchte ich zum Ausgangspunkt meiner folgenden Untersuchungen nehmen. Argot - une langue vivante oder une langue morte?
Das Argot entstand in Frankreich vor rund 600 – 700 Jahren aus dem Bedürfnis einiger sozialer Schichten – genau genommen der Gauner und kriminellen Banden – sich abzugrenzen, mit einer geheimen und speziellen Sprache, die nur von den Eingeweihten verstanden werden konnte. Caradec beschreibt dies folgendermaßen : «, Idiome artificiel’, dont les mots sont crées pour n’être pas compris par les non-initiés».3
Im Laufe der Jahrhunderte unterlag dieses Phänomen einem grundlegenden Wandel, wie aus dem zweiten oben genannten Zitat hervorgeht. Doch was ist aus dem ursprünglichen Argot geworden? Existiert das Argot noch, gibt es noch Sprecher? Wenn ja, welche Funktionen erfüllt es heute? Ist es noch eine lebendige Sprache und unterliegt es somit auch noch bestimmten Wandlungsprozessen?
Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich auf diese Fragen Antworten finden. Zu diesem Zweck habe ich mir vor allem die Vorwörter verschiedener Argot-Wörterbücher, zu den unterschiedlichsten Zeiten veröffentlicht, zum Maßstab genommen. Sehr interessant und aufschlussreich sind außerdem Vergleiche zwischen Inhalten mehrerer unterschiedlich alter – bzw. neuer - Wörterbücher; sie zeigen die Entwicklung des Argots an praktischen Beispielen.
Wegweisend in der Argot-Forschung sind auch die Werke Francois Caradecs4 und Louis-Jean Calvets5 , ersteres vor allem die neuesten Entwicklungen des Argots betreffend.
Um einen Überblick über die Entwicklung des Argots von seiner Entstehung bis heute zu gewinnen, möchte ich - unter Einbeziehung der genannten Werke - nach einer kurzen Erläuterung des Argots als linguistisches Phänomen zuerst die Geschichte des Argots ab dem 15. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert zusammenfassen. Über einen Exkurs in die Literatur dieser Zeitspanne, um das Argot an ganz praktischen Beispielen aufzuzeigen, komme ich schließlich zu den neueren und neuesten Entwicklungen und den heutigen Funktionen des Argots, «des usages sociaux qui lui ont donné naissance et qui prolongent sa vie […]».6
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung des Begriffes Argot; Allgemeine Informationen
- Die Entwicklung des Argots vom 14. bis zum 21. Jahrhundert
- Zusammenfassung der Entwicklung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert
- Exkurs in die Literatur (15. und 19. Jahrhundert)
- Die Entwicklung des Argots ab dem 20. Jahrhundert – Das Argot im Wandel
- Die Funktionen des argot commun
- Zusammenfassung der Entwicklung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert
- Zusammenfassung – Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des französischen Argots von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Ziel ist es, die Veränderungen des Argots im Laufe der Zeit zu beleuchten und seine heutigen Funktionen zu analysieren. Dabei werden verschiedene Argot-Wörterbücher herangezogen und die Entwicklung an praktischen Beispielen aufgezeigt.
- Definition und historische Entwicklung des Argots
- Der Argot als Geheimsprache krimineller Banden
- Wandel des Argots und seine Adaption durch verschiedene soziale Gruppen
- Sprachliche Mechanismen der Argot-Bildung
- Funktionen des Argots in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die scheinbar widersprüchliche These auf, dass Argot sowohl eine lebendige als auch eine sterbende Sprache sein kann. Sie benennt die Forschungsfrage nach der Existenz, den Funktionen und den Wandlungsprozessen des Argots in der Gegenwart und skizziert die Methodik der Arbeit, die auf der Analyse von Vorworten verschiedener Argot-Wörterbücher und dem Vergleich ihrer Inhalte beruht. Die Werke von François Caradec und Louis-Jean Calvet werden als wegweisend in der Argot-Forschung genannt.
Erläuterung des Begriffes Argot; Allgemeine Informationen: Dieses Kapitel beleuchtet die semantische Entwicklung des Begriffs „Argot“ von seinen frühen Bedeutungen im 15. Jahrhundert (jargon, jobelin) bis zu seiner heutigen Verwendung als Bezeichnung für eine spezielle Sprache von Randgruppen. Es werden verschiedene Bezeichnungen wie „langue verte“ erläutert und die sprachlichen Verfahren der Argot-Bildung (Largonji, Loucherbème, Verlan, Javanais) detailliert beschrieben und an Beispielen verdeutlicht. Die Entwicklung des Wortes „job“ wird anhand von Zitaten aus verschiedenen Wörterbüchern unterschiedlicher Jahrgänge nachvollzogen.
Die Entwicklung des Argots vom 14. bis zum 21. Jahrhundert: Dieser Abschnitt behandelt die Entwicklung des Argots über mehrere Jahrhunderte. Die Zusammenfassung der Entwicklung vom 14. bis 19. Jahrhundert beginnt mit dem Nachweis des Argots bereits im 14. Jahrhundert und der Erwähnung von Wörtern wie „mouche“, die sich bis heute erhalten haben. Das Kapitel bezieht die Coquillards, eine Gaunerbande des 15. Jahrhunderts, mit ein und analysiert ein Gerichtsprotokoll von 1455 als wichtiges Dokument für die Argot-Forschung. Die Verwendung argotischer Wörter in den Gedichten von François Villon wird als Beweis für dessen mögliche Verbindung zu den Coquillards interpretiert. Es wird die Entwicklung des Argots von einer Geheimsprache krimineller Gruppen hin zu einer Sprache verschiedener sozialer Gruppen aufgezeigt. Der Exkurs in die Literatur dieser Zeit dient dazu, die Verwendung von Argot in der Literatur zu belegen und zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Argot, französisch, Sprachwandel, Soziolinguistik, Geheimsprache, kriminelle Banden, Wortbildung, langue verte, jargon, jobelin, Verlan, Coquillards, François Villon, französische Literatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des französischen Argots
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des französischen Argots von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Sie beleuchtet die Veränderungen des Argots im Laufe der Zeit und analysiert seine heutigen Funktionen.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Vorworten verschiedener Argot-Wörterbücher und dem Vergleich ihrer Inhalte. Die Werke von François Caradec und Louis-Jean Calvet werden als wegweisend in der Argot-Forschung genannt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Erläuterung des Begriffs "Argot", ein Kapitel zur Entwicklung des Argots vom 14. bis zum 21. Jahrhundert und eine Zusammenfassung/Fazit. Das Kapitel zur Entwicklung des Argots beinhaltet einen Exkurs in die Literatur des 15. und 19. Jahrhunderts.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Definition und historische Entwicklung des Argots, der Argot als Geheimsprache krimineller Banden, der Wandel des Argots und seine Adaption durch verschiedene soziale Gruppen, die sprachlichen Mechanismen der Argot-Bildung und die Funktionen des Argots in der Gegenwart.
Wie wird der Begriff "Argot" definiert?
Die Arbeit beleuchtet die semantische Entwicklung des Begriffs "Argot" von seinen frühen Bedeutungen im 15. Jahrhundert (jargon, jobelin) bis zu seiner heutigen Verwendung als Bezeichnung für eine spezielle Sprache von Randgruppen. Verschiedene Bezeichnungen wie „langue verte“ werden erläutert.
Welche sprachlichen Verfahren der Argot-Bildung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert und anhand von Beispielen sprachliche Verfahren der Argot-Bildung wie Largonji, Loucherbème, Verlan und Javanais.
Welche historischen Entwicklungsphasen des Argots werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Argots vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Entwicklung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert wird zusammengefasst, wobei die Coquillards (Gaunerbande des 15. Jahrhunderts) und ein Gerichtsprotokoll von 1455 als wichtige Quellen erwähnt werden. Die Verwendung von Argot in den Gedichten von François Villon wird analysiert.
Welche Rolle spielt die Literatur in der Arbeit?
Ein Exkurs in die Literatur des 15. und 19. Jahrhunderts dient dazu, die Verwendung von Argot in der Literatur zu belegen und zu illustrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Argot, französisch, Sprachwandel, Soziolinguistik, Geheimsprache, kriminelle Banden, Wortbildung, langue verte, jargon, jobelin, Verlan, Coquillards, François Villon, französische Literatur.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass Argot sowohl eine lebendige als auch eine sterbende Sprache sein kann.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Forschungsfrage lautet: Wie existiert, funktioniert und wandelt sich der Argot in der Gegenwart?
- Arbeit zitieren
- Elisa Schneider (Autor:in), 2008, Das französische Argot im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172695