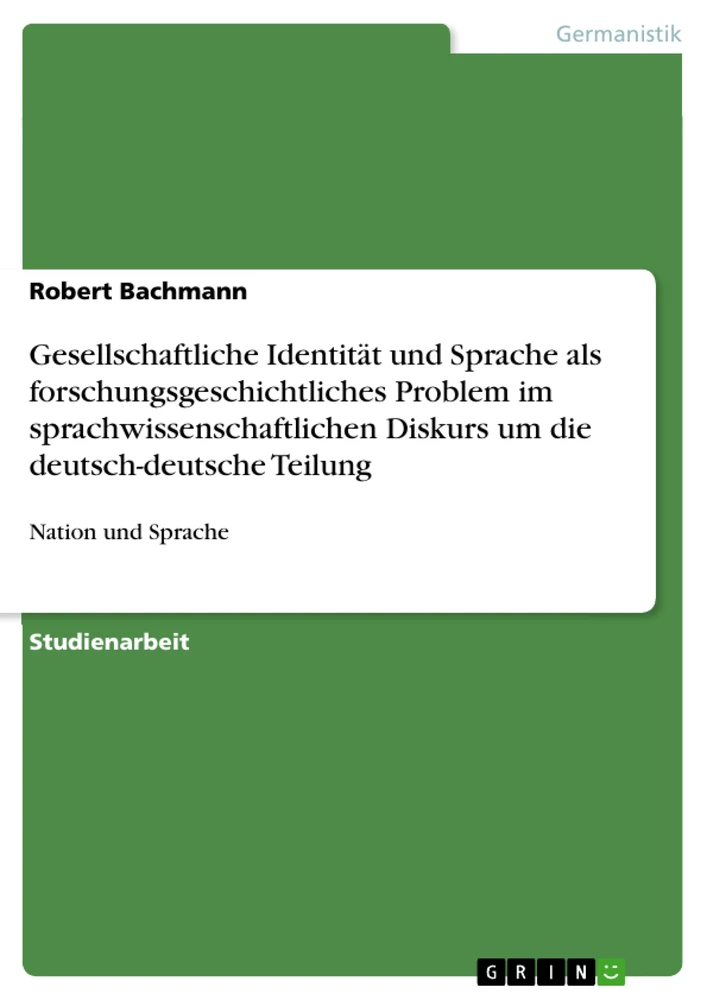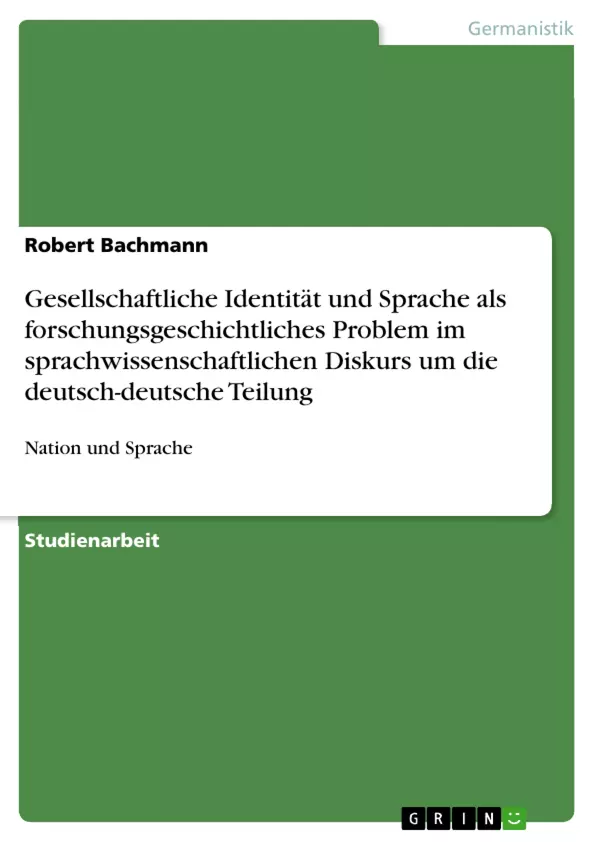Aus der Einleitung: "Verliert […] ein Volk mit seiner Sprache seine Volksart, so begreifen wir, dass es um seine Sprache als um sein Heiligstes, sein selbst ringt, in ihr ist es in seinem innersten Wesen bedroht." (Baege, M.: Deutsche Sprache ein Spiegel deutscher Volksart.)
Diese Aussage Max Baeges aus dem Jahr 1900 beinhaltet eine Auffassung von Sprache, die ebenso allgemein verbreitet wie problematisch ist. Sie impliziert, dass die jeweilige Sprache eines Volkes ein, wenn nicht sogar das zentrale Kriterium seiner Gegebenheit ist. Auch wenn Baeges Zitat durchaus Raum für verschiedene Auslegungen offen lässt, so muss man dennoch einwerfen, dass es mit der Glorifizierung der Sprache als innerstes Wesensmerkmal eines Volkes wenig Platz für andere Faktoren der Herausbildung und Etablierung von Gesellschaften lässt. Solcherlei Anschauungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Sprache und gesellschaftlicher Identität sind im allgemeinen Bewusstsein der Menschen nahezu selbstverständlich. Aus wissenschaftlicher Sicht muss dieser Sachverhalt jedoch äußerst kritisch betrachtet werden. Für die Wissenschaft wird dieser Sachverhalt spätestens da ein Problem, wo wissenschaftliche Erkenntnisse mit politischen, ideologischen oder patriotischen Überzeugungen korrelieren.
Die vorliegende Arbeit soll am Beispiel der sprachwissenschaftlichen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) während der deutsch-deutschen Teilung zwischen 1949 und 1989 zeigen, worin die Probleme des Zusammenhangs zwischen Sprache und Politik bzw. der Gleichsetzung von Sprache und gesellschaftlicher Identität eines politischen Gebildes wie einer Nation liegen. Für ein allgemeines Vorverständnis soll zunächst auf einige theoretische und sprachgeschichtliche Aspekte hingewiesen werden, welche Aufschluss über die besondere Rolle der Sprache in Deutschland geben sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nation und Sprache - Allgemeine Problematik
- Grundlegendes
- Sprache als Politikum
- Nation und Sprachwissenschaft im Kontext der deutschen Teilung
- Phase 1
- Phase 2
- Phase 3
- Phase 4
- Resümee zu den Defiziten der Forschungslage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Problematik des Zusammenhangs zwischen Sprache und gesellschaftlicher Identität im Kontext der sprachwissenschaftlichen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) während der deutsch-deutschen Teilung. Sie untersucht die problematischen Aspekte der Gleichsetzung von Sprache und nationaler Identität, insbesondere im Hinblick auf die politische Instrumentalisierung der Sprache.
- Die Rolle der Sprache in der Konstruktion nationaler Identität
- Die politische Instrumentalisierung von Sprache im Kontext der deutschen Teilung
- Die Herausforderungen der sprachwissenschaftlichen Forschung im Spannungsfeld von Politik und Wissenschaft
- Die problematische Korrelation zwischen Sprache und gesellschaftlichen Strukturen
- Die vielschichtigen Faktoren, die zur Entwicklung von Gesellschaften beitragen, einschließlich der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die problematische Gleichsetzung von Sprache und nationaler Identität anhand eines Zitates von Max Baege. Sie stellt die Problematik der Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit politischen Ideologien heraus und führt in die Thematik der sprachwissenschaftlichen Forschung in der DDR und der BRD während der Teilung ein.
Im ersten Kapitel wird die allgemeine Problematik des Zusammenhangs zwischen Nation und Sprache betrachtet. Es werden theoretische Aspekte und sprachgeschichtliche Faktoren analysiert, die die Rolle der Sprache in der Konstruktion nationaler Identität beleuchten.
Das Kapitel „Grundlegendes" stellt die Problematik der Gleichsetzung von Sprachen und sozialen, politischen oder anderen Gebilden in Frage. Die Arbeit argumentiert, dass die Sprache zwar eine wichtige Rolle für die Kommunikation und die Identitätsbildung spielt, jedoch nicht als ausschlaggebendes Merkmal für die Definition von Gesellschaften betrachtet werden kann.
Der Abschnitt „Sprache als Politikum" behandelt die politische Instrumentalisierung der Sprache und zeigt auf, wie Sprache als Mittel der Machtausübung eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema „Nation und Sprache" im Kontext der deutsch-deutschen Teilung. Wichtige Schlüsselwörter sind: Sprache, Nationalität, Identität, Politik, Wissenschaft, Sprachwissenschaft, DDR, BRD, Teilung, deutsch-deutsche Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Sprache und nationale Identität zusammen?
Oft wird Sprache als zentrales Kriterium für ein Volk angesehen. Die Arbeit hinterfragt diese Gleichsetzung kritisch, da sie andere soziale und politische Faktoren vernachlässigt.
Was war das Problem der Sprachforschung während der deutschen Teilung?
Wissenschaftliche Erkenntnisse korrelierten oft mit politischen Ideologien. Sowohl in der DDR als auch in der BRD wurde Sprache teilweise als Politikum instrumentallisiert.
Gab es eine „DDR-Sprache“?
Die Arbeit untersucht die These, ob sich durch die politische Trennung eigenständige gesellschaftliche Identitäten und damit verbundene sprachliche Unterschiede entwickelten.
Wer war Max Baege?
Max Baege war ein Autor, der um 1900 die Auffassung vertrat, dass ein Volk mit seiner Sprache sein „Heiligstes“ und sein innerstes Wesen verliere – eine Sichtweise, die in der Arbeit kritisch analysiert wird.
Welche Rolle spielt Sprache als Machtinstrument?
Sprache kann zur Abgrenzung politischer Systeme und zur Konstruktion nationaler Identität genutzt werden, was sie zu einem zentralen Gegenstand im Spannungsfeld von Politik und Wissenschaft macht.
- Quote paper
- Robert Bachmann (Author), 2007, Gesellschaftliche Identität und Sprache als forschungsgeschichtliches Problem im sprachwissenschaftlichen Diskurs um die deutsch-deutsche Teilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172713